[erschienen als 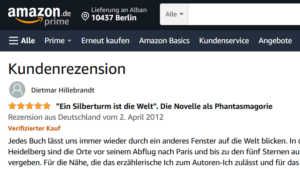 → amazon-Rezension
→ amazon-Rezension
am 2. April 2012; hier wiederholt
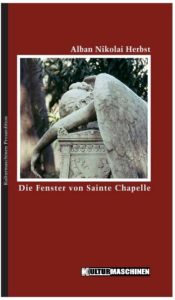 wegen der revidierten Fassung der
wegen der revidierten Fassung der
„Fenster von Sainte Chapelle“ inner-
halb der → Gesamtausgabe der Er-
zählungen, Band 2, „Wölfinnen“]
Jedes Buch lässt uns immer wieder durch ein anderes Fenster auf die Welt blicken. In diesem ist es das Fenster eines schreibenden Mannes, der nach Paris reist. Frankfurt und Heidelberg sind die Orte vor seinem Abflug nach Paris und bis zu den fünf Sternen auf Seite 9 war ich zum Einstieg gekommen und hätte spontan auch fünf für diese Ouvertüre vergeben. Für die Nähe, die das erzählerische Ich zum Autoren-Ich zulässt und für das Spiel auf der Klaviatur der ganz eigenen Sprache, so improvisiert und gerade deshalb poetisch. In Heidelberg wird ein Ereignis beschrieben, bei dem eine Asiatin, um auf ihr Lädchen aufmerksam zu machen, eine Blume für die Ordnungskräfte zu weit in eine Parklücke stellt. Es ist unschwer in diesem Bild die Verletzbarkeit des reisenden Schriftsteller-Erzählers zu erkennen, der sich in der Ignoranz durch den Kulturbetrieb und einer anonymen Staatsmacht oder Obrigkeit spiegelt. Wir nehmen unmittelbar teil an den Gedanken des Schriftstellers, die ständig getränkt sind mit Referenzen an seine eigene Literaturrezeption von literarischen Größen wie Joyce und Proust. Da wird ganz nebenbei über die unterschiedliche Reaktion auf den Vortrag einer sexuell freizügigen Stelle bei Joyce durch Eva Demski gegenüber der des Schriftstellers selbst sinniert und von seiner Vorliebe für dieses Helios-Kapitel, aus dem das Zitat stammt. Ein gelungener Leseabend, an dem Eva Demski nach ihm las, ist ihm in Erinnerung geblieben.
Amüsiert, manchmal sogar ergriffen, fühlte ich mich ob des Erfindungsreichtums des Erzähler-Ichs, der so unmittelbar jeden Eindruck sublimiert und in die Sphäre der Kunst zu schicken weiß. Der Paristrip wird eigentlich zur Frage nach dem Gott oder Teufel in uns allen. Ein umstrittenes Werk des Schriftstellers, „Meere“, soll ins Französische übersetzt werden, aber er erhält gleichzeitig einen mysteriösen Auftrag zu einem Buch von einer Madame „Le Duchesse“, von dem es nur ein Exemplar für diese ominöse Zwittergestalt selbst geben soll. Hinter diesem Drahtzieher im Hintergrund könnten sich Gott oder der Teufel persönlich, aber auch Anklänge an bekannte literarische Figuren wie der Baron de Charlus aus Prousts „Recherche“ oder die Herzogin von Guermantes verstecken. Begleitet wird dieses fleischgewordene Mysterium von einem dienstbaren Geist in lederner Kluft, der Jenny Michel heißt, aber gleichzeitig auch das Potential zum Erzengel Michael oder dem Luftgeist Ariel hat. Parzival im Labyrinth der Gestalten auf der Suche nach dem Gral, der sich immer nur wieder als der Mensch selbst zwischen Gut und Böse herausstellt. Körperlichkeit wird in der Sexualität selbstbewusst ausgelebt, um sich anschließend um so entspannter der eigenen Kunst widmen zu können. Irgendwie paart sich die Dominanz im Spiel des Sexuellen mit der künstlerischen Demut, Sensibilität und Verletzbarkeit. Letztlich steckt in jedem Menschen auch ein gefallener Engel. Wie beiläufig wird grandios vom Religiösen erzählt, das eine kleine Geschichte enthält, in der Touristen die Kirche als Ort der Andacht und Hoffnung mit ihrer permanenten Fotografiererei entweihen. Nur „wenn die Menschen draußen sind, ist drinnen Gott“, wird ein französischer Film zitiert. Ein schönes Bild, das deckungsgleich auch für die „Trolle“(verbal marodierende Kommentatoren) im Weblog des Schriftstellers gelten könnte.
Die Erzählung durchbricht beinahe in Echtzeit mediale und personale Grenzen, denn die Kommentatoren im Blog, mit denen der Erzähler in ständigem Kontakt steht, sind hinter ihren Pseudonymen manchmal erkennbar und werden so Teil dieser erzählten Anderswelt. Zwischen den Personen besteht ein hierarchisches Machtgefüge und multiple Abhängigkeiten. Das Restaurant Silberturm, „Tour d’argent“ werden die folgenden Abschnitte genannt, verweist auf das Abhängigkeitsverhältnis von Verleger und Autor, der ständig unter dem Druck steht, sein Werk versilbern zu müssen.
Die Phantastik in der Novelle ist sogar was ihren eigenen Text angeht immer intertextuell, denn von den Kommentatoren in seinem Weblog werden Pfingstrosen (Päonien) als narrative Unstimmigkeit angeprangert, weil sie bereits in Deutschland kurz vor dem Abflug auf einem anderen Tisch standen und nicht, wie von ihm berichtet jetzt in seiner Unterkunft „La Nonchalante“. Der Schriftsteller beklagt nun einen geknackten Code, bei dem es sich eben nicht um den der Eingangstür zu seiner Wohnung handelt, sondern den der Imagination und Erzählweise des Erzählers selbst. Sofort wird mit der Transponierung in eine Opferrolle begonnen und das Bild eines Mannes evoziert, der geschlagen, verletzt und ausgeraubt vom Luftgeist Jenny verarztet werden muss. Den Code nicht zu besitzen, bedeutet auch mit dem Verlust seiner Identität bedroht zu werden. Ohne Identität ist man aber selbst in der Fiktion ein nicht oder nur schlecht wahrgenommener Niemand.
Der Schriftsteller flüchtet sich in seiner Phantasie auf ein Schiff, das Prada heißt oder wo man Prada trägt. Die Touristen an beiden Ufern der Seine erscheinen ihm wie Ströme von Joyceschen Rindern. Der Ich-Erzähler verleiht sich im Folgenden eine gewisse räumliche aber auch zeitliche Omnipräsenz. Es ist ihm egal, wo er sich gerade befindet, ob auf dem Pradakahn, in seiner nonchalanten Unterkunft, im Restaurant Silberturm mit „Le Duchesse“, auf einer Technoparty, immer hypostasiert er seine eigenen Eindrücke, richtet seinen Blick auf sich selbst und seine innere Imaginationswand. Das Narrative malt Bilder und Personen der Außenwelt zu seinem ganz eigenen Panoptikum. Ein wenig stiegen mir beim Prada-Boot Vergleiche mit einer Fahrt über den Styx in den Kopf, von dessen Planken sich der Schriftsteller mit einem beherzten Sprung aus seinen Lenden heraus vor dem Tod retten will. Die griechische Mythologie klang schon beim Rekurs auf Joyce an. Alles wird schillernde Metapher und in den Teppich der poetischen Sprache gewebt. Ein Prozess, an dem der Leser so unmittelbar wie möglich, durch Einbeziehung des Weblogs als Personen- und Ereignisfundus, teilnehmen soll.
Mit der Engelsgestalt Jenny bricht der Erzähler nun zur Sainte Chapelle auf. Seine exklusive Besichtigung allerdings erlebt der Ich-Erzähler aufgewühlt und rebellierend. Gegen jede sich monotheistisch patriarchal gebärende Religion lehnt er sich auf und sieht bereits in dem ihn empfangenden Mönch einen Zuhälter. Die Französische Revolution wird nicht nur als Sturm auf die Bastille, sondern als Befreiung von der Knechtschaft unter der Kirche und dem Gottesbild heraufbeschworen. Das Erzähler-Ich begreift sich selbst als „G e i s t des Aufstands“, der Gott als Vaterfigur und den Sakralbau als „Ställe Pädophiler“, als „herrlich verlogenen Bau“ anprangert.
Es ist ein Feuerwerk der Imagination, das in der „Sainte Chapelle“, sowohl auf den Seiten der Schilderung des Kirchenbesuchs, als auch im ganzen Buch überhaupt abgebrannt wird. Das sprachliche Niveau halte ich für außerordentlich hoch und sprachgewaltig, was der Phantastik eine ganz eigene Ausprägung gibt. Die Einbeziehung des Weblogs darüber hinaus ist ein schriftstellerisches Wagnis.
Dann werden die Kommentatoren des Weblogs selbst zu teilnehmenden Personen einer Frivolitätenparty im Technoclub „Le paradis de Pantin“, eine Art Nachtclub in einem Pariser Vorort. Manchmal weiß man beim Lesen gar nicht mehr, ob man sich in einer Kirche oder in einer Szene aus Stanley Kubriks letztem Film „Eyes Wide Shut“ im Schloß Somerton auf einem orgiastischen Maskenball befindet, der sich lediglich im Kopf des Erzählers abspielt. Das orgiastische Fest in der psychedelischen Techno-Disco und Halbschattenwelt gerät zu einer an Hieronymus Boschs „Garten der Lüste“ erinnernden Gemälde, wobei die Abrechnung mit Gott oder der blinden Religiosität der Menschen zum Aufruf für die Freiheit in der Schöpfung wird. Das Paradies ist die Akzeptanz der Menschen untereinander über jede geschlechtliche Differenz hinweg und das Schöpferische im Menschen seine Freiheit schlechthin. Indem sich das „Ich“ in dem künstlerischen und schöpferischen Prozess aufzulösen beginnt, reflektiert es sich selbst als ein Wesen, in dem Gott und Teufel zugleich angelegt ist. Sie sind von ihm selbst geschaffene Allegorien in seinem inneren Kampf um das Menschsein.
Neben dieses Fest in der Techno-Disco wird kontrastiv eine Begegnung höchst seltsamer Art in der „Sainte Chapelle“ gestellt. Man könnte sagen Gott selbst trifft sich mit seinem verlassenen Sohn, wobei der Sohn nicht Jesus ist, sondern das Alter Ego aller Menschen, falls es so etwas überhaupt gibt. Es ist eine wirklich fein gestrickte „Göttliche Komödie“ anderer Art. Das immer wieder allegorisch auftauchende Erzengelpersonal, vier an der Zahl, ist leicht zu dechiffrieren. Das Zimmermädchen Raffaela als den gleichnamigen Erzengel, wie auch „Jenny Michel“ als Erzengel Michael oder der Absender der Vertragsemail für den neuen Roman des Erzählers Herbst am Schluss, der mit „Gabrielle U. Riel“ unterzeichnet ist. Im Grunde werden alle Figuren Teil des Erzähler-Ichs und der Erzählstoff reißt dieses Ich ständig mit fort. Die Erzählung sprengt das altbekannte Genre der „Phantastischen Literatur“, ist darin nicht vollständig kategorisiert. Es ist vielmehr eine einzigartige und sehr avancierte Spielart autobiographischen Schreibens, die Elemente des Phantastischen zwar aufgreift, aber nicht zuletzt in der Einbeziehung virtueller Kommunikationsplattformen wie das Weblog im Internet modern und innovativ wirkt.
Ich-Auflösung bei gleichzeitigem totalen Hineinfallenlassen in die Ich-Imagination. Während die Orgie naturgemäß etwas Blasphemisches hat, gerät die Morgenröte danach zu einer Art doppelten Katharsis zwischen Dichter und Gott, der sich in einem multilingualem Priester materialisiert. Bei aller Religionskritik wird er als das erkannt, was auch er ist, ein mit den Projektionen der Menschen Beladener. Der „Code“ ist in Wahrheit nicht zu knacken, er bleibt das, was über das „was die Welt im Innersten zusammenhält“ hinaus will, der Impuls, der das Leben selbst ausmacht. Das geforderte Buch will der Schriftsteller nur dann schreiben, wenn Gott auf seine Rache- und Erzengel verzichtet, wenn Religion nicht gleichzeitig Gewalt implizieren würde.
Es handelt sich zweifelsfrei um eine phantasmagorische Novelle. Die konstituierenden traditionellen Elemente sehe ich mehrfach erfüllt. Die einzige Begebenheit ist die Reise, eine Rahmenhandlung ergibt sich durch den gleichen Standort zu Beginn und am Ende in Form von Berlin. Das durch den gesamten Text laufende Dingsymbol dürften die Pfingstrosen sein, deren abfallende Blätter eine äußere Erscheinungsform des Codes sein könnten. Der offene Schluss besteht darin, dass der Schriftsteller den von ihm geforderten Roman bei einem zweiten Besuch in Paris erst noch schreiben wird. Auf diesen Roman müsste die ganze literarische Welt eigentlich gespannt sein. Aber auch durch diese kleine Novelle ist der Himmel und die Erde nicht leerer, sondern reicher und voller geworden. Es ist allerdings immer auch der Himmel in uns selbst, der nach Freiheit verlangt, und ohne die er keiner ist.
Wie alle Leser, kann auch ich nur durch mein Fenster der Sainte Chapelle blicken. Manchmal sehe ich auf das blaue Meer an der Küste der Normandie oder der Bretagne, vielleicht sogar bis nach Berlin, das auch am Meer liegen könnte. Doch der erste Schritt wird immer sein, sich für eine Weile selbst zu vergessen, damit wir hinter unserem eigenen Spiegelbild den erschöpften Engel auf einem Friedhof in Rom sehen, der wir alle sind. Alban Nikolai Herbst hat ihn gesehen.
***
NOTA:
Wir, die Fiktionäre Der Dschungel, haben versucht, den Autor des vorstehenden, wie wir finden großartigen Textes, Herrn Dietmar Hillebrandt, zu erreichen, um die Erlaubnis für diesen Beitrag einzuholen, aber fanden, da es im Netz einige Dietmar Hillebrandts gibt, nicht einmal eine diesen bestimmten Dietmar Hillebrandt erreichbare Adresse. Wir bitten gegebenenfalls um Entschuldigung und würden den Text bei einem urheberechtlichen oder sonstigen Einwand sofort wieder herausnehmen. Mag sein, und wir hoffen es, daß er durch Suchmaschineneintrag auf die jetzige Dschungelveröffentlichung aufmerksam und so oder so reagieren wird.
![]() Für Herbst & Deters Fiktionäre:
Für Herbst & Deters Fiktionäre:
Kritiker, 20. Februar 2022

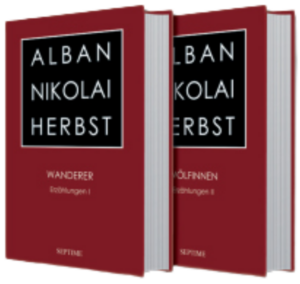
Endlich ist da jemand, der den Reichtum einer Erzählung von Alban Nikolai Herbst angemessen erfasst und würdigend bespricht: die hochpoetische Sprache, die Tiefendimension, die Metaphern, das Allegorische, die Intertextualität, das Neue, das im Genre der Phantastik nicht eingehegt werden kann, und so weiter. Ich wünsche dem Autor mehr und mehr solcher Leser.
Eine beeindruckend detailreiche und vielschichtige Interpretationsleistung, die eines ganzen ANH-Dechiffrier-Syndikats würdig wäre. Wobei freilich zumindest zwei Dinge klar sein sollten: Erstens verschwindet unter dem schier berstenden Sternenhimmel dieser Deutungsexplosion der real vorhandene Text. Und zweitens hat man nur dann die so geringe wie wünschenswerte Chance, die Novelle auch hin und wieder mal zu verkaufen, wenn man dem Normalleser dringend den Deutungshorizont verschweigt, zu dem er sich aufschwingen müsste, um das Buch zu verstehen.
Ich plädiere für folgendes Vorgehen: Lasst uns froh und glücklich sein, wenn das Buch ohne einen solchen Deutungszwang gelesen wird. Und wenn dann der eine oder andere Leser von sich aus auf 10% dieser Entschlüsselungen verfällt, dann wollen wir eine kleine Freudenträne verdrücken und beglückt schweigen.
Umarmung sagt A. Esch
Lieber Esch,
zum einen warne ich leise davor, Leserinnen und Leser für naiver zu halten, als sie sind; sie sind auch nicht so, sagen wir, anspruchslos, wie gerne – besonders von Zielgruppenschreibern und den entsprechenden Verlagen – gedacht wird. Wer nicht fordert, senkt das Niveau und, mehr noch, zerstört schleichend den Bildungshorizont aller. Und zwar mutwillig um eines leichteren und erhöhten Umsatzes wegen.
Zum anderen glaube ich nicht, daß der Anlaß dieser Kritik, nämlich meine Sainte-Chapelle-Erzählung, in dieser Deutungsexplosion verschwindet, und zwar deshalb nicht, weil des Rezensenten Lust an dem Text so spürbar ist. Wenn so etwas geschieht, überträgt sie sich. Begeisterung ist ansteckend.
Sie werden Recht haben. Ich bin da wohl zu negativ eingestellt. Man schraubt seine Erwartungen irgendwann runter, wenn man immer wieder erfährt, was die Menschen alles „zu schwierig“ finden. Meine Erfahrung ist: Wenn 100 auf einen komplexen Text treffen, winken 99 ab und einer wird mit Glück zum Fan. Lassen Sie uns zusammen hoffen, dass sich dieses Verhältnis dereinst umkehrt.