[→ Poetologische Thesen I
→ Poetologische Thesen III]
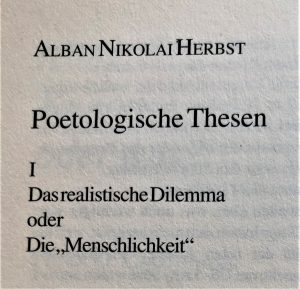
Es gibt ein Recht des Menschen auf literarische Identifikation: auf sichWiedererkennen. Wie problematisch, letzten Endes nämlich religiös dieser Satz immer auch ist, bildet er doch ein tiefes Bedürfnis von Leserinnen und Lesern ab, das vielleicht in der Identifikation mit anderen als von demselben Stamm seinen anthropogenetischen Ursprung hat1. Eigentlich hat alle Kunst solche sozialen Wurzeln, nur daß sie in der Dichtung, die aus einer Kultur herausschaut, wie moralische, schließlich humanistische, am Unbewußten ansetzende Verhaltensdirektiven wirken: Vor allem der realistischen Literatur eignet ein solcher menschlicher Blick. Zur Menschlichkeit gehört die Bestimmung von Grenzen, etwa von Tabus, nämlich Gesetzen, die nicht nach ihren Gründen befragt werden sollen und also gefühlt werden müssen.
Ein Tabu ist eine als naturgesetzlich empfundene Verhaltensregel: Sie ist in der Psyche zu Stein, wenn nicht sogar zum Monument geworden.2 Für den Menschen, der sich ja nie als Prozeß, sondern in jedem Moment seines Lebens als immer schon „fertig“ erlebt – sozusagen als ein Auto, das die Zeit wie eine Straße befährt -, ist das Tabu ein Teil seiner selbst, und wenn man es angreift, gefährdet man seine Identität, das heißt für ihn: ihn selbst. Dieses Ideal von sich selbst will sich nicht nur im anderen erkennen – also erleben, daß andere genauso sind, wie man selbst ist -, sondern nutzt ihn als Spiegel, in dem man sich seines eigenen Ichs vergewissern kann. Dafür dient unter anderem Literatur, – freilich nur dort, wo sie sich an einen Konsens hält und die „vorgegebenen“ Tabus und Selbstbilder ständig reproduziert, und zwar um so nachdrücklicher selbstverständlich, wenn die vom Leser als „Ich“ empfundenen Konzepte Gefährdungen ausgesetzt sind, vor allem solchen von außen, etwa durch eine völlig technisierte Lebenswelt. Besonders angesichts dieser, massiv auf die Menschen einwirkenden Wirklichkeit, soll sich Literatur auf diejenigen Bereiche zurückziehen, die als menschlich empfunden werden, sozusagen einen Konsens-Alltag bestätigen, von dem man doch längst weiß (es aber eben nicht fühlt und auch gar nicht fühlen will), daß er bloß wie Sprühlack unsere tatsächliche Wirklichkeit bedeckt. Diese hauchdünne Schicht ist menschlich, d.h. sie bestätigt einem sowohl das IchIdeal als auch die Tabus und Normen, ohne die, ahnt man, Zusammenleben nicht so recht möglich wäre. Das ist die „Aufgabe“, die realistische Literatur erfüllt. Genau darin liegt aber ihr poetisches Dilemma.
Nun meine ich „menschlich“ in jederlei Sinn, auch in dem einer gewissen Laxheit: Der Lack ist ja nicht streng, nicht gleichmäßig aufgetragen, sonst bliebe für das, was wir als Freiheit empfinden, zu wenig Luft. Deshalb verwende ich den Begriff „Realismus“ in diesem Aufsatz ein wenig ungenau, indem ich etwa Naturalismus und Realismus ineins nehme und auch GenreErzählungen wie Krimi oder Science Fiction mitmeine. Wofür es allerdings gute syntaktische Gründe gibt: Realismus ist keine Frage des Sujets. Nicht zum Beispiel, weil etwas Alltagswirklichkeiten beschreibt, ist es auch gleich schon „realistisch“. Es ist nämlich denkbar, daß eine genaue, den Alltag erfassende oder das doch intendierende Literatur gerade nicht mehr realistisch, also menschlich sein kann; sie würde Wirklichkeit andernfalls simplifizieren und tut das oft auch. Sie tut es einerseits, um nicht für ihre Leser Bedrohung zu sein, die sie doch gerade abwehren oder für deren Abwehr sie Mittel – und seien es solche einfühlender Erkenntnis – an die Hand geben soll; andererseits will sie verständlich bleiben und zwar weitgehend: um möglichst viele Leser zu erreichen. Das hat nicht nur kommerzielle Motive, – aber selbst, wo ein Text sie hat, lebt er Text meist aus einer erkenntnisleitenden Idee, von welcher angenommen wird, sie sei gut übertragbar, bzw. sowieso inneres Mobiliar des Lesers.
Allem, was realistisch genannt wird, liegt eine feste, namentlich grammatikalisch definierte Poetik zugrunde, der ein ganz ebensolches Menschen- und Weltbild korrespondiert. Mensch und Sprache werden als „fertige“, allenfalls leicht modifizierbare Entitäten angesehen, sind nicht prozessual aufgefaßt, sondern idealisiert. Deshalb tendiert der Realismus entweder zur Typisierung oder zur psychologischen Erklärung oder positivistisch, „einfach“, zur Schilderung von Phänomenen. Und, versöhnlich ausgleichend, zur Ironie. Aber es gibt letztlich keinen Zweifel und höchst selten Ambivalenz. Das Material selbst, die Sprache (und der Sprechende, bzw. Schreibende und Lesende: der Mensch), steht nicht zur Disposition. Für Leser ist das – was immer die Geschichte dann erzählt – hochgradig beruhigend. Ihr IchIdeal bleibt unangetastet und zugehört in ihrem jeweiligen Alltag anderen, „eigentlich“ miteinander identischen IchIdealen. Im Leseprozeß wird eine soziale Heimat imaginiert, die in der Wirklichkeit wahrscheinlich längst zerriß. Wenn sie denn überhaupt je bestand. Da sie als Wunsch vorgegeben ist, den die Erzählung erfüllt, weiß der Leser immer schon, worauf sie hinauswill. Das Bild greift nie über den Rahmen hinaus, schon gar nicht wird ans Fundament gerührt.3 Man ist als Empfänger „gemeint“, aber so, daß man „heil“bleibt. Selbst „kritische“ Literatur attackiert nicht den Leser4, sondern sucht seine Solidarität (sein „Verständnis“ – freilich auch für andere, die vorgeblich fremd sind). Dafür steht die ungebeugte Grammatik. Die über sie transportierte Botschaft, die durch jede solcher Geschichten hindurchscheint, ist angenehm sentimental: daß der Mensch leide und Leid nicht sein solle. Und daß man mit ihm umgehen könne.5 Dabei ist es ziemlich belanglos, ob es sich um Individuen oder ganze Völker handelt, ob Kriegs- oder Alltagssituationen beschrieben werden, ob Liebe, Leidenschaften, Haß. Jedesmal ist versichernde Aufklärung am Werk, nämlich der Wille, einen dem Ich scheinbar äußerlichen, ihn von Außen quälenden Zustand zu ergründen oder sogar zu verändern, wenigstens, ihn darzustellen und kritisch zu beleuchten. Dadurch wird sich der Leser seiner bestätigt, und sei es als Opfer dieses „schlechten Zustandes“. Daß der ein Teil des Lesers und das Fundament selbst nicht stetig, sondern löchrig sein könne, darf nicht gedacht werden: Tatsächlich wären ohne dieses Denktabu weder demokratische Gesellschaft noch Rechtsfähigkeit garantiert.
Die Garantie wird durch realistische Literatur transzendent gegeben, sozusagen von dem ÜberIch aus, den der Autor für die Erzählung und die Erzählung für den Leser darstellen: Beide scheinen ungebrochen über ihre sprachlichen Mittel verfügen, also freien Willens imaginieren zu können. Die autonome Autorschaft unterliegt weder für den Leser noch für den Schriftsteller einem Zweifel. Der allwissende Erzähler ist selbst da impliziert, wo der Text aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, denn hinter dem Ich steht immer ein es objektivierender („konstruierender“) Autor6. Psychoanalytisch gesprochen: Es erzählt der reife, gesunde Erwachsene, „der Vater“ (ist die Geschichte gefühlvoll, tut es „die Mutter“).7 Deshalb glaubt der Leser, was er liest oder, nüchterner gesagt, läßt er sich ein. Man wird erzählerisch sozusagen gestillt, gewickelt, geschaukelt, in den Schlaf gesummt oder erfährt seine Grenzen; es wird Spannung auf uns ausgeübt, die uns belohnt, auch vorübergehend bestraft, doch nur, damit der folgende Lohn um so intensiver gefühlt werden kann. Einerseits ist die Sprache von ihrem Gegenstand immer weit genug entfernt, daß ihr Leser jederzeit auf Distanz gehen kann – sie objektiviert also -, andererseits läßt ein Leser sich von ihr führen, weil die Kompetenz des Autors akzeptiert ist und von der Erzählung auch gar nicht problematisiert wird. Man könnte ja auch ausrufen: Wer ist der, daß er meint, mich belohnen zu dürfen?! Vor allem aber stellt die Kompetenz dem Leser die frühkindliche – als Empfindung virulent gebliebene – Situation wieder her oder reaktiviert zumindest die (gefühlte, erhoffte) Überzeugung, jeder Frustration folge ihre Erlösung. Auch aus diesem Grund sind Wiedererkennen und Identifikation tragende Rezeptionsmuster der realistischen Literatur; ihre große Leserschaft will wiederholen, aber anders: Die alte, meist ungute Erfahrung von Trennung wird mit Lust und Güte als Verschmelzung und/oder als Verfügung über die Geschehnisse einer Geschichte besetzt. Man kann sagen, der Leser möchte regredieren (= „sich wegträumen“), aber dabei „die Mutter“ nach eigenen Wünschen bestimmen. Auf diesen Impuls können sich die Autoren verlassen.
Didaktisch gesehen, gibt es für Dichter keine bessere Ausgangsdynamik, um ihre gesellschaftlichen, bzw. religiösen Werte weiterzugeben oder solche gar erst zu begründen. Realistische Literatur hat immer etwas von Mission: Dieser Satz beschreibt ziemlich genau die Konsequenz der menschlichen Freude darüber, es sei einem Autor an seinen Lesern gelegen.8 Zwar ist es dadurch mit „Aufklärung“ nicht mehr weit her, wohl aber mit Wirkung (deren Dimension sich am wirtschaftlichen Erfolg messen läßt), und zwar genau deshalb, weil so getan und von den meisten, jedenfalls den nicht-zynischen Autoren dieser poetischen Richtung tatsächlich vorausgesetzt wird, es spreche ein freier Erwachsener zu freien Erwachsenen. In Wirklichkeit9 sind das Sich-Versenken, das Sich-Überlassen, das ein sich-Ausliefern ist, und der träumerische Zustand, in den ein von der Geschichte „gefangener“, nämlich in sie verfangener Leser gerät, Regression.10 Praktisch, also politisch gesehen, hat Lektürelust etwas von dem magischen Denken eines Schulkindes, das sich die Fibel zum Schlafen unters Kopfkissen legt.11 Der Verfasser der Fibel hingegen schläft nicht, sondern wacht über den Schlaf seines Lesers, ja singt ihn in ihn hinein. Man erschreckt Kinder, die schlafen sollen, nicht; man regt sie auch nicht auf: Sie dürfen ja nicht „überdrehen“. Deshalb wird so sehr auf die Syntax geachtet und vertraut konstruiert: Der Ton eines Wiegenlieds zieht das Sandmännchen an, nicht sein Inhalt. Der wird ganz nebenbei vermittelt. Ein realistischer Autor „hört“ nicht „in sich“, schon gar nicht in die Sprache, sondern kalkuliert sie, und am Material des „gegebenen“ Vokabulars kalkuliert er seinen Leser. Das darf, ja muß der realistische Autor tun, denn sein poetischer Ansatz ist in jedem Fall von anthropologischer Überzeugung getragen: Sie weiß, was der Mensch ist. Die den Text grundierende, allen gemeinsame Grammatik fungiert dabei als seelische Äquivalenzform. Logischerweise bringt sie Geld, macht also Auflage. Sie wird vom Leser, weil er in den Mitteln des Ausdrucks mit dem Autor scheinbar einig ist und sich deshalb nicht untergebuttert fühlt, als emanzipierend erlebt.
Realistische Literaturen sind politische per se. Nur insofern Menschenbilder kulturell differieren, können sie „unmoralisch“ sein, nämlich je vom anderen Menschenbild aus gesehen. Streng genommen, war auch die Nazi-Literatur eine moralische; bloß daß der Widerstand und ein Großteil der Welt ihre „ethischen“ Prämissen nicht teilten; wir Nachgeborenen teilen sie (hoffentlich) sowieso nicht. Doch kommt es nicht von ungefähr, daß völkischer, sozialistischer und sogar religiöser Realismus einander formal derart ähnlich sehen: Alle verstehen Sprache als Funktion und nur als Funktion. Sie dient ausschließlich der Übermittlung von Wissen und Erfahrung, von Recht und Unrecht, Ideologien und Glauben. Daß etwas „schön geschrieben“ sei, fällt allenfalls als Mehrwert ab und bleibt letztlich Beiwerk. Sprache wird als Einkaufstüte verstanden; sie braucht feste Griffe, damit der Leser die Geschichte heimtragen, d.h. internalisieren kann. Reißen sie, reißt gar der Sprachkorpus selbst, dann hat der Autor die Übereinkunft mit dem Leser gekündigt, hat ein Bündnis verraten, das ihm die Regression ungefährdet erlauben, nämlich als Bestärkung erleben lassen sollte, es sei mit uns alles in Ordnung, nur seien halt die Zeitläufte mies. Er hat nun seine 50 cent ganz umsonst bezahlt. Fürs nächste Buch muß sich der Autor über schlechte Absatzzahlen dann nicht mehr wundern.
So lautet das Bündnis: Zwar lieferst du („lieber Leser“12) dich mir aus, aber ich werde alles dafür tun, daß es dir gut dabei geht13; weil ich das garantiere, darfst du mich als „Mutter“, die das Regressionsmilieu herstellt, aber auch als „Vater“ akzeptieren, der dir sagt, wo es langgeht.14 Ich werde deine Nacktheit nicht zu deinem Schaden wenden. Umgekehrt hat auch der Leser seinen Anspruch gegen den Autor: Garantiere mir, daß sich alles nachvollziehen läßt, d.h., daß ich weder je aus der Geschichte, noch gar, als Folge, aus meinem Alltag falle15; verlasse mich also nicht. Ich möchte bitte keine Fremdheit erleben, schon gar keine in mir selbst. Die einzige Garantie, für die sich ein Autor verbürgen kann, ist indes die unerschütterliche Sprache, sind grammatische und semantische Struktur. Erstere garantiert den Sinn, letztere die Empathie. Der Leser will regredieren, der Autor ermöglicht ihm das. Um mich nicht mißzuverstehen: Diese Regression ist für eine gelungene LeseErfahrung unerläßlich. Hierin haben realistische Autoren – auch die, die sich bewußt abgegriffenster Klischees bedienen – recht. Allerdings bleibt die Frage, was man dann mit ihr macht.
Wie rigoros Wunsch und Wille der Leser in dieser Beziehung sind, zeigt die Tatsache, daß zwar Literatur insgesamt ihre gesellschaftliche Leitfunktion längst verloren hat, aber nicht, weil sie ihrem alten Bildungsauftrag nicht mehr nachkommen könnte – dagegen spricht schon, daß Sachbücher enorm florieren -, sondern weil andere Medien die Regression viel einfacher, ja überwältigend, vor allem aber schneller bewerkstelligen: etwa der Spielfilm. Ins Kino zu gehen, bedeutet für den Rezipienten (nicht für die Produktion, da ist es gerade umgekehrt) weniger Aufwand, z. B. an Lebenszeit. Dem springt obendrein, durch die Teilnahme vieler anderer, eine nicht ganz unrituelle Entindividuation bei. Man regrediert gemeinsam, fällt also zusammen mit anderen in den gesuchten vorbewußten Zustand, der mit der Belletristik den Vorteil teilt, hinterher, wenn man wieder „Person“16 ist, kommunikabel zu sein. Was das Unheimliche des Vorgangs, den jede Regression ja auch bedeutet und dessentwegen der Leser ganz zu Recht gesichert sein will, wie eine gesellschaftliche Absprache – ein Ritual eben, freilich säkular – aufs Normale mäßigt. Nicht umsonst fand die neue Blüte belletristischer Literatur genau dann statt, als sie sich auf ihre realistischen Grundzüge besann und dem Spielfilm nacheiferte. Erfolgreiche Romane tragen heutzutage bereits ihr Drehbuch in sich; eine zum Umschreiben nötige Anstrengung bedarf, anders als bei eigenwilligen, die Regression scheinbar verweigernden, nämlich Anstrengung fordernden Büchern, keiner großen Kunst. Es ist also zu simpel, realistischen Autoren vorzuwerfen, sie manipulierten. Das tun sie zwar bisweilen, jedenfalls sofern sie bewußte Autoren sind; nichtsdestotrotz sind sie ihren Lesern nah, und deren Sympathie hat Grund.
Man macht sich das am besten an realistischen Texten klar, die „floppen“, also nicht angenommen werden. In solchen Fällen ist immer wieder zu hören, der Autor habe seinen Lesern nicht genügend Freiraum gelassen, „da ist ja gar kein Platz für meine Fantasie“. Damit wird nichts anderes beklagt, als daß sich Subjektivität des Autors oder Eigenbewegung eines Textes so individuell über den Leser schob, daß sich die Erzählung nicht mehr als Spiegel verwenden ließ und die herbeigesehnte Regression nicht stattfinden konnte. Statt dessen wiederholt sich die einstige, als schmerzhaft empfundene Individuation abermals schmerzhaft, etwas, das man von einer realistischen Geschichte gerade nicht will. Weshalb der Leser lieber gleich vom Text abrückt. Entweder gehört der dann gar nicht zur realistischen Literatur, auch wenn seine Syntax das auf ersten Blick nahelegt – ein Großteil der fantastischen Hoch-Literatur17, aber auch Hans Henny Jahnn und der frühe Martin R. Dean sowie der ersten Arbeiten Thomas Hettches gehören in diese Kategorie18 -, oder aber der Autor hat in seinen Mitteln gefehlt und schlechtes Handwerk abgeliefert. Manchmal ist nicht recht zu entscheiden, welche Sachlage vorliegt. Bisweilen hat ein Autor aber auch versucht, den Realismus qua realistischer Mittel zu verfremden, z.B. das epische Theater Brechts, das meist da funktioniert, wo Leute zusammenkommen, die eh die gleichen Überzeugungen eint – eine heimtückische, weil dem Autor zuwiderlaufende Volte der regressiven Bewegung. Oder es wurde von vornherein zu abweisend formuliert: Der Stellenwert „erster Sätze“ von Büchern ist bekannt. Sie müssen und sollen die Schwelle in die regressive Imagination überwinden lassen. Deshalb ist Lesermanipulation hier am leichtesten zu erkennen. Bisweilen muß auch ein Ende entsprechend formuliert sein, da viele Leser gern ein Buch a tergo beginnen: Auch dieses Verhalten zeigt an, wie wichtig ihnen „Sicherheit“ ist. Wer Leser nicht verprellen will, muß das akzeptieren. Sind aber sowohl der Anfang als auch das Ende derart präformiert, bleibt kein Raum für eine Eigenbewegung des künstlerischen Prozesses – für Subjektivität -, und die Unbedingtheit der grammatischen Struktur wird zur Unbedingtheit semantischer Handlungsräume. Letztlich erlaubt Realismus keine Entwicklung, sondern setzt seinen Leser fest. Realistische Literatur ist immer konservativ.
Ihre interessanteste Crux ist allerdings, daß sie zu genau sein kann. Man denke an Peter Kurzecks wahnhafte Minutiösität. Eidetisch getriebenen, transzendiert er den gesamten Ansatz durch Übertreibung. Sowas kostet Leser. Ob ein Buch Kunst sei oder nicht, spielt für die – en gros – keine Rolle: Ja, je einfacher – abstrakter! – der realistische Text ist, um so größer sein regressionsförderndes Moment. Wen es nach Regression verlangt, der fordert das „einfache Erzählen“: Kaum etwas begleitete die jüngste Renaissance der deutschsprachigen Literatur so sehr wie der Ruf nach Simplizität. Zu erreichen ist die größtmögliche Menge an Menschen; dem entsprechen ziemlich genau sowohl das Marktgesetz als auch die einstige Doktrin gesellschaftlicher Relevanz, was in die politische – moralische – Grundbewegung realistischer Literatur zurückweist. Nichts ist menschennäher, nichts kommt (den kindlichen, in der Kindheit begründeten) Bedürfnissen mehr entgegen; nichts ist aber auch unrealistischer, also den wirklichen Innenverhältnissen unangemessener, und nichts überantwortet das Leser-Ich so sehr ökonomischem Interesse. Es geht den Rezipienten realistischer Literatur eben gar nicht um Realität (die ja immer komplexer wird, ja sich sogar entkörpert19: Einfachheit ist genau der Begriff, der ihr am fernsten steht), sondern ist ein Ruf nach dem Spiegel. Der realistische Profi weiß darum und verdammt die Adjektive.
Nun gibt es professionelle, sehr bewußt didaktisch operierende Autoren – denken Sie an die belletristischen Texte Burkhard Spinnens20, denken Sie an Uwe Timm, denken Sie an Dieter Wellershoff, der, was Dichtung ist, Benns wegen nun wirklich besser weiß – und solche, die realistisch aus Instinkt sind, sozusagen naiv21, interessanterweise sind das oft weibliche Autoren, Susanna Tamaro oder Margit Schreiner etwa, deren Formulierkunst kindlich nach dem Lektor ruft. Und es gibt zahllose Mischformen, etwa unter „DDR-Autoren“, die, ob sie das wollen oder nicht, die ästhetische Erbschaft des Sozialismus weitertragen, z.B. Hilbig22 und Brussig. Oft schwimmt das in einer ironisch-sentimentalen Suspension wie bei Judith Hermann oder stützt sich auf den schnoddrigen Sprachwitz einer Katja Lange-Müller.23 Allen diesen Ansätzen ist eine verhaltenspsychologische, zugleich aber auch freiheitliche Auffassung vom Menschen zueigen und das Vertrauen auf das, was man sieht, verbunden mit – ich möchte es „moralischer Intaktheit“ nennen. Der realistische Autor ist so gut wie immer das, was man unter einem „guten Menschen“ versteht. Manche sehen sogar wie „gute Menschen“ aus, etwa Peter Härtling. Die gehen – ein wenig erschreckend ist das schon – mit der „Achse des Bösen“ ganz prima zusammen und subtrahieren von der Welt die Metaphysik, die sie doch mit dem Wort „böse“ zugleich proklamieren. Letztlich ist „der Mensch“ rein soziologisch. Abweichende, „nicht-menschliche“ Ideen wie der Destruktionstrieb werden als Spinnerei denunziert, wenigstens jedoch als psychologisch begründbare Abnormitäten, also als krank, gekennzeichnet. Es gibt kein Verständnis für Tragik, Kassandra hat hier nichts zu suchen, die Zerfleischungsorgie, die Penthesilea und Achilles24 feiern, erst recht nicht. „Ick bin doch ooch nur ein Mensch“: Daran, als wäre der profane Satz heilig, rührt der realistische Autor nicht.
Tatsächlich steht dahinter eine Vorstellung, die ich anthropologische Konstante nennen möchte: Sie findet sich gut in der vielfach zu hörenden Meinung ausgedrückt, es habe sich „der Mensch“ nie verändert und werde das auch nicht tun, er lebe, wie Kästner schreibt, imgrunde noch auf den Bäumen. Von immer den gleichen Nöten sei er bewegt, der gleichen Hoffnung, denselben inneren Zielen, derselben Physiologie. Nun gibt es Indizien, daß das zumindest psychisch nicht stimmt. Nur ein kurzer Blick auf die erstaunlichen Hirn-Fähigkeiten ganz junger Menschen am Computer genügt schon. Dergleichen hat sich selbstverständlich auch in den Künsten niedergeschlagen25. Die Mehrzahl der Rezipienten sieht es aber offenbar anders, sieht eben nicht. Also besteht für sie gar kein Grund, einen Inhalt und die Form seiner Übermittlung, Sprache, zu trennen, bzw. als string-ähnlich ineinander verwickelt und die Form selbst evolutionär oder gar mutierend zu begreifen. Andererseits werden Veränderungen zwar vielleicht nicht gesehen, wohl aber – und dann ungut dräuend – gefühlt und müssen um so nachhaltiger weggeschoben werden. Deshalb wird ganz besonders auf die „Intaktheit“ der Lektüre geachtet. Bisweilen wird eine rhythmische Irritation hingenommen, das war’s dann aber auch schon. Wie von einem Instinktrest bestimmt, tendiert der Leser dazu, den status quo – sofern er nicht allzu großes Leid impliziert – zu erhalten, ehe er sich auf das Neue und, weil das nicht gewußt sein kann und meist auch kaum prognostizierbar ist, Gefährliche einläßt. Soviel ist sicher wahr an der anthropologischen Konstante. Aber sie gilt eben weder naturwissenschaftlich noch historisch-sozial, sondern ist ein sich ausgesprochen langsam verschiebendes, ständig zum ästhetischen Rückfall neigendes RezeptionsPhänomen. Am deutlichsten wird das übrigens in der kaum je akzeptierten Neuen Musik nach Anton v. Webern. Sowohl im kompositorischen Niveau wie in der Nähe zur Gegenwart läßt sich keine größere Distanz als die zwischen sagen wir Madonna und Helmut Lachenmann denken. Wem die realistische Literatur zuspielt, muß ich hier nicht eigens schreiben. Schon Madonna ist ein Kompromiß, ich könnte noch ganz andere Namen nennen.26
Dennoch, wo Dichtung sich ernst nimmt, schlägt auch die ungeliebte Welt hartnäckig durch. Auch deshalb kommt es immer wieder zu Mischformen. In nuce jedoch wird auf Subjekt/Prädikat/Objekt beharrt und darauf, daß ein Wort einen Sinn hat, der definitiv ist. Schon die Aura eines Wortes, also daß es semantische Höfe gibt, ist etwas, das eigentlich nicht sein soll: deshalb der Unwille, wenn ein Text mit zuviel Fremdwörtern agiert. Dabei hört man schon, daß „degoutant“ etwas anderes ist als „zweifelhaft“, auch wenn beide Begriffe dasselbe meinen. Der realistische Erzähler (und Kritiker) geht konsequenterweise davon aus, daß sich alles, was irgend ein Fremdwort beschreibt, auch muttersprachlich darstellen lasse, und der Liebhaber realistischer Erzählungen nimmt es dem Dichter sowieso übel, wenn er etwas nicht versteht. Daß „degoutieren“ einen Zwischenton in den Satz wirft, der nicht inhaltlich rückbindbar ist, finden „Realisten“ störend. Ganz zu Recht, denn das Fremdwort verrät das Bündnis ebenfalls, zumal es Anstrengung – Bildung – verlangt und sich nicht von jedermann „einfach“, auf Anhieb, erklären läßt.
Einfachheit ist eine Abstraktion, die Aristoteles folgt, nämlich den Satz vom ausgeschlossenen Dritten akzeptiert und außerdem Subjekt und Objekt trennt: Es gibt Wesentliches und es gibt Nebensächliches. Das Prädikat übernimmt es, beide in Beziehung zueinander zu setzen und zu bewerten. Wobei dieser Satz für die realistische Literatur schon viel zu metaphysisch ist: Der Autor ist es, der die Beziehung vermittels des Prädikats bestimmt. Imgrunde beherrscht den Realismus ein platonisches Modell: Es gibt viele Säcke, deren einer mit Subjekten, deren anderer mit Objekten27 usw. gefüllt ist und aus denen sich der Dichter bedient. Die Wörter selbst sind immer schon „da“ und allenfalls insofern „geworden“, als man ihre Bedeutungsgeschichten kennt und nachvollziehen kann; die spielen de facto indes keine Rolle. Letzten Endes sind die Wörter Ideen unveränderlicher Inhalte; deshalb sind Faktoren wie ihr Klang, ihre Form usw. allenfalls marginal; ihre semantischen Höfe stören, weil sie Begriffe ungewiß machen. Daraus eben ergibt sich, im Umkehrschluß, das FremdwortTabu28: Realistisch betrachtet, ist ein jedes Wort, ist jeder Satz und ergo jede Geschichte in eine andere Sprache übersetzbar.
Auch darin ist realistische Literatur höchst idealistisch. Doch gibt sie dieses ihr Fundament ungern zu. Denn es stemmt sich gegen ihre Intention. Ein „Realist“ hat, um diesem Widerspruch zu begegnen, immer sehr schnell die „Empirie“, also die menschliche Erfahrung, zur Hand, die das Bündnis mit dem Leser zu einem Nichtangriffspakt macht. Selbstverständlich ist die Erfahrung der meisten gemeint: Poetischer Popularismus. Das Ziel der realistischen Literatur ist immer der Pop. Stuckrad-Barre, ein hochbegabter Literat, hat vollkommen recht: Der regredierende Leser will „Fan“ sein.
Für den Idealismus ferner auch die Neigung zur Reduktion29: Kurze Sätze und schnell überschaubare Sentenzen, die aufs Wesentliche – die „Story“ – gerichtet sind: Bitte keine Verschachtelungen. Es geht um Informationsübermittlung, und zwar schön locker, damit das Ganze auch Spaß macht (das heißt: damit die Informationen nicht mit unserem Ich kollidieren). Überflüssige30 Aufzählungen, Reihungen, Wortzerspellungen, Neologismen und Brüche werden möglichst umgangen. Man sollte sich dabei, etwa was Unterhaltungsliteratur anbelangt, die immer realistisch ist, nicht täuschen: Auch die Neigung zum Klischee ist eine Reduktion: nämlich werden einzigartige Phänome wie zum Beispiel die Liebe aus vorgefertigten Stanzen31 abgezogen, die sich en bloc zu Kitsch montieren lassen. Diese Art der Reduktion ist industriell normierbar und kommt so billig an Frau und Mann; gerade die Vertrautheit mit ihr verschafft den „einfachen“ Literaturen ihre Lesergemeinden. Reduktion meint immer bedeutete, bzw. bedeutende Funktion. Der Leser wird auf keinen Fall irritiert oder doch eine etwaige Irritation hinterher jedesmal aufgeklärt, nichts bleibt unklar. Wird ein Baum „grün“ genannt, so heißt das nicht, daß da gar kein Baum „ist“. Nie wird der menschliche Rahmen verlassen, ob nun in der Alltags- und Arbeitswelt-Story, ob im Wilden Westen, ja sogar im Gruselroman32: Aber bisweilen sind Fenster eingebaut, die auf „das Andere“, auf wirklich Unheimliches, hinausschauen lassen, doch als Fenster ausgewiesen bleiben, so daß eine andauernde Verunsicherung des Lesers vermieden wird, etwa durch die Aufklärung eines „unerhörten Ereignisses“ als Traum oder Halluzination. Noch der prekärste Lebensraum, besonders der unserer gegenwärtigen, völlig unüberschaubaren Moderne33, erhält seine Orientierung: Wenn uns schon alles flöten geht, so bleibt doch die grammatikalische Verständigung. Es ist kein Zufall, daß der entstehenden Informationsgesellschaft die kleine Blüte realistischer Erzählweisen parallelläuft: Sie vermitteln den Lesern das Gefühl, alle Information sei an bekannte und gesicherte Sinngefüge gebunden. Wo nichts mehr überschaubar ist, wird metaphysische Transzendenz höchst gefährlich. Das Metaphysische soll in die Realität profaniert werden, soll veralltäglicht werden, in etwas, das hier und jetzt oder in absehbarer Zukunft vom Konsens-Alltag aufgesaugt werden kann. Fast jede Utopie – per se auf „Realität“ bezogen – ist von diesem agnostischen Ziel getragen; es soll alles pragmatisch gedacht werden können. Schon deshalb läßt sich dem in der grammatischen Struktur idealistischen Realismus politisch (semantisch) der Materialismus zuschlagen, und zwar besonders in seiner der Warenwelt verpflichteten Form. Vielleicht lebt die realistische Kunst genau aus diesem Spannungsmoment. Damit das gefühlt, also als Regression ausgelebt werden kann, wird das zunehmend brüchiger werdende abendländische Konzept des Ichs, desbezüglich schon Benn bemerkte, es habe „die Menschenlehre Europas, als Fiktion individuell existenter Subjekte, (…) nur noch einen kommerziellen Hintergrund“34, im Leser idealistisch wieder gekittet und festgezurrt. Mit anderen Worten: In der Regression stellt die realistische Literatur den Leser überhaupt erst als ein autonomes Ich her. Genau das erlebt er als wohltuend. Sie schafft sich ihren Rezipienten, indem sie ihm erlaubt, sich gegenüber dem Text als „ganz“ zu empfinden und so die anhebende Erfahrung des Säuglings zu wiederholen, daß er er sei, aber eben nicht vermittels der Trennung von der „Mutter“, sondern indem sie, als Text, zugegen bleibt. Die schmerzbesetzte Individuation wird für die Zeit des Lesens in eine lustvolle uminterpretiert35. Daß genau dies den regredierten Leser aber nicht reifen läßt, sondern ihn auf der Säuglingsstufe hält – abhängig von einer „Mutter“, dem Text, und seinen zahllosen, ebenso wirkenden Folgelektüren -, ist eines der dem Realismus immanenten Probleme. Brecht hatte das ziemlich auf dem Kieker und entwarf dagegen sein, aus politischen Gründen wiederum realistisch strukturiertes Verfremdungskonzept.
Der dem realistischen Erzählen inneliegende Widerspruch idealistischer Grammatik und materialistischer Semantik ist sehr wahrscheinlich einer der Gründe für den doktrinären Charakter des sozialistischen Realismus gewesen, der sich als Widerpart der Tauschgesellschaft ja gerade an sie band und ihr deshalb erlag. Mit soviel Materialismus wie dem, der die kapitalistische Welt konstituiert, konnte sein Idealismus sich auf Dauer nicht messen. Ebenso findet die vom Realismus ausgerufene, seinem Selbstverständnis so wichtige Aufklärung letztendlich nicht in ihm statt, und zwar eben nicht zuletzt deshalb, weil sowohl Autor als auch Leser nicht nur idealistisch, sondern sogar ideal („menschlich“) konstruiert werden; als derartige Konstrukte sind sie aber rein sprachlicher Natur, sind Subjekt und Objekt und Punkt. Die Materialität verschiebt sich auf den zu transportierenden, „nahezubringenden“ Sinn, also die von der Geschichte (bzw. Politik) transportierte Semantik, nämlich auf das „Ziel“, – ob es sich nun dabei, im sozialistischen Realismus, um die Befreiung der Arbeiterklasse handelt, ob um Völker ohne Räume oder um den konsum- und freizeitdefinierten demokratischen Staatsbürger des identifikatorischen Regressionsmodells, an dessen „Ende“, wenn das Ziel denn erreicht ist, die reine Unterhaltung steht36. Der sind wir nun nah.
Realistische Literatur ist grundsätzlich dualistisch konzipiert, etwas Drittes (gar Viertes, Fünftes und so fort) wird ausgeschlossen. Ihre Geschichten sind niemals „hysterisch“, sie dürfen nicht übertreiben, sondern haben sich am rechten Maß zu orientieren, und wenn sie sagen wir von Paranoia erzählen, so geschieht ihnen die Paranoia nicht, sondern sie stellen sie als etwas Äußerliches dar. Der Leser kann die Symptomatik wie ein Experimentator nachvollziehen, den sie nicht betrifft. Dem realistischen Erzählen entspricht eine klassische Auffassung von Physik, hier der Forscher, dort der Gegenstand und zwischen beiden die Apparatur, die Sprache, auf die sich beide, Leser wie Autor, verlassen können37. Weder werden Leser und Autor vom Gegenstand beeinflußt, noch dieser von jenen. Auch diese Annahme und ihre ständige Versicherung ist Teil des Bündnisses38. Wäre dem anders, kein Leser ließe sich auf Regression noch ein. Bei allem „Realismus“ sind Moderne und Gegenwart gerade nicht gefragt: Regression ist immer nach hinten ausgerichtet. Die realistische Erzählung ist ein historischer Roman, der Zukunft nicht nur nicht kennt, sondern abwehrt.
Klare Struktur will klare Formen. Das schlägt besonders dort durch, wo ein ästhetisches Ideologem wirklich Kunst wird, die ja die eigentümliche Fähigkeit besitzt, daß ihr jederlei Doktrin, Wahn, Religion, ja selbst allerweltlichste Absichten zum Anlaß werden können.39 Nun ist Kunst immer extrem, und Extremismus verweigert sich dem Populären, er zerreißt das Normale. Deshalb kann sich der Umstand einstellen, daß eine Kunstform, die es auf Regression ihrer Rezipienten anlegt, die Rezipienten gar nicht mehr erreicht, vielmehr sich elitär aristokratisiert, obwohl sie ihre eigenen Mittel und ihre Doktrin bloß konsequent umsetzt. Sie wird „total“. Solche Totalität ist für Leser bedrohlich. Vorangetriebene Reduktion in realistischen Erzählungen geht in Abstraktion über40, d.h. das, was versprach, die (frühkindliche, schmerzhafte) Individuation vermittels der perversen Bewegung, die das Lesen eines Buches als Ersatzhandlung ist, lustvoll zu besetzen, reduziert und eliminiert schließlich jedes Gefühl und Fühlen. Ich erinnere mich gut daran, daß mir Ursula Krechel, deren Prosa sicherlich dem Realismus zugeschlagen werden muß41, einmal sagte, es müsse darum gehen „abzuspecken“, ja jeden – wörtlich – „Erzählspeck“ zu vermeiden. Schon ihre Wortwahl unterstrich den Ekel und die – hochkünstlerische – Hypostasierung von Reduktion, die im Gebrauchskontext bloß als Ruf nach dem menschlichen Rahmen daherkommt – etwa von Kritikern, die sich als Sprachrohr der Lesererwartung verstehen – und so weitgehend eben auch nicht gemeint ist. Nicht, daß nichts mehr zu sehen und zu fühlen ist, sondern Überschaubarkeit und Selbstbestätigung sollen geleistet sein. Gelingt das, empfindet der Leser den Text als „schön“, und zwar ziemlich wurscht, welcherart Handlung und Charaktere die Geschichte vor unsere inneren Augen stellt. Konsequent reduziert darf nur regredieren, wer seines Lebens über ist.42 Der Leser will sich in und mit Regression das Leben gerade verschönern. Er möchte, wie der Säugling, in den Mittelpunkt des „mütterlichen“, poetischen Interesses rücken. Hinter den embryonalen Zustand will er trotz allen Babyspecks nun doch nicht zurück.
Der Realismus ist das ptolemäische Weltbild der Kunst. Er meidet Übertreibungen, weil sie als die Protuberanzen, die sie sind, auf die Sonne verweisen und also darauf, daß sich eben nicht alles um die Erde dreht. Daher die Verunglimpfung jedes Manierismus’; schon das Wort selbst, obwohl doch eigentlich nur eine ausgeprägte Handschrift meinend, gilt stiltechnisch als beinah obszön. Besser, man spricht es gar nicht erst aus. Das ist, wie jedes Tabu, selbstverständlich Abwehr; zwar wirkt sie meist unbewußt, dennoch handelt es sich um einen sehr klugen Bann. Denn alles, was überschäumt, ist protuberantischer Natur. Also wird es als „häßlich“ empfunden und schließlich verunglimpft. Man denke an Goethes geradezu irrationale Abwehrhaltung gegen barocke Architektur. Menschen, denen an Mitte gelegen ist – notwendigerweise sind das die meisten -, verbrennen sich schnell. Deshalb soll sich auch Intensität an gesellschaftliche Usancen halten.
Das Leben soll zivilisiert sein, von daher heißt das oberste Gebot des gesellschaftlichen Zusammenlebens wie des realistischen Romans „Sublimation“. Was sich dem nicht fügt, wird als barbarisch empfunden, als Auswuchs, als unsozial.43 Der angestrebte Regreß ist nicht etwa einer tief in die individuellen Triebstrukturen, sondern langt ins Vor-Individuelle, das etwas von „Großer Verbindung“ hat. Darum ist der Kitsch immer nah. Das LeserIch soll mit den erstrebten moralischen Kategorien vereint sein, der Leser selbst vergesellschaftlicht werden. Die Sozialität ist bergende Matrix, „Mutter“ nämlich abermals. Wo aber das Ich bloß Funktion eines erfolgreichen, sich totalisierenden Marketings ist, hat es endgültig abgehalftert, und die realistische Literatur ist ihm tatsächlich adäquat, ja sie muß nicht einmal mehr fürchten, ihr Leser entwickle eigene Energien, sich aus dem Regreß herauszuentwickeln und erwachsen zu werden. Soll und will er ja auch nicht. Literarischer Realismus wird zur poetischen Selbstfinanzierungskiste: Was sagbar ist, ist sagbar, darüber hinaus geht nichts. Schon deshalb birgt ein dem verpflichteter Ausdruck niemals semantische Fremdheit; Expressivität – geschweige Expressionismus – ist tödlicher, als wenn die Geschichte rein äußerlich bleibt. Je äußerlicher gestaltete Sprache ihrem Gegenstand ist, um so größer die Chance, daß eine Geschichte als Projektionsfläche möglichst vieler Leser Verwendung findet. Wie durch ein Fernrohr, das der Text für sie ist, schauen die Leser auf Wirklichkeit. Das Teleskop Sprache wirkt darin völlig der Kamera gleich: Sie trennt die Betrachter von den Objekten, jene sind vorm Übergriff dieser scheinbar geschützt.44 Die Wirklichkeit, die sie wahrnehmen, hat schon deshalb nichts mit ihnen zu tun. Sie wird nur insofern für „realistisch“ gehalten, als unterstellt ist, Wort und Begriff seien deckungsgleich. „Wahr“ sind sie dann, wenn sich eindeutige (sogenannte „richtige“) Aussagen daraus ableiten lassen; indem sich der Leser mit der Autorenperspektive (einem oder mehreren Protagonisten oder mit dem Autor selbst) identifiziert, ist dann er es, der die Aussagen trifft. Daraus zieht er im gleichen Vollzug mit dem Regreß Macht; sie ist es, die ihm die Regression so ungefährdet gestattet. Genau deshalb soll das Erzählen auch auktorial sein. Spiele, die den Autor dekonstruierten, waren bei der breiten Leserschaft niemals beliebt. Realistische Autoren wissen das, sie sind ja nicht dumm, jedenfalls nicht dümmer als Fantasten. In jedem Fall sind sie selbstbewußter, weniger von (Selbst-)Zweifeln geplagt und schon insofern psychisch autonom. Sie haben, ganz wie Marx wollte, die völlige Gewalt über ihre Produktionsmittel, zumindest geben sie glaubhaft vor, sie zu haben; die meisten – man denke an Rosamund Pilcher – sind davon sogar innig überzeugt. Dies überträgt sich auf den Leser, der sich in seinem Regreß nun nicht nur auktorial, also als der „Mutter“ überlegen, sondern auch noch als „frei“ fühlen kann.45 Er ist es, der die Regeln bestimmt und die „Mutter“ sich ihm dauerhaft zuwenden läßt. Aus diesem Grund – und weil der Leser sein Wunschdesign in ihm wiedererkennt – hat realistisches Erzählen die beneidenswerte Fähigkeit, auch gänzlich unrealistische Szenarien glaubhaft zu machen, etwa im Agenten- und Abenteuerroman, in den Blumenromanen von Verwirrung und Nöten des Herzens und sogar in der meisten Science Fiction: Immer ist Sprache das verläßliche, trennende Rohr vor den Augen: bisweilen Brille oder Lupe (Gesellschaftskritik), in anderen Fällen ein Schlüsselloch.
Nun ist Freiheit eine Frage des Bewußtseins und Rechtsfähigkeit erst recht. Das realismusliterarische Bündnis ist ein staatsbürgerlich souveränes: Es stellt gar nicht mehr die Frage, ob Demokratie möglich oder ob überhaupt eine Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen vorausgesetzt werden könne, sei es beim Kauf seiner Socken, sei es, wenn er und in wen er sich verliebt. Realistisches Erzählen darf solche Fragen nicht stellen, weil manche Antworten von tief unten die Syntax torpedieren könnten. Dann wäre es mit dem auktorialen Erzählen vorbei, vorbei auch mit der Moral, vorbei mit der grammatischen Subjekt(Substantiv)-Objekt-Trennung. Jede Aussage wäre allenfalls eine Möglichkeit, falsch und richtig ließen sich nicht eindeutig scheiden. Das Fernrohr zerbräche. Besser, es bleibt die Sprache unangetastet, bleibt überzeitliches Koordinatensystem, bleibt Ptolemäus. Deshalb will die realistische Literatur auch nichts von unbewußten Prozessen wissen; übergeschichtliche – allegorische – akzeptiert sie schon gar nicht.46 Das meinte ich mit der verhaltenspsychologischen Verfaßtheit des realistischen Konzepts. Der Aufschwung, den die deutschsprachige Literatur seit Fall der Mauer nahm, inklusive Fräuleinwunder und sogenanntem „amerikanischen“ Erzählen, verdankt sich genau dem; es ist eine Folge- oder Wechselerscheinung des Umbaus der abendländischen, im Tiefen-Denken verwurzelten, immer auch metaphysischen Kunstkultur ins wirtschaftslibertäre Verständnis von Kultur als funktionalem Kommunikationsraum, dem alles gleich dienlich sein kann. Man darf nicht vergessen, daß der literarische Realismus eine Errungenschaft des Handel treibenden Bürgertums ist.47 Seinem inneren Motor entspricht ein höchst darwinistisches Zweiklassensystem. Der Paradigmenwechsel ist selbstverständlich auch ein politischer Regreß und ging dem literarischen voraus, ja hatte sehr viel Zeit, sich vorzubereiten. Tatsächlich bedurfte er des Wechsels zweier, gar dreier Generationen. Die Eltern haben offenbar nicht gewußt, was sie taten, als sie ihre Sprößlinge dem pfiffigen Kinderkreuzzug ausgesetzt haben, den McDonalds seit Anfang der achtziger Jahre führte. Denn schon sie selbst wurden ja mehr durch US-Kultur denn durch diejenige der eigenen Herkunft geprägt. Auch die revoltierende Jugend wuchs, vor allem musikalisch – seelisch – mit US-amerikanischer Sprache und Rhythmik auf, mit Folk, Blues und Rock, schließlich Pop, bzw. mit dem englischen Beat. Heimat für die heutigen 20- und 60jährigen liegt also da, nicht etwa hier. So etwas macht einen auf Dauer sehr geneigt, auch fremde gesellschaftliche Werte zu akzeptieren48, selbst dann, wenn man in einer wichtigen Orientierungsphase gegen sie protestiert hat, etwa gegen Imperialismus am Beispiel des Vietnamkriegs. Gerade vermittels Musik, weil ihre Struktur nichtsprachlich ist, schleifen sich Selbstverständnisse in die Psychen ihrer Hörer ein.49 Schon plappert alle Welt nach – der ick-bin-allhier-Intellektuelle immer voran -, U- und E-Literaturen seien nicht voneinander unterschieden, ja potentiell gleich viel wert. Das stimmt nicht einmal (oder selten) in Hinsicht auf Vermarktbarkeit. Welch ein Unsinn die Aussage aber sowohl formal als besonders auch inhaltlich ist, zeigt ein kurzer Blick in sagen wir „Moby Dick“ einerseits und „Der kalte Hauch des Flieders“ (Judith Hawkes) andererseits. Dennoch wird dergleichen seit Jahren behauptet, und zwar nicht nur von Dummköpfen. Darauf dümpelt der Realismus ganz gut. Konsequenterweise hat der derzeitige Etappensieg des „einfachen Erzählens“ den Angriff auf alles im Schlepp, das graben – ausgraben – will, etwa die Psychoanalyse. Das Ungeheure wird des Zimmers verwiesen oder soll nett etwas vortanzen. Meist schreit es indes, wie bei Poe50, von unter den Zimmerdielen. „Endlich werden wieder Geschichten geschrieben“, schwärmt aber, weil taub, die Kritik. Die Autoren kümmern sich um die Leser, was diese, siehe oben, angenehm finden. Daß sie dadurch als definierbare, d.h. eben nicht als autonome Personen behandelt und damit zu Elementen einer Zielgruppe werden, der man die neue Jeans verkaufen will, stört sie nicht. Ja neuerdings wollen sie das ganz bewußt sein. Also gibt Stuckrad-Barre auf seinen Lesungen „Hits“ zum besten. Die Persönlichkeitsmuster der Leser mutieren in Design, der regredierten Psyche heften sich Markennamen an. Auf dem Umweg über raffiniertes Marketing kehrt das scheinbar von der Moderne „erledigte“ Identifikationsmodell, welches die deutsche Klassik formulierte, in die nachmoderne Rezeption zurück… eine Bewegung, die wir auch aus Spielfilm und Fernsehen kennen. Godard, Tarkovski, Rivette passé, es leben Big Brother und Dörrie! Die Welt rückt sich in den „Künsten“ wieder auf „humane Maße“ zurecht und seien es die von Containern. Daß sie real aber diese Maße immer weiter verliert, daß Wirklichkeiten sich längst um neue Wirklichkeiten angereichert haben,51 die sich der direkten Erkenntnis entziehen und dennoch den Alltag formen, umformen – und den darin lebenden Menschen mit; sogar Bekanntschaften, ja Liebesbeziehungen entstehen daraus -, daß die nur noch in astronomischen Größenordnungen quantifizierbaren Elemente eines dennoch praktisch angewandten Wissens selbst von Fachleuten nur noch mathematisch nachvollzogen werden können, daß ein einheitliches Verständnis von Welt für den Einzelnen gänzlich ferngerückt ist, Welterklärung also notwendigerweise wieder mythisch wird, kommt nicht vor oder nur im Rahmen einer phantastischen Erzählung, die man als solche liest. Man kann das auch gut, wenn sie sich an die realistischen Vorgaben der Sprachregeln hält, also unter Science Fiction in der Buchhandlung steht – besser noch: auf dem Grabbeltisch liegt – und nicht etwa Seite an Seite mit Walser. Dann bringt sie das Wirklichkeitskonzept der Leser nicht durcheinander, sondern zementiert es und kann deshalb selbst in ihren scheinbar abstrusesten Bizarrerien locker konsumiert werden. Wer etwas über „die Welt“ wissen will, greift sowieso zur realistischen Literatur. Der allerdings neige ich mich nicht etwa zu, weil sie realistisch wäre, sondern weil sie mir hilft, die Realität zu – – – verleugnen.
______________________________________________________________
1 Jedes Fußballspiel, jede Techno-Nacht, jeder Parteitag leben von ihm, weshalb sich, sagt man statt „Gruppe“ „Rotte“, über die reflexive Vokabel „zusammenrotten“ die Bedeutung des Vorgangs ins ziemlich Ungute verschiebt, zumal für einen Deutschen: Naiv Fan zu sein, wird zum hochexplosiven Politikum. Deshalb ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs jeder deutsche Jugendliche lieber „Amerikaner“ gewesen und nach „Amerika“ orientiert: USA-Kultur entbindet uns von jederzeit bewußter Verpflichtung.
2 Hierauf zielte Kant ab, als er vom „gestirnten Himmel über mir“ und dem „moralischen Bewußtsein in mir“ sprach: Beide, die objektive und die subjektive Welt, erhalten dieselbe unmittelbar anschauliche Evidenz. Das ist, wohlgemerkt, konstruiert. Dichtung vermittelt moralische Direktiven, als ständen dahinter Tabus.
3 Zum Fundament gehören in jedem Fall sexuelles Verlangen und sexuelle Fantasien. Deshalb haben bei aller „Lockerung“ der Sitten sexuell aufgeladene Texte nie ihr skandalöses Moment verloren. Kollidieren sie mit normierten Denkmustern, bzw. mit Selbstbildern, wird fast sofort allgemeiner Protest laut. Nichts verunsichert so tief wie Pornografie. Das gilt besonders, wird sie mit nicht-sexuellen Szenarien, zum Beispiel politischer Theorie, konnotiert.
4 Bitte sehen Sie mir nach, wenn ich immer „der Leser“ und „der Autor“ schreibe, auch wenn ich Leserinnen und Autorinnen mitmeine; die grammatisch gesehen patriarchale Struktur der deutschen Sprache erzwingt das, sofern man nicht unschön formulieren will. Dieses „man“ gehört logischerweise in dasselbe Problemfeld. Ich bin mir dessen bewußt, will aber nicht „experimentieren“, weil ich das bei einem Text über Realismus unangebracht fände.
5 Wird das verneint, zerbricht geradezu augenblicklich die syntaktische Ruhe, und es kommt in der einen oder anderen Weise zum poetologischen Experiment, etwa beim frühen Döblin, bei Stramm und, sowieso, bei Celan. Lyrik scheint, nebenbei bemerkt, insgesamt anfälliger für das moderne, „zerspaltene“ Bewußtsein zu sein und reagiert seismografisch.
6 Das bedeutet, daß ein realistischer „Ich“-Text immer Rollenprosa ist: Das scheinbare Subjekt, Ich, ist in Wahrheit zum Objekt geworden, mit dem sich der Leser nun identifiziert. Um sich tatsächlich mit einem Subjekt identifizieren können, müßte er sich mit dem Autor identifizieren, der aber hinter der Ich-Konstruktion des Textes ja gerade verschwindet, und zwar um so mehr, je intensiver er dieses Ich beteuert. Der Autor ist für einen Leser, der ihn nicht persönlich kennt, genauso fiktiv wie er für jenen. „An den Leser denken“ bedeutet schon von daher, ihn abstrakt und funktionell aufzufassen. Sie macht ihn zu einer determinierten und determinierbaren Gesellschaftsmaschine. Diese Bewegung ist ausgesprochen hinterfotzig und von hochgradig täuschendem Charakter. Der Leser will aber getäuscht sein: Deshalb bettelt er so oft darum, daß eine Geschichte „autobiografisch“ sei. „Autobiografisches“ entbindet ihn nämlich abermals von Verpflichtung, und er darf gerechtfertigt „glauben“.
7 Selbstverständlich verwende ich diese Begrifflichkeiten symbolisch, bzw. modellhaft!
8 Pervers wird das in der Marktgesellschaft: Den Produzenten ist am Ich als einem Käufer („Konsumenten“) gelegen. – Als hätte er sowas geahnt, hielt Kant seine ethische Theorie geradezu zwanghaft von menschlich bestimmten Inhalten frei und faßte den moralischen Imperativ rein formal. Er schrieb sozusagen, und zwar gegen die Realismusmoral, experimentelle Literatur. Schiller, einen „Realisten“, hat das furchtbar aufgebracht.
9 Ich weiß, ich weiß: problematisch…
10 Möglicherweise läßt sich u.a. daraus erklären, weshalb signifikant mehr Frauen als Männer Belletristik lesen: Dem gesellschaftlichen männlichen, nach wie vor patriarchalen Rollenverständnis läuft Regression zuwider. Spricht hierfür nicht auch, daß viele Frauen lieber „Männer“ als „Frauen“ lesen? (Sich eman(n)zipierende Frauen kehren das um.) Und: Es gibt eine auffällige Neigung von Frauen zu „weichen“ („weiblichen“) Autoren wie Proust: Identifikation mit dem Mann („Vater“), der indes zur „Mutter“, d.h. sexuell deaktiviert wird, damit sich die frühkindliche Situation so überaus nährend wiederherstellen kann. Ein weiteres, eher pragmatisches Erklärungsmodell: Die Frau ist auch heute noch, zumindest während der frühen Mutterschaft, weitergehend in den häuslichen Alltag eingebunden als ein die Familie versorgender Mann. Das bindet die Leserin an die herkömmliche Auffassung nach „einfachen“, tradierten Notwendigkeiten gestalteter Realität.
11 Das Gegenteil dieser Dynamik hat Borges im Blick, nämlich den wirklich erwachsenen Empfänger, der, und sei es nur für sich selbst, intellektuell zurückstrahlen kann: „Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn“. Das schließt die Regression nicht aus; etwa sind Geschichten wie „Das Aleph“ dem Traum ja geradezu verpflichtet. Aber Borges’ Dichtung nimmt das regressive Milieu als Basis und entwickelt den Leser, indem er denken muß, weiter.
12 „Seid ihr auch lieb gewesen?“ Die Kinder nicken; schon gibt es Erdbeereis.
13 „Ich will für dich nur das Beste.“: Nach wie vor wichtigster Erziehungssatz.
14 Genau deshalb hat das an die realistische Literatur geknüpfte Modell „kritischen Lesens“ so versagt: Es ist nämlich Arbeit und obendrein bewußte. Sie widerspricht diametral dem realistischen Rezeptionsmodell. Das machte einem in der Schule den Kafka so sauer: Interpretation im Lehrplan setzt eine realistische Auffassung von Dichtung voraus. Sie wird funktional, also auf einen Sinn bezogen, verstanden, der sich auch begrifflich mitteilen läßt. Ein Schüler, der als Interpretation sagen wir eine Bleistiftzeichnung abliefert, hat in jedem Fall „das Thema verfehlt“, und zwar auch dann, wenn die Zeichnung der Erzählung viel näher gekommen sein sollte als jede Deutung, die sich, sagen wir, Szondi verdankt.
15 „Hoffentlich komm ich aus dieser Geschichte heil wieder raus“, sagt man, ist man in mißliche Situationen geraten.
16 „persona“ heißt „Maske“! – Soviel zur Wahrheit des Individuums.
17 Man könnte sie auch „allegorische Literatur“, bzw., → mit Carrière, die intensive nennen. Speziell auf sie will ich im dritten Teil dieses Aufsatzes kommen.
18 Es gibt auch das ganz andere, sozusagen umgedrehte Phänomen, eine Literatur, die auf den ersten wie zweiten Blick überhaupt nicht realistisch wirkt, es aber gerade ist: inhaltlich etwa die „Räuberpistole“, mancher Krimi, die meiste banal-Science-Fiction. Vor allem aber vieles von Arno Schmidt, dem Dichter des Kleinbürgertums, das in ihm zu Selbstbewußtsein fand und, wenn es sich nicht gerade schnoddernd, meist auch mit groben Zoten verspottet, einen zweifelsfrei horrenden Bildungszuwachs feiert. Bei Schmidt täuschen Grammatik und Semantik; er konstruiert sie wie Masken. Schmidt ist der, soweit ich sehe, einzigartige Fall des „kleinen Mannes“, der die literarischen Produktionsmittel der Bourgeoisie tatsächlich expropriiert hat und so frech und frei wie virtuos über sie verfügt.. Aber zum Schluß bleiben immer nur „Kühe in Halbtrauer“ übrig, anal fixierte Strukturen eines besserwisserisch-wohligen (Geschichts-)Pessimismus. Man kann durchaus sagen, daß Schmidt das „Doppelleben“ Benns intellektuell-positivistisch in die nach Kohl riechende Bargfelder Wohnküche zerrt. Daß derart gemütliche Räume unterdessen ins Design mutiert sind, tut prinzipiell nichts zur Sache; in Belangen der Bequemlichkeit sind Menschen immer fortschrittlich. Aber eben nur darin.
19 siehe dazu: Alban Nikolai Herbst, → Das Flirren im Sprachraum; in: Schreibheft Nr. 56, Essen: Mai 2001
20 Dessen poetologisches Credo ganz anderes – eben: „denkt“.
21 Was hier keine Wertung sein kann. Denn ist der manipulativ schreibende Realist, etwa Konsalik, moralisch qualifizierter?
22 Ich meine nur seine Prosa.
23 Überhaupt sind Mischformen wirklicher; ich spreche hier über eine Dichtung, die natürlich Modell ist und sich „rein“ nur in Ausnahmeerscheinungen manifestiert, etwa in F.C. Delius’ meisten Arbeiten. Des erwähnten Peter Kurzecks Neigung zur unentwegten minutiösen, ja manischen Katalogisierung von Wahrnehmungen übersteigert den realistischen Ausdruck. Bei anderen – etwa bei Autoren vom Schlage Henscheids – kann der sich irgendwann selbst nicht glauben und purzelt oder schnurrt und schlägt sich zur Satire; wie ein Luftholen ist das, „Musik von anderen Planeten“ wird eingeholt und dann, zum Aufatmen auch der Leser, mit der Wohnküche weitergemacht.
24 Bezeichnend: Die Uraufführung fand 68 Jahre nach Niederschrift des Stücks statt, nämlich 54 Jahre nach Kleists Tod.
25 Etwa literarisch in James G. Ballards Roman „Crash“, der ästhetisch eigentlich erst in David Cronenbergs Verfilmung auf die Beine gestellt wurde, während Ballard selbst stur den Gesetzen des literarischen Realismus folgt.
26 Etwa Dieter Bohlen, der eigentlich ungenannt bleiben müßte: Aber Massen von Teenies entblößen für ihn ihre Brüste. Ins gleiche Feld gehört, daß Sigrid Löffler Rowlings „Harry Potter“ in den Rang der Weltliteratur erhebt und Michael Maar den sympathischen Jungen an die Seite Nabokovs stellt. Mit Löffler und Maar ist Thomas Steinfeld intellektuell völlig einig: Er spielt King gegen Pynchon aus. Kurt Scheel wiederum, als Herausgeber des MERKURs auch er der deutschen Denk-Elite zugehörig, bekannte sich neulich zu John Wayne.
27 „Subjektiven, Objektiven“….. * Herbst lacht *
28 Adorno drehte diese Dynamik ins Soziologische: Wer keine Fremdwörter möge, möge auch keine Ausländer. Die zugegebenermaßen arg zugespitzte Formulierung entspricht exakt dem Bedürfnis danach, sich in einer Gruppe zu identifizieren und in Literatur wiederzuerkennen.
29 Sie geht, mathematisch-wissenschaftlich, der Deduktion parallel: Wie diese vom Allgemeinen aufs Besondere schließt, weist die realistische Reduktion auf das Besondere, die Substanz, zurück. Daher das Gefühl von Sicherheit, das realistische Literatur ihren Lesern vermittelt.
30 „Überfließende“ oder „zu flüssige“? Sic!
31 Der Name von Pynchons Held „Herbert Stencil“ spielt darauf an, spielt also mit dem Realismus und dekonstruiert im Folgenden nahezu alle seiner „Sicherheiten“: Thomas Pynchon, V., Roman, Reinbek: 1976
32 Hier besteht die das Bündnis tragende Übereinkunft in der Vereinbarung, im folgenden würden alle sonst geltenden Regeln außer Kraft gesetzt, aber nur nach der Versicherung, es handele sich auch um einen Gruselroman. Die syntaktische Struktur bleibt völlig unangetastet: Sie ist das Geländer, an welchem man sich durchs Gruseln hangelt. Würde etwas „Artfremdes“ hineingenommen, sagen wir Sozialkritik, vermerkte der Leser das mit Unwillen und fühlte sich hintergangen, also wiederum das zugrundeliegende Bündnis als vom Autor gebrochen. Man kann geradezu sagen, daß der Gruselroman die Hypostase des realistischen Erzählens in Form seiner – immer dem Bündnis folgenden – Pervertierung ist. Die Lust des Lesers ist eine an der semantischen Regelverletzung, die natürlich bei regel-rechter Grammatik uneigentlich bleibt. Ästhetisch oder wirkungspsychologisch betrachtet ist das Ironie und tendiert – überaus deutlich im modernen Horrorfilm – zur Klamotte, die nun ganz besonders wenig gefährdend Grusel- und Schocklust garantiert. Eine Uneigentlichkeit, die Kobolz schießt. Im Gruselroman zelebriert der Realismus seinen Fasching: Ort, Zeit und Raum sind bestimmt, man behält immer den Fluchtpunkt, Aschermittwoch, im Blick.
33 Wissen Sie, wie der elektronische Einspritzmechanismus Ihres Autos funktioniert? Oder haben Sie bloß die Erfahrung gemacht, daß er’s tut, und glauben es also? Dieselbe Frage läßt sich mittlerweile bezüglich aller unserer gesellschaftlichen Lebenserhaltungssysteme stellen. Wir haben ein Vertrauen, dem eine stetig verdrängte – realistische! – Unsicherheit, ja Unheimlichkeit parallelgeht.
34 Gottfried Benn, Das letzte Ich, zitiert nach: G.B., Prosa und Autobiographie, In der Fassung der Erstdrucke, hrsg. von Bruno Hillebrandt, Frankfurt am Main: 1984
35 Genußreich ist das Lesen realistischer Literatur aber gerade darum: Wie jeder Positivismus ist die Bewegung strikt tautologisch. Es kann gar nichts Neues, also Fremdes und Gefährdendes geben. Man bleibt eingeschlossen, wird nicht geboren; der realistische Text ist Nabelschnur.
36 Eine der spannendsten, weil dekadent-perversesten Implikationen von „Spaßgesellschaft“ hat Aldous Huxley schon ziemlich früh in „Brave New World“ entworfen.
37 Insbesondere die deutschsprachige Literatur, imgrunde aber realistische Literatur insgesamt scheut gegenwärtig die Auseinandersetzung mit Physik, weil sie zu einer Auseinandersetzung mit Quantentheoremen würde, was jedes realistische Konzept vollständig ad absurdum führte. Zu Goethes Zeiten war das anders: Man konnte sich auf Physik noch „verlassen“. Sie garantierte einem prästablierte Harmonie, bzw. harmonia mundi. Die wurde in der Romantik durchlöchert, Mineralogie wurde psychisch, das Unbewußte erschien. Schon brach die Sprache. Dann brach die klassische Physik. Dann begann das poetische Experimentieren, dem ein naturwissenschaftliches korrespondierte, bis in die vom Weltkrieg auseinandergerissenen Wörter des Expressionismus. Das gesamte Menschenbild geriet in einen Tanz, der von den sogenannten einfachen Menschen, etwa von Hitler, als teuflisch empfunden wurde: Sehen Sie sich Otto Dix’ Bilder an! Diese Zehner und Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts waren vielleicht die „erwachsenste“ Periode, die Kunst je erlebt hat. Doch so viel Tiefe, so viel psychischer Stress ist, scheint es, nicht lange durchzuhalten, und selbst Benn, dem wie kaum einem die Zerschmetterung des autonomen Ichs bewußt war, rief nach Erlösung. Die das Abendland in Hitler fand: Man kann sagen, er habe es psychisch in den mechanischen Materialismus der klassischen Physik zurückbomben lassen und durch mieseste Affirmation ein jedes Mythologem ein- für allemal desavouiert. Tabula rasa. Der scheinbaren Unantastbarkeit des heutigen Kapitalismus wurde dadurch überhaupt erst der Boden bereitet. „Es gibt keine perfidere Art, einer Sache zu schaden, als sie absichtlich mit fehlerhaften Gründen zu verteidigen“, sagt Nietzsche. Es ist geradezu peinlich, daß die Nationalsozialisten das nicht einmal „absichtlich“ taten, sondern ihre Gründe offenbar glaubten. Man kann ihnen also nicht einmal zugestehen, daß sie perfide gewesen seien; nicht einmal diese Dimension haben sie.
38 Umberto Eco, in seinem „Foucault’schen Pendel“ (München: 1989), einem phantastischen Roman, hat die den Leser zutiefst unsicher machende Dynamik sehr klug zu umschiffen gewußt: Immer wieder streut er in die hochparanoide Erzählung Bemerkungen, es handele sich „nur“ um eine Geschichte. Ganz anders Kazuo Ishiguro in „Die Ungetrösteten“ (Reinbek: 1996). Er gesteht dem Leser solche Beruhigungen nicht zu. Ein Leser-, d.h. Erwartungsbetrug. Das Buch hat sich denn auch – an Ishiguros anderen Romanen gemessen – kaum verkauft. Gerade dieser Text aber, so meine ich, hat – zusammen mit Pynchons Arbeiten – das Zeug, aus dem realistischen Dilemma hinauszuführen. Ich werde auf ihn im dritten Teil dieser kleinen Poetologie zurückkommen.
39 Man muß durchaus nicht gläubig sein, um Bachs h-moll-Messe herrlich zu finden; umgekehrt auch nicht, um, wie Berlioz, ein wundervolles Requiem zu schreiben. Darin ist Kunst völlig unmoralisch; das gilt auch für ein realistisches Kunstwerk, obwohl Motor des Realismus eben Moral ist. Selbstverständlich bleibt auch in diesem Fall die intendierte Aufklärung restlos auf der Strecke. Politische Autoren haben das immer gewußt und sich auf den Kunstdiskurs gar nicht erst eingelassen, geschweige sich ihm überantwortet. Ich denke da etwa an Peter O. Chotjewitz oder auch Gerhard Zwerenz. Halten Sie sich dagegen, daß Celine ein ziemlich fieser Antisemit war. – Brecht hatte schon recht: „Ich bin nicht verläßlich.“
40 und verrät den physischen Leib, dessen eine jede Befriedigung aber bedarf.
41 jedenfalls: Ursula Krechel, Zweite Natur, Darmstadt und Neuwied 1981
42 Überhaupt ist Konsequenz als sowohl das Kennzeichen jeder großen Kunst wie der Wissenschaften immer „unmenschlich“.
43 Große Kunst ist übrigens meist genau das: unsozial. Vielleicht wird sie deshalb oft erst Jahre oder gar Jahrzehnte nach ihrer Entstehung kommensurabel, nämlich wenn eine Kultur das Abweichende, etwa aus Gründen der Gewöhnung, sich integriert hat. Selbstverständlich ist das widerständige Potential eines Kunstwerks dann abgeschliffen. Kein Mensch mehr wird heutzutage hysterisch, wenn er Ravels Bolero hört. Woraus man schließen kann, daß es auch wirkungsphysiologischen Fortschritt gibt und der Mensch sich eben nicht gleichbleibt.
44 Achtung! Ich spreche hier von der Zeit der Lektüre!
45 Deshalb ist es für Intellektuelle auch so schwer, einen Kitschroman glaubhaft zu synthetisieren. Man „hat“ den Stallgeruch oder nicht; sich bloß mit Mist einzuschmieren, genügt nicht.
46 Die Allegorie – der gegenwärtigen Literaturkritik, Walter Benjamins uneingedenk, ziemlich widerlich – ist eine Kunst- und Selbstverständnis-Form des Barocks, also feudal. Sie stellt ans Individuum die vernichtendsten aller Fragen; vielleicht konnte Kafka sie deshalb so sensationell künstlerisch aufleben lassen.
47 Insofern ist die bekannte Einlassung falsch, derzufolge der Roman die Kunstform des Bürgertums sei. Das ist nur für den realistischen Roman richtig. Bei Joyce bereits hört das auf. Indem aber das Bürgertum in seiner Variante der Konsumentengesellschaft eine Renaissance erfährt, muß einen die des realistischen Romanes nicht wundern. Von Musil über Jahnn über den Grass des „Butts“ bis hin zu Arno Schmidt sind die „progressiven“ Ästhetiken plötzlich wie niemals gewesen, und alle drehen sich freundlich um: Die alte Linke vergöttert die USA (schließlich kriegt man dort Dozenturen), und die jungen Experimentellen entdecken den Krimi. Alles pleti, Kreti.
48 Der Prozeß hat natürlich gute Gründe: Als Folge von Widerstand und der Notwendigkeit, historisches Grauen zu verarbeiten, bzw. sich Entfremdungsprozessen zu stellen, hat sich die abendländische Musik zunehmend intellektualisiert. Deshalb eignete sie sich nicht länger als Medium des jedem Menschen nötigen Rauschs. Intellektualisierung heißt auch: Vereinzelung. Die „klassische“ Musik hingegen, sofern sie sich – wie bei Wagner – als Katalysator für exzentrische Zustände eignet, war durch Hitler desavouiert. Imgrunde, seelisch, ist der größte Teil der heutigen abendländischen Intelligenz demzufolge als US-Amerikaner aufgewachsen.
49 Interessant dabei, daß es offenbar nicht auf den Text etwa eines „Songs“ ankommt; der kann sich noch so „progressiv-links“ gerieren: Ist die musikalische Struktur, über die ein Inhalt transportiert wird, regressiv, so wird auf Dauer das und eben nicht der „Inhalt“ wirken. Dasselbe gilt für Literatur, nur moderater, weil sie ihre Daumen nie derart unmittelbar in die Seele zu drücken vermag, sondern an Gemeintes gebunden bleibt. Sie kann sich auch da nicht von der Semantik lösen, wo sie es gerne möchte (siehe Teil II dieses Aufsatzes: „Das experimentelle Dilemma“).
50 Edgar Allan Poe, Das verräterische Herz
51 Denken Sie an die ungemein wirksamen raumlosen Räume im Internet, etwa beim Chatten. Es handelt sich um psychische Räume.
___________________
[Geschrieben im Januar 2003
Erschienen in → L. – Der Literaturbote Nr. 69, März 2003)
______________________
>>>> Poetologische Thesen 2

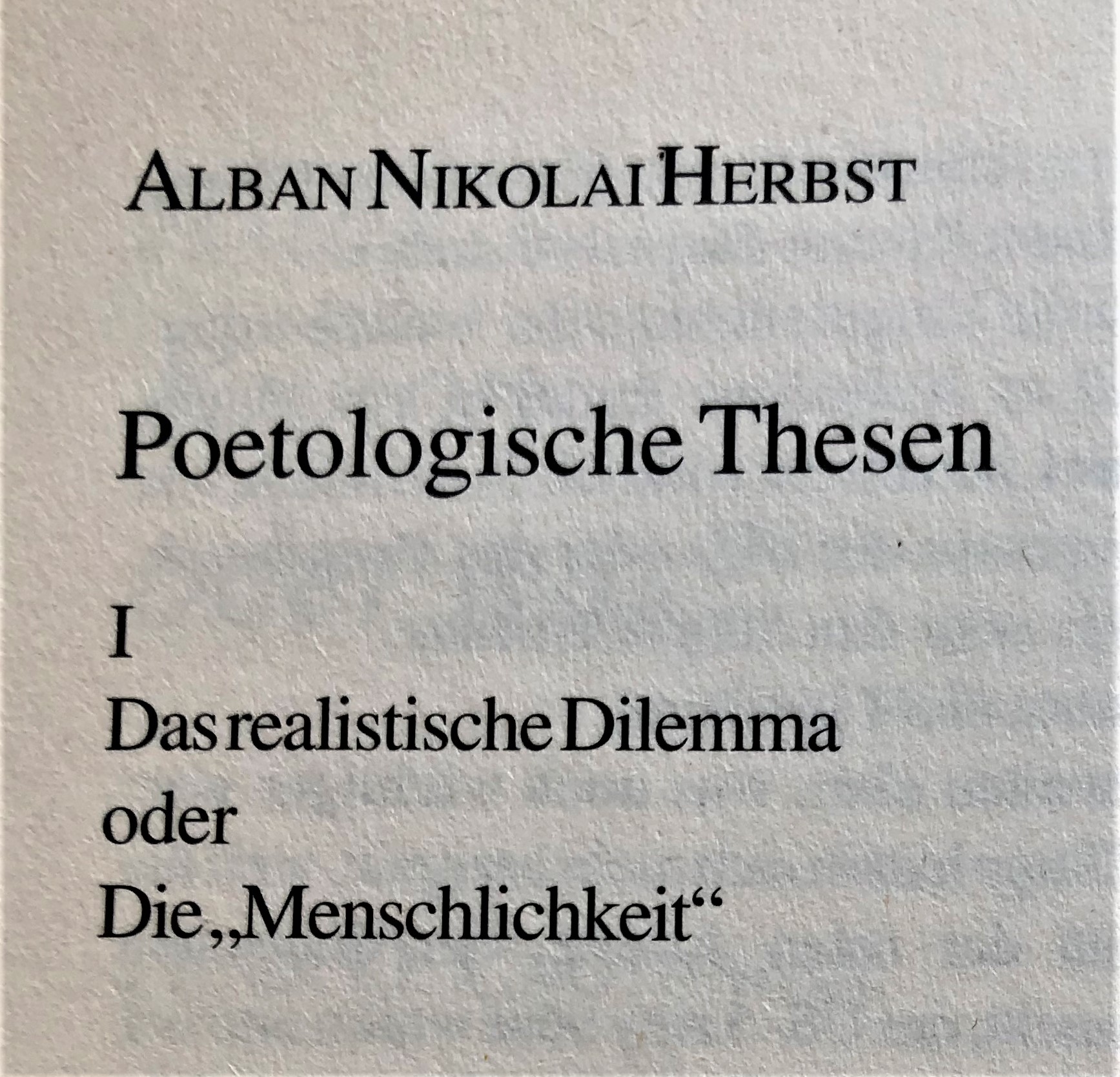
…Fußnote 11: …Borges…“Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn“…ja – so kann es durchaus formuliert werden – der Satz hat mich erreicht – wunderbar – ich freu mich – ansonsten bin ich zunächst (wieder einmal) unter dieser Buchstabenlawine begraben – jetzt aber wieder aufgetaucht – nachdem ich mir den Schweiß und die ungelesenen Buchstaben von der Stirn gewischt, die bange Frage, ob ich etwa auch? Ich meine nur? Regressiv veranlagte Leserin sei? – Nö.. einfach Nö…dazu verbrachte ich zuviel Zeit mit meiner eigenen (kritischen Innenschau –
Impuls 1: Identifikation – klar – als Echo des Gelesenen, reflektiert auf die eigene innerliche Befindlichkeit (Körper, Seele, Geist); geprägt (natürlich) von Erziehung, „Bildung“, zugelassenem Wissen also, ebenso (leider) einer Eigenzensur unterworfen –
Impuls 2: TABU – in der Phantasie ist alles erlaubt (Mord, Kriminelles, Erotik), es ist nicht nötig alles in die Öffentlichkeit zu bringen – man/ich darf mein „Geheimnis“ für mich behalten – es sei denn….- Führen wir nicht alle ein „DoppelLeben?
Impuls 3: …ich empfand mich noch nie als „fertig“, dazu sind meine Zweifel „am MenschSein“/an dieser Gesellschaftsform zu groß – sich infrage zu stellen finde ich“normal“ –
Impuls 3: …Ihr Aufsatz zeigt doch (in Ansätzen), wie unflexibel, fast „geistig verarmt“, gefühlsmäßig degradiert auf „Lebenserhaltung“ programmiert diese Gesellschaft scheint – gäbe es sonst übervolle Wartezimmer in Arztpraxen bzw. Psychotherapeuten? – Sprache ist immer „Manipulation“, in die eine oder andere Richtung – die ritualisierten gesellschaftlichen Straf-und Belohnungssysteme sind Beweis genug (Sie erwähnten es, ich weiß..) – diese rigiden Methoden/Entwicklungen, lassen die sich auflösen? Ich befürchte: NEIN – wobei mir gerade einfällt, dass viele Menschen mit einem „LOB“ gar nicht umgehen können, bedauerlicherweise – Kann ich hier wirklich von der Regression einer ganzen Gesellschaft sprechen? Derweil die Menschen so versklavt sind (arbeiten, essen, schlafen Urlaub) – Und wer bitteschön hat in diesem Drama Lust, seine eigene Geschichte aufzuarbeiten? In der Mittelmäßigkeit läßt es sich scheinbar erträglich leben – und wird der Drang zur Veränderung nicht aus dem „Leid“/Trauma“ gespeist?
Impuls 4: …gehe ich wirklich ein „Bündnis“ ein? Ist es nicht vielmehr eine „Verbindung)/Bindung (eine lockere) über das Geschriebene, was beim geneigten Leser (hier sind ALLE gemeint), was beim Leser einen inneren Widerhall (Erleben) auslöst, nicht unkritisch, vielmehr wird die Kritik nicht offen geäußert?
Impuls 5: …zuviel Regression in Ihrem Bericht – ich meine, was wissen Sie denn schon über IHRE Leser? Ich hoffe nicht, das sich ein Großteil davon in ständiger „Regression“/“regrediert“ befindet bzw. unterwegs ist – ach ja, ich liebe diesen Satz: „Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn“ – RIvS
Großartig, wie Sie reagieren und d a ß Sie reagieren! So verhallen Überlegungen nicht einfach in der Leere. Und was Ihre Eimnwände anbelangt, so warten Sie auf die nächsten beiden Teile des Essays, bitte. Sehr möglich, daß einiges – ich sage mal: beantwortet werden wird. Die poetologischen Thesen grenzen ja Zugänge gegeneinander ab, in denen sie ihre Kontur beschreiben – ein, denke ich, um der Klarheit willen notwendiges Verfahren, auch wenn die Übergänge selbstverständlich fließend und sich „realistische“, „experimentelle“, „intensive“ Dichtung nur selten in Reinform finden läßt, wenn überhaupt.
(Es ist geplant, aus den drei Teilen des Aufsatzes ein kleines Buch zu machen; sollte es dazu kommen, werden die Texte ganz sicher noch einmal be-und überarbeitet werden.)
Danke für Ihre Antwort – RIvS
Spät lesend, aber ach – umso froher.:)
Schade aber auch, dass so spät, weil eben – (jetzt kann ich nicht schreiben „ja, genau“ – dann wäre ich ja schon in die allzu wohnliche R-Schachtel getappt:/) – also, um mit Freuds Nichte zu schließen (oder öffnen:) , aus einem ihrer Kinderbücher: – Die Welt ist so uneben –
(Uneven meint im Englischen ein bisschen was anderes, konkreteres, als in der deutschen Übersetzung; aber die Zeile mag ich so noch lieber.;)
(Tomma Abt-Freud o.ä. der Name) .
Weiterlesend und grüssend mit Dank:))