 [Geschrieben für Faustkultur;
[Geschrieben für Faustkultur;
dort → erschienen am 13. Dezember 2022]
die welt sind meine sinne.
alles andere ist religion.
Peter Giacomuzzi
Ein Schuhschachtelfund, von dem lange nicht gewußt wurde, was anfangen mit ihm:
in der ein-zimmer-wohnung mit möbeln aus den 50er jahren. und das foto von dem soldaten auf dem fernseher. das war der toni. (…) und die schuhschachtel voll von briefen,
die aber doch ein Recht haben, ihre Intimität zu bewahren! Mit denen hebt es gleichwohl an, dieses ungewöhnliche Buch,
und es hat lange gedauert, so lange dieses ungute gefühl, in einem leben zu wühlen und dabei in linien (…) des menschseins hineinzustoßen.
Aber wir schreiben geschichte. wir schreiben geschichten. Die geschichten liegen überall offen und versteckt. die augen der kinder sind flink und wach und finden sie auch noch im traum. rette dich, es geht um dein leben! Sieh dich nicht um und bleib im ganzen umkreis nicht stehen. (…) so wiederholen wir uns selbst, schauen nicht zurück, glauben, nach vorn zu gehen und bleiben am selben punkt wie die maus im rad.(…) wir wissen alles im moment und vergessen es im selben augenblick wieder.
So ist, die Briefe zu verwenden, eine politische, vor allem aber poetische geradezu P f l i c h t, die Giacomuzzi auf sich nimmt, zwar bleibend mit einem etwas schlechten Gewissen, das sich in unversehenen fast Momenten der Wut ausdrückt:
und weil wir nicht weiterkommen, und weil wir es nicht erklären können, machen jene profit, die mit einfachen lösungen kommen. (…) weil nur glauben gefragt ist. blindes, taubes, lahmes und stummes vertrauen.
Weil mit dem guten Gewissen aber zugleich, dem nämlich besseren, uns, seinen Leserinnen und Lesern, die unheimliche Kontinuität unserer Verhältnisse zu historischen wie gegenwärtigen Geschehen deutlich zu machen, haben selbst Giacomuzzis bisweilige Ausfälligkeiten gegen die digitalisierte Welt und deren manipulative Bedrohungen durch ihre neuen Medien noch da ihr Recht, wo sie vielleicht ein bißchen tendenziös pauschal sind. Zumal das erschütternde an den nachgelassenen, zwischen 1938 und 1944 geschriebenen Liebesbriefen des Obergefreiten der Deutschen Wehrmacht, Anton Schöch, an seine über bis fast an sein höchstwahrscheinliches – er ging an der Front verloren – Ende immer noch nur „Freundin‟ und erst kurz vorm „Fallen‟ wirklich Gemahlin… – zumal an ihnen das eigentlich Erschütternde ist, wie sie uns vorführen, auf welche Weise Verdrängung selbst noch im härtesten Krieg unter Artilleriefeuer … ja, furchtbares Wort, „funktioniert‟. Denn von dem ist – an der Ostfront stehend – kaum etwas erzählt; die meisten dieser Briefe hätten auch in Friedenszeiten von jemandem geschrieben sein können, den irgendein sonstiges Geschick von der Geliebten getrennt hat, sagen wir den Ölbohringenieur auf einer fernen Ölbohrinsel. Erst als der Tod sich vielleicht doch erahnt, erfahren wir – erfährt die Frau – ein kleines bißchen was vom Krieg. Als wär der Nebensache, geht es vor allem um Kleinbürgereien, Eifersucht, spätre Wohnungssuche, Urlaube im Kuschelhütterl usw. Als wäre der ganze Nationalsozialismus nicht da, hätte es nicht die Pogrome gegen die jüdischen Mitbürger und ihre für jede und jeden sichtbare Verschleppung gegeben, als wäre alles dieses Normalität und es gehe darum allein, jeweils die eigene Familie von dieser für sie neuen Liebe zu überzeugen und also, daß geheiratet werden müsse.
„Liebes Weible‟, schreibt Toni, „Liebes Weibi‟, „Liebste Minimaus‟ – die Diminutive finden kein Ende (Hast Du Dein Öfele schon in Betrieb?) und zeigen verniedlichend schmerzhaft, und eben darin hart skandalös, ein Geschlechterverhältnis, vor dem uns lange nachher noch angst und bange wird.
Liebe kleine Mimi Maus und liebes kleines schwarzes Schatzi-Putzi, sei recht viel tausendmal gegrüßt und geküßt von Deinem, wegen dem Verlust Deiner Bilder, so traurigen Bibi.
Das alles wär recht unerträglich, vor allem, weil der Briefeschreiber Akademiker ist, „nur‟ Naturwissenschaftler zwar, aber doch gerade als solcher ein Mensch, der, ging’s mit rechten Dingen zu, imstande sein müßte, aus den Folgen Gründe zu erschließen. Ist er aber nicht.
Nun habe ich mein ganzes Denken und mein ganzes Herz verraten (…).
So daß sich von einem weltblind-verkitschten, quälend banalen Spezialistentum sprechen ließe, das sich permanent, so auch am 11.5.39, „mit der Hoffnung auf bessere Zeiten getröstet‟ fühlt. So auch die Schlager Komm mit mir ins Separee, Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht zu ändern ist. Genauso geht Verdrängung. Wir lesen dennoch weiter, und zwar mit Spannung. Was an Giacomuzzis dazwischengeschobenen und nicht nur durch eine andere Type, sondern vor allem vermittels der durchgehaltenen Kleinschreibung abgesetzten poetischen Kommentare liegt, die allem eine Struktur geben, die uns erkennen läßt, indem hier zwei gegenläufige Haltungen erhellen, welches Drama sich e i g e n t l i c h abspielt und einfach, einfach weitergeht:
und die erwachsenen freuten sich, wenn wir kinder ihre Lieder mitsingen konnten. so wurden wir zu teilnazikindern. obwohl der krieg schon lange vorbei war.
Oder zum Wartheland:
der exerzierplatz des mordens hatte einen namen. wir haben ihn weggelöscht.
Sowie um priesterlichen Mißbrauch:
und in rom die kardinal*innen tanzen im gruftischritt durch den dom. die knäbelein aber singen „wenn ich ein vöglein wär‟ und alle bekommen nasse augen, (…) so zart, so gefühlvoll, so himmlisch die ton und die leitern auf und ab.
Dieses stets in Giacomuzzis lyrischer, aber b e t e i l i g t e r Prosa, die auf die dunklen Briefe Schöchs, die so tun, als wärn sie hell, einen derart hellen Schatten wirft, daß es grell wird:
ich hab dein bild im krieg verloren. ich habe dich im krieg verloren. wir haben dann den krieg verloren.
So etwas macht Gänsehaut. Was Giacomuzzis, je weiter das Buch voranschreitet, fast zynisch werdende Kommentare –
so brave soldaten. und damit sie beim töten nicht gleich ganz kaputt sind und schon vor der schießerei zur mama laufen, gibt’s auch heute noch hochkarätiges, oder auch pillen und andere pülverchen (…) den Schnee durch die nase ziehen, bis die ohren zu segeln beginnen –
… – was sie also erzähldramaturgisch mehr als nur rechtfertigt, sind die außerdem dokumentarischen Einschübe aus Ortserklärungen, Zitaten usw., die meist grau unterlegt sind und als Kästchen den gesamten Romantext quasi erden:
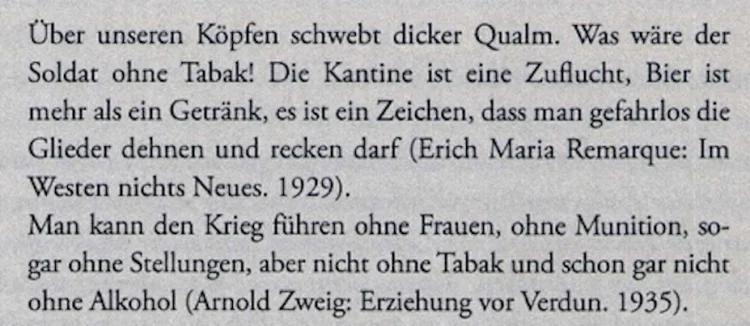
Zugleich erzählt dieses Buch – es ist dessen in Giacomuzzis eigener Biografie verankerte ideengeschichtliche Basis, – auch die Geschichte, eine Teilgeschichte, Südtirols –
die dolomiten (…) sind der in fels gehauene ethnische konflikt –,
die einer vor Verlorenheit dauererzitternden, eigentlich nichtnationalen Identität – vielmehr ist es die alleine einer Landschaft –, die sich in die Brust werfen muß, um sich vermeintlich zu halten, weiße Mulatten einer mit Scheinstolz apart gehaltenen Zweiundeinachtelsprachigkeit:
vielleicht war ich immer dort zuhause, wo ich im moment nicht sein konnte. die heimat ist der zufluchtsort der sehnsüchte,
und zwar entsetzlicherweise bis in die internalisierte Beschwörung von Klischées:
die schweiz ist eine frau und hortet das geld alles bösen auf der welt im schoko-toblerone-fels des matterhorns.
In den Enddreißigern, beginnenden Vierzigerjahren des leider eben nicht vergangenen Jahrhunderts mußte sie sich, diese fragile Identität, an die asthenische Trichterbrust „des Führers‟ werfen, der indes bei Toni nur quasi-touristisch auftaucht, nämlich am 19. März 1940:
Gestern sah ich den Führer, als er vom Brenner zurückgefahren ist. Es ist dies nun das zweite Mal im Leben, daß ich ihn gesehen habe; dabei bin ich naß bis auf die Haut geworden, aber sehen habe ich ihn müssen,
den kleinen bellenden GröFaZ. Und Toni bleibt affirmativ, bis in den Schützengraben imgrunde nicht mal regrediert, sondern ein beim Lallen schon stehengebliebenes Kind, dem der „Landesvater‟ selbst dann ein Gott, wenn er ein Völkermörder ist.
Kurz, ein unreifer Mensch, in dessen Briefen die später reihenweise fallenden Kameraden kaum mal im Nebensatz vorkommen. Das Unglück ist ein Regen, der halt hinzunehmen ist; lächerlich, wer gegen Natur revoltiert. Im Krieg wird gestorben und verstümmelt, im Regen wird man naß.
Gelt, mein liebstes Weibi, das wäre halt schön, da hätten wir es schön, freue mich im Grunde schon darauf,
lauten die letzten Zeilen, die Anton Schöch geschrieben,
aber zu früh darf man sich halt heutzutage doch nie freuen, denn es kann sich plötzlich wieder etwas ändern.
Zum Beispiel abermals stürmen und Sturzfluten regnen.
Du, mein liebstes Weibi, fest den Daumen haltest wird es schon gehen, denn bis dahin habe ich auch schon drei Jahre Dienstzeit voll.
Hingeschrieben in der Ukraine, damals noch Sowjetunion, nahe Nowosserhijiwka, bevor er von der Truppe abkam und verscholl. Derart auch aktuell ist dieses gespenstische Buch.
Recht viele tausende heiße und innige Bussi von Deinem Toni
– wobei Giacomuzzi die letzten vierzehn Brief nicht mehr kommentiert, was dem Ende des Buchs den Charakter einer Stretta verleiht, der sich zu entziehen fast nicht mehr geht. Wir nämlich spüren tatsächlich schon den Tod; Toni – darin liegt die tragödische Dramatik – tat es nicht.
Angehängt ist nur noch ein Brief, der einzige, der bisherigen Empfängerin, vielleicht, weil nur er von ihr erhalten ist. Zu unserem Schaudern beschließt ihn Mimi so:
Hermann hat einrücken müssen. Viele 1000 Bussi und Grüße von Deinem
Frauchen† † †
Peter Giacomuzzi
Briefe an Mimi 1938-1944
252 S., geb.
ISBN-13: 9783950528305
Edition BAES, Zirl (Österreich) 2022
→ Bestellen
†


