[Arbeitswohnung, 8.20 Uhr]
Er ist so wunderbar aufgegangen, daß ich den Backofen bereits jetzt vorheizen lasse. Leider habe ich noch immer keine Pannetone-Backform, habe also noch einmal die Form für den Guglhupf genommen, Stilbruch. Doch gestern war Karfreitag, ich hätte da keinen Terracotta-Blumentopf kaufen können, der sich geeignet hätte.
Keinen Handschlag getan, nichts geschrieben seit Tagen; meine Barenboim-Mahler-Kritik liegt begonnen, doch wie aufgegeben herum. Vielleicht schaffe ich es heute, in dieser anderen Stimmung; weil ich direkt für das Konzert zu spät bin, müßte ich freilich einen anderen Ansatz finden als den bislang gewählten, prinzipiell werden: „Barenboims Mahler“. Oder ähnlich.
Immer wieder besorgte Briefe, bzw. Nachrichten von Freunden. Gestern sagte ich der Löwin noch, daß ich möglicherweise nie wieder schreiben würde, „was ich zu sagen hatte, h a b e ich gesagt“, doch heute früh dachte ich fast als erstes an die Gedichte. Da ist vielleicht noch, für mich, Neuland. Vier Zeilen, die seit Wochen liegenblieben:
und hängen lose an den Zeiten
irdischer Vergangenheiten
Generationen auch
Den Panettone bin ich angegangen, weil ich mir nach Weihnachten vorgenommen hatte, ihn zu Ostern für meine QuasiFamilie zu backen. Doch nun ist sie gar nicht da, ist fort aus Berlin zur Omi verreist, und ich bin über diese Tage allein. Na gut, nicht ganz: Amélie hat den Mops bei mir einquartiert, bis übermorgen. So bin ich zumindest gezwungen, von Zeit zu Zeit nach draußen zu gehen. Und es war das erste Anzeichen wieder von Trotz, daß ich dachte: Was soll‘s?, ich backe ihn, den Panettone, dennoch!
Erde.
Ich werde mir zweiarmevoll Tulpen besorgen.
Farben.
„Fremdsein dürfen in der Fremde“, schreibt mir aus Umbrien der Freund. „Schade, daß ich Dir hier keinen längeren Aufenthalt anbieten kann, hätte ich ein Zimmer mehr… (…), denn eine Aus-Zeit (…) wäre vielleicht tatsächlich das Beste. Fremdsein dürfen in der Fremde“, zumindest in der, vergleichsweisen, Ferne. Es ist ein ungutes Gefühl, im eigenen Land im Exil zu sein, in der eigenen Kultur, von der man dann spürt, daß es gar keine ‚eigene‘ ist. Die Verschiedenheit der Leidenschaften und Werte wird in der Nähe erst fühlbar: nicht ‚dazu‘zugehören; im Ausland hätte ich gar nicht den Anspruch, weil nicht einmal das Begehren, integriert zu sein. Wie auf seiner Insel mein Vater El Lobo war, bis zu seinem Tod.
Es liegt vielleicht am Respekt, den man als Fremder als Fremder hat, vorausgesetzt, man ist nicht als ‚Flüchtling‘ gekommen, der Hilfe in Anspruch nehmen muß, sondern der Distanz wahren kann und will, also keine Forderung ans fremde Gemeinwesen stellt.
Eine Rätselhaftigkeit umgibt diesen Fremden, etwas, bei aller Freundlichkeit, Unnahbares, aus dem der Respekt eben herrührt. Eine gewählte Einsamkeit. Sie setzt aber gewisse finanzielle Mittel voraus, ‚gewiß‘ im Doppelsinn.
Auch der Wiener Freund bot mir Unterkunft an; doch bei ihm bliebe ich meiner Sprache zu nahe; die nötige Distanz ließe sich so nicht herstellen. Man muß0 vielmehr in ein Café gehen und dürfte dort nur einen Bruchteil dessen verstehen, was um einen herum gesprochen wird.
Sich als Fremder wohlfühlen: Das ist mir bislang nur in Bombay/Mumbai gelungen und auf Sizilien, in Neapel vor allem sowie in Rom, sogar in New York City, dort nicht in Manhatten, wohl aber in Jackson Heights, Queens (während ich mich in Black Harlem als Fremder unwohl fühlte: ich mochte dort die weißen Besucher nicht, war aber selbst so einer und wurde so ebenfalls nicht gemocht, nachvollziehbarerweise).
Vielleicht aber gehört das Fremdheitsgefühl zu einer bestimmten Form von Kunst dazu. Nein, ihr Gegenredner, ich romantisiere keineswegs.
ANH
(Es ist jedesmal erstaunlich, wie sehr es bei mir nach italienischer Bäckerei zu duften beginnt, wenn ich mit eigenem Livieto madre statt mit Industriehefe „arbeite“; ganz besonders aber bei süßen Backwaren – nicht nur erstaunlich ist es, nein, b e t ö r e n d!)
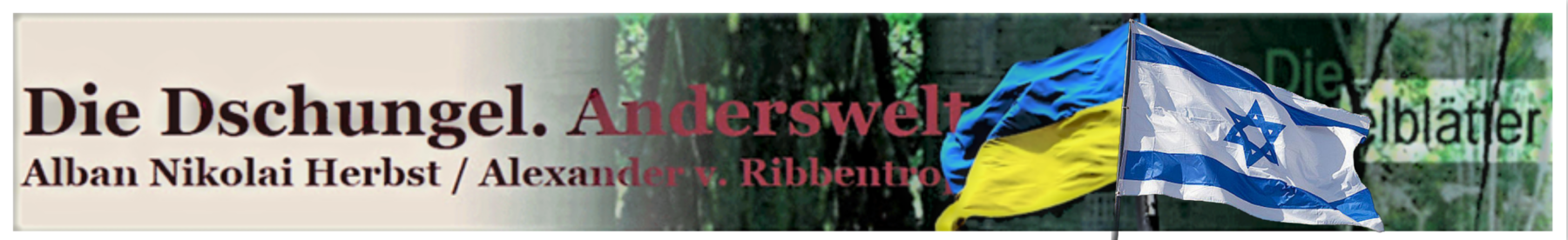

der sieht aber gut aus….!
Eine @Gaga Spur zu safranlastig ist er geworden. Safran gehört eigentlich gar nicht hinein, aber ich wollt‘ es ausprobieren, und in der Tat – er paßt vorzüglich. Nur habe ich eine kippende Handbewegung zuviel gemacht, ich hätte besser die Fädchen mit den Fingerspitzen aufgenommen und dann einstreuen müssen. Mit Butter und Salz schmeckt der Panettone aber auch so großartig.
(Eigentlich gehören zumindest Rosinen, aber auch Orangeat und Zitronat in ihn hinein; beides mag ich aber nicht, jedenfalls nicht in der industriellen Herstellung. Tatsächlich war der originale Teig von angegorenen Früchten, bzw. Fruchtstücken durchsetzt, was nach der europäischen Nahrungsmittelverordnung, die bekanntlich auch den Rohmilchkäse verbieten will, mittlerweile ebenso untersagt ist wie daß der Panettone – >>>> „Pane di Toni“ – nicht ganz durchgebacken sein darf. Den nächsten werde ich aber genau so ausprobieren.)
Ich protestiere! Das Bild mit dem herausgeschnittenen herrlichen Kuchenstück zu zeigen ist ganz gemeine Körperverletzung! Sieht verdammt gut aus. 🙂
Bon appétit…