
[Arbeitswohnung, 7.04 Uhr
Janáček, Auf verwachsenem Pfad]
Die Weidenzweige treiben aus, die Kätzchen stehn schon seit Grün-:ecco!-donnerstag, auch wenn uns Bruno Lampes Empfehlung anderswohin führt (oder war es ein leicht genervter Ratschlag, um nicht auch das noch verlinken zu müssen?), nur die Blütenknospen der Kirschzweige tun sich etwas schwer. Doch ganz unkarasch war gestern deutlich Frühlingstag. Nein, es gab keinen Grund zur Klage, zumal hier niemand klingelte, der durch die Gegend gefahren werden wollte und es wurde. Allerdings wird auch mir der Brennstoff knapp, freilich Holz nicht, sondern Kohle.
Jedenfalls, Mme LaPutz kam, was mich vertrieb, aber, insoweit bewußter Teil meiner Planung, endlich den Waschsalon aufsuchen ließ, sechs! Maschinen, Freundin, waren es diesmal. Während ihre Trommeln drehten, nahm ich von nebenan ein süßes Stückchen beinah schon Italien, von dem ich in der Sonne biß und in der Sonne kaute.
Wieder drinnen ward mir dieses Bild: 
So daß ich Gogolins Regenfotografen leicht mit andren Augen las. Meine Schwierigkeiten mit diesem Roman hatten eher noch zugenommen, vieles kam mir äußerlich – distanziert referiert – vor, ich meine das sprachlich: Immer schiebt sich ein nicht-immanentes Auge zwischen mich als den Leser und die erzählten Personen und Geschehen, eine spürbare Absicht, die ich zwar verstehe, was aber auch nicht schwer ist und deshalb sehr schnell nervt; es geht um die mir allzu spürbare moralische Haltung, der eine erzählperspektivische entspricht.
Um, was ich meine, an einer kleinen Stelle zu verdeutlichen: Der offenbar leprakranke Obdachlose Plácido – eine der wichtigsten Romanfiguren, für die Gogolin eine naive, aber eben auch auktoriale Sprache wählt – begibt sich nachts auf den Friedhof, um einem seiner Götter zu opfern:
In der Dunkelheit warten die Toten zwischen den aufgebrochenen Gräbern, und wenn er ihnen keine Gaben bringt, dann nehmen sie es übel. Er will nicht, daß die Eguns ihn verfolgen. Er hat kein Geld für Kerzen, aber Ogum wird wütend, wenn er sie ihm nicht bringt.
S.109
Dort beobachtet er eine junge Frau, die den Göttern ebenfalls ein Opfer bereitet. Es ist die (bislang) zweitwichtigste Person des Romans, wenn von den Protagonisten Hendrik Cramer – zu diesem „Greenhorn“ nachher – und seinem Stadtführer Wim einmal abgesehen wird.
Plácido muss suchen, wohin er seine eigenen Kerzen stellen kann. Er entzündet das erste Bündel für Exú (…).
Und jetzt kommt, was ich meine:
Und dann sieht er, was die weiße Frau getan hat.
Dieses „Und dann sieht er“ ist instrumentell und distanziert nicht nur über die (sich notwendig aus der Situation ergebende) Distanz Plácibos, sondern diese wird über den sich stets, der auktorialen Konstruktion halber, vordrängenden, quasi sozialdemokratisch agierenden Erzähler verstärkt. Dadurch kann die Sprache dem Menschen Plácido nicht nahekommen, und er bleibt Behauptung. Ich bin nie wirklich bei ihm, sondern bin stets bei seinem Autor, der bei ihm ist oder dies zu sein versucht.
Ich kann meinen Einwand auch antimoralisch formulieren: Wer in eine Figur wirklich hineinwill, braucht den Größenwahn, sie auch zu sein. „Und dann sieht er“ ist ein Referatsatz, der erklärt, anstelle zu zeigen. Dazu addieren sich Ungenauigkeiten, bzw. Redundanzen, zum Beispiel auf der Seite vorher:
Und die hinten gebündelten braunen Haare fallen ihr auf den Rücken.
Abgesehen davon, daß ein guter Stil „ihr hinten gebündeltes braunes Haar“ verlangt – weil im Deutschen „Haare“ alle Haare sind (weiß aber keiner mehr) -, ist nach einem solchen Satz zu fragen: Wohin denn sonst? Diese Redundanz höbe sich freilich aufs leichteste durch ein kurz eingeschobenes „bis“ auf: „bis auf den Rücken“. Dann handelte es sich um eine solche nicht mehr, sondern es würde zugleich präzise erzählt, daß das Haar lang ist.
Sie können, liebe Freundin, meinen Einwand eine Pedanterie nennen, Dukatenscheißerei, wenn Sie wollen; kommen solche Ungenauigkeiten aber oft vor, stören sie mich immens. Schon auf der folgenden Seite wieder:
Er entschloß sich spontan, erst mal die Stadt etwas zu erkunden.
Wieso „erst mal“? Etwas erkundet hatte er sie vorher schon und wegen seiner Greenhornigkeit auch Rüffel eingesteckt. W e n n also, dann bitte „etwas weiter zu erkunden“, schon würde es stimmen. Aber auch diese selbst, Cramers Greenhornigkeit, wackelt. Auf S.117 heißt es – für jeden, der schon mal in der Dritten Welt war, geradezu bizarr:
Dann trank er ein Glas Wasser, da in der Karaffe zumindest noch Eisstücke schwammen, was ihm das Wasser etwas weniger verdächtig machte.
Okay, denk ich, ein Idiot. Nur daß fünfzig Seiten später erzählt wird:
Wim zeigte ihm (…) einen Stand, an dem es das angeblich beste Eis der Stadt gab. Hendrik heuchelte eine gewisse Anerkennung, machte
„machte“!
aber keine Anstalten, sich ein Eis zu kaufen. Er misstraute selbstgemachten, offenen Lebensmitteln in warmen Ländern zutiefst.
Wie nun? – Und was sind „offene“ Lebensmittel? Ja, klar, wissen „tun“ wir, was gemeint ist, aber es wird schludrig ausgedrückt. – Die Greenhornigkeit wackelt aber noch aus anderem, einem für den Roman geradezu konstitutiven Grund. Cramer ist nämlich für die Vorbereitungen eines Filmdrehs in Belém, er leitet sogar die Agentur. Dennoch weiß er nicht, daß die Stadt nicht am Amazonas, sondern von diesem rund 350 km südöstlich liegt, nämlich am Golf von Marajá, der aus den Wassern zweier Ströme und einer Meeresbucht gebildet ist, so daß selbst, wenn im Roman von „dem Fluß“ gesprochen wird, deutliche Zweifel aufkommen müssen. Übrigens deutet darauf schon der komplette Stadtname selbst hin, Gogolin geht darauf später auch ein: Belém do Para – und zwar an einer Stelle, an der dieses Buch plötzlich wirklich zu laufen beginnt, mit Szenen, die es wert für mich machen, bis hierhin durchgehalten zu haben. Dazu gleich mehr. – Nur, weshalb sprechen auch die Einheimischen von „Fluß“, wenn doch die riesige Bucht gemeint ist, ein G o l f geradezu? Nein, in ihren Innengesprächen sagen auch sie tatsächlich „Fluß“:
Jetzt ist sie wieder unten am Fluss. Immer wieder kehrt sie zum Fluss zurück. Manchmal ist ihr, als sei (- wäre -) die Stadt ein abschüssiges Gelände, eine Rutschbahn. Als sei (- wäre -) die Stadt etwas, in das man sich nur mühsam unter Anstrengungen hineinbegeben kann.
S.129
Wieso, verdammt nochmal, „Fluß“? Wer also spricht hier? Estelle? Nein, immer, immer der sich vordrängende Erzähler.
Doch mein Hauptproblem mit dem „Greenhorn“ besteht in dem Umstand, daß selbst ein sehr einfacher Mensch, der sich auf solch eine Reise begibt, vorher zumindest mal im Netz nachsieht, wenn er nicht sogar auf die Landkarte guckt. Weshalb tat Cramer das nicht? (Doch, er tat’s. So wird ein paar Seites später nämlich erzählt.) Und sowieso, als Leiter einer Agentur hätte er zumindest solch ein Nachsehen delegiert und das Ergebnis auf den Tisch bekommen. Da weiß er wirklich nicht, daß der Amazonas bei Belém nicht fließt? – Dieser ein paar Seiten später freilich aufgeklärte Irrtum ist als solcher einfach nicht glaubhaft – zumal unter anderem an den Docks gedreht werden soll – und überdies , das macht die „Sache“ ärgerlich, für den Roman auch gar nicht nötig.
Ich fürchte, es steckt etwas Intentiöses dahinter, etwas, das ich oben „sozialdemokratisch“ nannte. Gogolin will auf Seiten der Obdachlosen stehen und denunziert den satten Westler als einen Ignoranten, der Hendrik Cramer aber gar nicht ist, schon berufs- und positionshalber sein auch nicht kann, sondern hilflos ist er und ungelenk, Doch bemüht sich um eine Art von Gerechtigkeit und will, darin ist er Greenhorn, den Armen etwas Gutes tun, ohne zu begreifen, daß die kleinen Bakschischs ihn in deren Augen erst recht zum leichten Opfer machen.
Dann wird er aber doch Person – interessanterweise, als er selbst unmoralisch, nämlich zynisch wird. Auf Seite 180 steht
Die armen Leute, dachte er, verderben einem den Appetit.
Der Satz kennzeichnet die Wende des Romans von einem gutgemeinten Referat in ein tatsächliches Romangeschehen wie kaum ein anderer bisher. Allerdings begann sie bereits achtzig Seiten vorher, wenn auch für mich da noch unmerklich. Sie begann und beginnt mit dem, was dem Roman seinen Titel gibt: mit dem Regen nämlich.
Und als er dann mit ihr verhandelte und ihren Duft einatmete, da roch sie süß wie frisch geschnittenes Zuckerrohr. Sie war so schwarz wie die glatten Beeren der Açai-Palme, und ihm war, als tauchten seine Augen in eine Dunkelheit, die im Licht der Straßenlaterne einen blauen Schimmer bekam, wenn er sie ansah. Gleich einer frischen Frucht schmeckte im Regen ihre Haut.
S.99
Wobei sich das letzte „sie“ leider auf Dunkelheit bezieht statt auf die Frau, zwischen der und Wim van de Schelde obendrein noch die Palme und eine Straßenlampe stehen.
Doch von hier an folgen zunehmend dichtere Abschnitte, die auch formal wirklich komponiert sind – etwa das Kapitel „Deine Tochter ist ein Fisch“ der Seiten 156 bis 158 – und über manch weiteren stilistischen Schnitzer einfach hinweglesen lassen („Dafür hätte man zwar sein Password kennen müssen, aber er war sich jetzt nicht mehr sicher, ob das so unüberwindlich war“: Was das? Daß sein Kennwort zu kennen, unüberwindlich ist? Nicht, es herauszubekommen, also zu knacken?):
Hendrik war von den niederstürzenden Wasserwänden, in denen sich immer wieder breite Spalte auftaten, als sei (- wäre -) das Wasser von einem Beil durchschnitten worden
na gut, „schneiden“ Beile?,
derart fasziniert, dass er zu fotografieren begann. Er fing den Vorhang des Regens ein, dazu das Licht der Lampen, das sich auf den im Wind bogenförmig zur Seite neigenden Wasserfahnen brach, die streifig weiße Gischt zwischen armbreiten Wassersträngen, die wie poliertes schwarzes Glas zu Boden rauschten, um dort vor seinen Füßen zu zerbrechen
S.168
– ein kristallnes Zerklirren, das zwanzig Seiten vorher und Tausende Kilometer weg von Belém, nämlich in Hamburg, kurz schon ertönte:
Die Frühlingssonne zerbrach das Wasser der Alster in gleißende Splitter aus Licht.
Jetzt, in Belém, wird Cramer tatsächlich von einer Figur zu einem Menschen, und Wim, sein abgebrannter Vergilius, erklärt ihm, warum:
Weil sie dich nicht wieder vergessen werden. Weil du jetzt für sie der Mann bist, der den Regen fotografierte. Weil du der Mann bist, der die Seele der Stadt fotografiert hat. So einen hatten wir hier noch nicht.
S.169
Da wird das Buch plötzlich groß. Ich will gar nicht von der wirklich irren Szene mit dem Spinnenmann sprechen, der auf dem Rücken läuft, sondern beim Regen noch bleiben (Belém do Para ist eben auch Bethlehem im Wasser, und darum ist Estelles verschwundene Tochter ein Fisch) – bei dem und Cramers Fotografieren.
Plácido erkennt den Künstler in ihm, den fortan zu beschützen sein Ogum ihm aufgetragen hat. Das ist nun wirklich Poetik, daß der Schwache – einer der Schwächsten – den scheinbar Starken beschützt; es wird von Gogolin auch nicht erklärt, sondern schlichtweg aus dem Aberglauben dieses Parias entfaltet. Und das Wunder geschieht, das ein intentiös als Ignorant geschilderter Mann plötzlich zu sich findet – ohne es übrigens selbst zu merken, sondern Plácido merkt es und bekommt nun endlich, genau deshalb, seine Sprache:
Er hat gesehen, dass der zweite Gringo ein Künstler ist. Er ist ihm gefolgt und hat ihn sofort an seinen Bewegungen erkannt. Als der zweite Gringo vor der (dem?) Banco do Brasil zu fotografieren begann, dort wo all die Bettler sitzen, da war es, als ereigne(te) sich vor Plácidos Augen eine Verwandlung. Eben noch ging der Gringo mit dem Schritt eines schwerfälligen alten Mannes, der sich auf seinen Füßen nicht ganz sicher ist. Und dann beginnt er zu fotografieren, dass Plácido glaubt, einem Baletttänzer zuzuschauen. (…) Es ist, als wenn er von Oxossi geritten wird, sobald er die Kamera hebt und zu fotografieren beginnt.
S.150
Hier stimmt jetzt sogar die konstruierte Naivetät der Sprache Plácidos, eine nicht mehr nur behauptete wie die Naivetät Hendrik Cramers, und zwar deshalb, weil in diesen geschilderten Momenten die Stadt Besitz von diesem nimmt, um ihn zu sich selbst zu bringen. Und Plácido, auf Cramers Fotos, wird eines Tages
etwas sehen, was ich noch nicht kenne, etwas, das mir nur der Gringo zeigen kann. Ich weiß nicht, was es ist, denkt Placido, aber es ist bestimmt da.
S.153
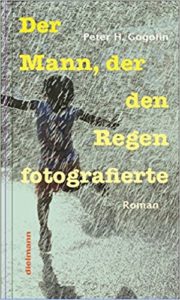
Ich bin nun, Freundin, auf Seite 194 und will jetzt, ja m u ß weiterlesen! Doch andere Arbeit, auch, steht an.
Ihr ANH

Es macht immer Spaß Autoren umzuschreiben:
S.99:
Er verhandelte mit ihr, sie duftete süß wie eben geschnittenes Zuckerrohr. Und sie war schwarz wie die glatten Beeren der Acai-Palme. Und seine Augen tauchten in ihre Schwärze, die im Licht der Straßenlaterne in Blaue zu schimmern begann. Nach frischer Frucht schmeckte ihre Haut im Regen.
Oje, das zweite „Und“ muss weg !
Und überhaupt gefällt es mir jetzt so besser:
„Seine Augen tauchten in ihre Schwärze, im Licht der Straßenlaterne begann sie ins Blaue zu schimmern.“
„sie“ ist hier freilich doppeldeutig, macht aber nix. …
Sind Texte jemals fertig ?
Meine Antwort: Nur wenn sie Meisterwerke sind.
er grub sie an, während sie nach lecker rum roch sowie sie schwarz war, sowie er in diese schwärze sich begab, welche im licht ihrer strassenlaterne sternhagelvoll zu schimmeln begann, weisslich, sehr weisslich, zu weiss.
frühe frische früchte, das nasse regen ihrer häute, ein wenig süsslicher geschmack.
@blogtourie:
Die Qualität aller interessanten Texte zeigt sich daran, daß sie sich persiflieren lassen. Da hat der Veralberer es leicht – und souverän lassen wir ihm das Gefühl, einen Sieg eingefahren zu haben. Denn letzten Endes ist er sein – Verlust.
ja klar wie weise , sieg ist verlust.
fühlbar nicht.
purer materialismus.
ich mach mit hierarchisch organisierten entitäten keine ernsthaften deals.
kleindeals zur tarnung.
mann muss nicht schreiben.
mann muss tun was frau gut findet
konnen kommt from cän
alles ich sags nicht über eien LAMM geschoren
alban, mein name ist eldermann, lobster
i am not really ()
free
Man weiß gar nicht, was das alles soll.
Sei/wäre – Haare/Haar und immer so weiter.
Wenn man etwas über dieses Buch wissen will, dann wird man es wohl selbst lesen müssen. Herbst vermittelt es nicht. Er benutzt das Buch wohl nur, um seinem eigenen Bildungsnarzissmus zu schmeicheln.
Ein Korinthenkacker, der sich selbst so nennt. Ist ihm da ein Verdacht gekommen?
@Vollrath:
Nö. Ich wollte ihn solchen wie Ihnen aus dem Mund nehmen. Aber manche Leute käuen halt gern wider, nachdem sie etwas erstmal geschluckt, dann drei Tage im Kropfe belassen und endlich wieder hochgewürgt haben.
Ihren „Schluß“ allerdings mag ich gerne unterstreichen: Etwas selbst zu lesen, ist in jedem Fall gut, auch wenn es, wie in dem Ihren zu fürchten, helfen wenig wird. Auch Liebe zur Ungenauigkeit kann sicher nichts dran ändern.
P.S.: Bildungsnarzissmus ist ein klasse Begriff und folgt, freilich noch mehr verspätet, dem „Sprachfaschisten“ auf ganz demselben Fuß.