[France musique contemporaine:
Isabelle Fraisse, Quatuor á corde No 3 (Da dämmert eine stille Freude in mir)]
Mein Ifönchen blinkte auf: In einer Stunde Lesung (so hatte ich’s notiert: Ditzler Veteranenstraße 21), eine halbe Stunde Spaziergang von hier. Ich war eh noch nicht an der Luft gewesen. – Was mich eigentlich gereizt hatte, die Veranstaltung in meinen Terminkalender einzutragen, weiß ich nicht mehr genau, aber glaube, es hatte etwas mit dem → Ton der Ankündigung zu tun. Auch interessierte mich, was „aggressive und abgründige Weiblichkeit“ sei, und auch der proklamierten „Dreistigkeit“ mochte ich mich von Herzen gerne ausliefern. Außerdem war ich noch nie in der Lettrétage gewesen, kannte nur Gemunkel über Namen, etwa Tom Bresemanns. Und das „Ankerinstitut für die freie Literaturszene Berlins“ hatte neues Quartier in einem Gebäudekomplex bezogen, den ich aus den Achtzigern gut kannte, als auf dem Prenzlauer Berg und in Mitte alles noch ein Abenteuer war — und was für eines d o r t! Ich erinnere mich, im ACUD sogar ein- oder zweimal selbst gelesen zu haben. Kurz, ich liebte diesen Ort, wie ich nach wie vor das AUSLAND liebe, den – also jenen – ich mit zunehmender Gentrifizierung aber auch deshalb nach und nach vergaß, weil meine damaligen Ansprechpartner sich mehr und mehr im Literaturhaus Fasanenstraße, im LCB und im heutigen Haus für Poesie fanden, das seinerzeit noch Literaturwerkstatt hieß und in einer Villa am Pankower Majakowskiring untergebracht war, dem ehemaligen Clubhaus des DDR-Schriftstellerverbands. Einerseits stand mein Stern, nach der FAZ-Eloge auf den Wolpertinger, relativ hoch, sank mit Thetis schnell aber wieder, um nicht zu sagen, er stürzte kurzerhand ab, zumal ich nicht mit den Kratzfüßen scharrte, wo so etwas erwartet wurde; Göttin, ich hatte sowas doch auch nicht! Andererseits zahlten die genannten „bürgerlichen“ Häuser für Auftritt Honorare — was nicht hieß, ich hätte nicht hier und da trotzdem weiterhin „gegen Hut“ gelesen. Doch wahrscheinlich galt ich der freien Szene unterdessen als allzu etabliert, und so verloren wir uns gegenseitig aus den Augen, vom AUSLAND einmal abgesehen. Aber das logiert hier ja gleich zweieinhalb Straßen weiter. Wobei Sie wissen, Freundin, daß ich mich längst auch an den anderen Orten eher rar gemacht habe, weil ich auch den Etablierten, und unterdessen wohl gerade ihnen, als Unhold gelte und dort ständig in einer Abwehrhaltung, bzw. der sofortigen Bereitschaft herumsteh oder -sitze, unmittelbar aus einer konzilianten Defensive in meinerseits die Attacke hinüberzuwechseln, eine Befindlichkeit, die keiner Seite angenehm ist, auch nicht der der „anderen“, und Dynamiken befördert, die gleichfalls niemand will. Nun hat sich das mit dem Erscheinen → der t+k-Ausgabe grundlegend geändert. Ich muß meine Position nicht länger permanent „beweisen“, diesem langjährigen Grundgefühl, imgrunde, als Autor, nicht für voll oder als eine Bizarrerie des Betriebs genommen zu werden, über die man sich dann hinter vorgehaltener Hand den Mund zerreißt oder bei dessen Auftreten sich eine, ich sage mal, gerühmte Gegenwartslyrikerin vor aller Publikumsaugen die Ohren zuhalten darf, ohne daß ihr jemand in den Arsch tritt oder sie doch angemessen des Hauses verweist.
Nein, das ist vorbei. Und also kann ich mich, genauso dachte ich gestern abend, auch in meiner gewohnten Aufmachung, diesmal sogar mit Gehstock, getrost auf den Weg machen, um zu schauen, was aus dem einst geliebten, damals der Subversion verschriebenen (Sub)Kulturzentrum geworden ist und wie es von einer jungen Autorin bespielt wird, die die Jahrtausendwende mit all ihren vorherigen Umbrüchen kaum schon bewußt erlebt haben kann. Zumal erschien sie mir als eine Repräsentantin all jener, die die „edle“ Holzvertäflung der etablierten Häuser mit allem Recht scheue und neue Wirkstätten erschloß — was ich selbst gern getan hätte, tun aber schon deshalb nicht konnte, weil ich nicht einmal mit meiner eigenen Generation die kulturellen Vorlieben teile, sondern durch und durch von Kunst geprägt bin, dem Gegenteil des Pops. Schon als Jugendlicher und junger Erwachsener war ich in, wie Clubs damals noch hießen, „Diskos“ fast durchweg beklommen, hielt die sogenannte Musik kaum aus, nicht selten wurde mir ihretwegen sogar übel; aber hin ging ich eben doch, einfach, um Mädchen da kennenzulernen. Was übrigens nie geklappt hat, hätt ich mir selbst denken können, wenn ich da miesepetrig rumsteh und absolut nicht kapiere, was die andern so berauscht, sondern immer nur tiefstes Fremdsein erlebe. Wirklich kennenlernen tat ich Frauen woanders, aber auch erst später. Oder eben in künstlerischem Zusammenhang. Aber daß, dies schon vor Jahren, junge Autorinnen und Autoren unvermittelt begannen, nachts um eins in den nun Clubs genannten Stätten Lyrik vorzutragen, fand ich von Anfang an hinreißend und war bei einigen solcher Auftritte auch zugegen. Hier klopfte doch das Herz dieser neuen Generation, was hätte da näher gelegen? Daß ich nicht dazugehörte, Göttin, war ja nix Neues; ich tat es – ecco – auch anderswo nicht.
Der frühe, doch bereits schwerdunkle Abend war, als ich aufbrach, lauer als erwartet; spätetestens nach dem Mauerpark begann ich, unter dem Hut zu schwitzen und trug ihn seither in der linken Hand, während ich dem Arkonaplatz zustrebte und dabei, wie ich bald merkte, absurd kreuz und quer ging; ich hatte einen neuen, mir noch nicht bekannten Weg suchen wollen, was auch gelang, doch halt mit Umwegen. Dennoch kam ich immer noch zu früh an, alleine schon, weil ich, wie sich herausstellte, statt 20 Uhr 19.30 eingetragen hatte.  Entsprechend leer war es auch noch; ein kleines bißchen lief Ditzer wie aufgescheucht umher, wurde später, aber noch vor ihrer Performance, denn auch mehrmals gefragt, ob sie Lampenfieber habe. Was sie mit leicht nervösem Lachen verneinte, also aufs eulenspiegelndste bejahte. Mir gefiel das sehr gut, zumal es erstens einen langen Tresen mit Barhockern gab und ich den mir empfohlenen Silvaner trinken konnte – einen Franken, nicht etwa Bayern, um das ein- für allemal festzuhalten -; ja sogar Pfeife rauchen durfte ich, auch im Raum. Plötzlich war ich zwar weiterhin Fremdkörper, aber einer, der sich rundum zuhause fühlt. Und bevor die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer eintrudelten – mit gutberlinisch anderthalb akademischen Vierteln -, schritt ich auch auf den quasi rund um den Innenhof führenden Raucherbalkon und war entzückt, daß die Sanierung dem architektionischen Ensemble gar nichts Böses getan, die alte Phantastik sogar noch erhöht hatte:
Entsprechend leer war es auch noch; ein kleines bißchen lief Ditzer wie aufgescheucht umher, wurde später, aber noch vor ihrer Performance, denn auch mehrmals gefragt, ob sie Lampenfieber habe. Was sie mit leicht nervösem Lachen verneinte, also aufs eulenspiegelndste bejahte. Mir gefiel das sehr gut, zumal es erstens einen langen Tresen mit Barhockern gab und ich den mir empfohlenen Silvaner trinken konnte – einen Franken, nicht etwa Bayern, um das ein- für allemal festzuhalten -; ja sogar Pfeife rauchen durfte ich, auch im Raum. Plötzlich war ich zwar weiterhin Fremdkörper, aber einer, der sich rundum zuhause fühlt. Und bevor die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer eintrudelten – mit gutberlinisch anderthalb akademischen Vierteln -, schritt ich auch auf den quasi rund um den Innenhof führenden Raucherbalkon und war entzückt, daß die Sanierung dem architektionischen Ensemble gar nichts Böses getan, die alte Phantastik sogar noch erhöht hatte:

Nix von gecleanter Glätte also, in der die Spatzen verenden, weil für Nest und Ei kein Raum mehr ist, und Fledermaus ein Fremdwort wird; ich paßte in meinem Armani mit Lagerfeldkrawatte (Elredgeknoten) bestens da hinein, weil es betont(e), was an Berlin nach wie vor berauscht, aber im doch eher kleinbürgerlichen Literaturbetrieb nach wie vor nicht begriffen ist: daß es komplett wurscht ist, ob die Menschen im Bademantel Brötchen kaufen gehen oder Straußenfedern auf dem Kopf tragen, weil sie die Notaufnahme konsultieren, oder ihr gesamter Körper eine Tattooshow in russischer Hängung ist usw.; es kommt doch nur darauf an, ob es zu den Menschen paßt und sie ihr Erscheinungsbild eben nicht irgendwelchen fremdbestimmten Normen angepaßt haben, die ihnen selbst gar nicht entsprechen, also daß zum Beispiel ein Autor, um als solcher anerkannt zu sein, schlatscherig herumlaufen muß, weil er sonst als eitel gilt und Dichter, die es seien, dies bekanntlich nie, aber echt nie, sogar nie-nie-nie-nie sind. Dichter sind bescheiden, am besten gebeugt und unter den Fingernägeln die Trauer, nur dann ist ihrer Arbeit zu trauen. In deutschen, selbstverständlich, den moralischen Landen an sich. Das kann zum Beispiel der Süden nicht verstehen. Wahrscheinlich, weil er keinen Kant hatte. Muß man ihm nachsehen also, diesem Ausland. Egal. Die ersten Leute sind gekommen.
Nicht zu den Publikumsgästen, sondern irgendwie zum Haus gehörte, ich war wirklich becirct, einer der schönsten Transmenschen, den ich je gesehen. Er fiel mir erst auf, als ich das sehr edle Fellfutter ihrer langen Jacke sah, meinen Blick zu ihrem Gesicht hob, das mich komplett faszinierte, und dann aber seine Männerstimme mit einem Beiklang von Rauch sprach, was zu der Rauchware irritierend gut paßte. Ich konnte nicht anders, als diesem Menschen, dieser Menschin, später genau das zu sagen: „Sie sind einer der schönsten Transmenschen, die ich je gesehen habe.“ Nur fürchte ich, mein Satz kam als Kompliment nicht recht an, hat vielleicht sogar verstimmt, weil ich den Umstand überhaupt aussprach. Doch gehört er eben genau zu dem, was ich an dieser Stadt derart schätze: daß die Identitäten nie festgelegte sind und selbst, wo sie es sind, durch anderer Identitäten zwar nicht aufgehoben werden, aber zusätzliche Farben erhalten. So daß alles, alles leuchtet, selbst durchs Berliner Novembergrau, das bekanntlich volle sechs Monate währt. –  Gerne, übrigens, hätte ich ein Foto von der, in griechischem Sinn, geradezu klassischen Schönheit dieser Person gemacht, aber zu fragen, ob ich es dürfe, traute ich mich denn doch nicht, auch wenn es zum Titel des Abends und Gedichtbands gepaßt hätte: „Lieder der Dreistigkeit“.
Gerne, übrigens, hätte ich ein Foto von der, in griechischem Sinn, geradezu klassischen Schönheit dieser Person gemacht, aber zu fragen, ob ich es dürfe, traute ich mich denn doch nicht, auch wenn es zum Titel des Abends und Gedichtbands gepaßt hätte: „Lieder der Dreistigkeit“.
Unterdessen waren genügend Menschen beisammen, um den Abend beginnen zu lassen. Wobei es nicht nur „irgendwie“ mehr wie ein Freundestreffen war, bei dem alle schon ungefähr wissen, was auf sie zukommt, und daß sie es goutieren werden. Was bedeutet, es muß mit der Vorbereitung nicht allzu genau genommen werden, Fehler werden, weil man sich warm ist, mit Wärme beantwortet, indes Kunst, wie zu betonen ich nie müde werden werde, Kälte braucht, sowohl der Inszenierung als auch der Schöpfungsaktes selber, eine geradezu undemokratische Pedanz (weshalb Künstler, kommen sie zu politischer Macht, grauslich werden können). Wie auch immer, wir sollten die Stühle an den Wandrändern stapeln und uns dann im Kreis aufstellen. Normalerweise bin ich bei sowas empfindlich, oft verlasse ich die Veranstaltung sogar, ertrage ja schon nicht, wenn auf die Aufforderung „jetzt alle mitklatschen!“ mitgeklatscht tatsächlich wird, anstelle sich zu (ver)weigern. Hier aber war es anders. Ich erinnerte mich 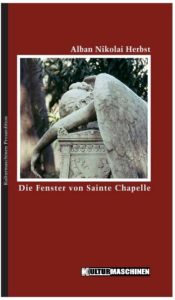 an den Kitkatclub, als er noch nicht, damals in der Nostizstraße, Kiddydisco war. Da hatte dergleichen zu tatsächlichen Entgrenzungserlebnissen führen können, von denen ein bißchen was in mein „Die Fenster der Sainte Chapelle“ eingegangen ist (grundlegend überarbeitet in
an den Kitkatclub, als er noch nicht, damals in der Nostizstraße, Kiddydisco war. Da hatte dergleichen zu tatsächlichen Entgrenzungserlebnissen führen können, von denen ein bißchen was in mein „Die Fenster der Sainte Chapelle“ eingegangen ist (grundlegend überarbeitet in 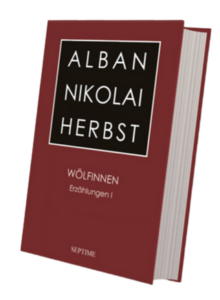 „Wölfinnen“, Erzählungen II). Ich wollte nun „einfach“ die aggressive und abgründige Weiblichkeit auch erleben, die obendrein als dreist angekündigt war. Da haut ein Mann nicht ab.
„Wölfinnen“, Erzählungen II). Ich wollte nun „einfach“ die aggressive und abgründige Weiblichkeit auch erleben, die obendrein als dreist angekündigt war. Da haut ein Mann nicht ab.
Flirrend leuchtete als erstes die Videoinstallation auf:

Hinter der ein Vorhang für den geschützten Umkleidebereich, aus dem nun – in eine Mischung aus Eurythmielehrerin, die aber im Alter ihrer Schülerinnen ist, und Vestalin gewandet – Ditzler mit ein bißchen rituellem Spielzeug hervorkam. Dazu paßte die allzu glatte psychedelische Musik, die das Video strukturierte; jedenfalls wurde der kleine Saal der Lettrétage quasi ein (selbst)ironisch aufgeladener Sakralraum. Mit einem so witziger- wie absurderweise Brotmesser wurden nun einzelne von uns ange-, ich schreibe mal, –schwebt und sowohl beflüstert als auch irgendwie aufgefordert, etwas mit dem Messer anzufangen, das streng genommen hätte Opferwerkzeug werden können, aber es ließ sich ja wohl nur Brot damit schneiden, auch wenn die Vestalin immer mal wieder ihre Handfläche gegen die Spitze der Dreiachtelwaffe drückte. Als später ich „drankam“, drehte ich sie um und streichelte mit dem stumpfen Heft der im Video mehrmals die „Goddess“ anrufenden, nun gut, Priesterin. Die sich unterdessen die Augen verbunden und durch den Raum nach Eleven und Novizinnen topfzuschlagen begonnen hatte. Unterm Video als Subtitles liefen nach wie vor die englischen Übersetzungen der rezitierten Verse mit, doch die Performance machte es eigentlich nicht möglich, sie einen nach dem anderen zu lesen und zumindest von daher zu verstehen, worum es ging. Ich hätte ja doch gerne Zusammenhänge zwischen Aufführung und Text entweder erkannt oder interpretierend hergestellt. Wir sollten jede und jeder, muß ich noch erzählen, den Duft eines geöffneten Flaconchens schnuppern; als ich später fragte, was  den Geruch verströmte, hieß es nüchtern „Opium“ – indes war offenbar das grauslich übersüßte → Toilettenwasser gemeint.
den Geruch verströmte, hieß es nüchtern „Opium“ – indes war offenbar das grauslich übersüßte → Toilettenwasser gemeint.
Schließlich wurde noch – nachdem für die eine und oder andere rituelle Handlung vor dem Podium auch immer mal wieder gekniet worden war – das Sakrament gespendet, allerdings der und von der Ditzer selbst, indem sie ein Schälchen voll ich weiß nicht, ob gefärbter Reismelde (Quinoa) oder noch feinren Couscous’es über sich selbst auskippte und nach Ende der, Verzeihung, „Show“ noch einen Drittelabend damit zu tun hatte, das Haar von dieser Art einer Begegnung mit dem Gott, hier der Göttin, wieder zu befreien. Auch eine Spielart der Säkularisierung, dachte ich.
Es gab den freundlichsten Applaus.
 Vorher, bevor die Aufführung losgegangen war, war mit Katia Ditzler ein von Tom Bresemann recht klug geführtes Gespräch geführt worden, die in ihrem Buchdebut auch ihren, wahrscheinlich, zweiten Vornamen Sophia führt; mag sein,
Vorher, bevor die Aufführung losgegangen war, war mit Katia Ditzler ein von Tom Bresemann recht klug geführtes Gespräch geführt worden, die in ihrem Buchdebut auch ihren, wahrscheinlich, zweiten Vornamen Sophia führt; mag sein,  um eine Weisheit zu betonen, die völlig unschlicht Pfiffigkeit ist. Etwa trägt Barbara C. Walkers
um eine Weisheit zu betonen, die völlig unschlicht Pfiffigkeit ist. Etwa trägt Barbara C. Walkers  nach wie vor – neben Gisela von Frankenbergs Kulturvergleichendem Lexikon – rein fachlich unerreichtes mythologisches Lexikon den esoterischen Titel „Das geheime Wissen der Frauen“ — der (!), als wüßte auch nur ein Brüchelteilchen aller Frauen, was das grandiose Buch zu vermitteln erst versucht. Jedenfalls behauptete Ditzler, etwas verkürzt wiedergegeben, „nur“ Literatur sei langweilig, worauf Bresemann – als selber Autor zumindest projektierter Bücher – nicht weniger pfiffig fragte, weshalb denn dann ausgerechnet ein Buch. Worauf wiederum Ditzler weniger eine wirkliche Antwort hatte, als daß es ihr, Buchautorin zu sein, nicht so sehr zu schmeicheltn schien als ihr vor allem gutzutun. Und neckisch verwies sie, als Neuerung, auf den QR-Code, den man, um im Netz zu den Videoperfomances zu gelangen, nur mit dem Smartphone scannen müsse. Was Neuerung eben nicht ist; vielmehr hält es diaphanes in den → Magazinen schon lange genauso. Eine aber charmante Form der Unbedarftheit ward nicht nur hier spürbar, letztlich nichts als – aber gern, wenn gemerkt, und dann eifrig abgelegte – Kenntnislosigkeit, die eben auch die Performance selber anbelangt. Wo Dreistigkeit auf den Fahnen steht sowie weibliche Abgründe angerufen werden, möcht ich dann schon mehr sehen (und selber riskieren), als Übertretungen, die keine sind, sondern ein vorsichtig, gelegentlich den Kitsch streifendes Fragen, ob man denn auch dürfe, und frau. Es soll doch keiner verletzt in ihrer und seiner Empfindlichkeit werden …
nach wie vor – neben Gisela von Frankenbergs Kulturvergleichendem Lexikon – rein fachlich unerreichtes mythologisches Lexikon den esoterischen Titel „Das geheime Wissen der Frauen“ — der (!), als wüßte auch nur ein Brüchelteilchen aller Frauen, was das grandiose Buch zu vermitteln erst versucht. Jedenfalls behauptete Ditzler, etwas verkürzt wiedergegeben, „nur“ Literatur sei langweilig, worauf Bresemann – als selber Autor zumindest projektierter Bücher – nicht weniger pfiffig fragte, weshalb denn dann ausgerechnet ein Buch. Worauf wiederum Ditzler weniger eine wirkliche Antwort hatte, als daß es ihr, Buchautorin zu sein, nicht so sehr zu schmeicheltn schien als ihr vor allem gutzutun. Und neckisch verwies sie, als Neuerung, auf den QR-Code, den man, um im Netz zu den Videoperfomances zu gelangen, nur mit dem Smartphone scannen müsse. Was Neuerung eben nicht ist; vielmehr hält es diaphanes in den → Magazinen schon lange genauso. Eine aber charmante Form der Unbedarftheit ward nicht nur hier spürbar, letztlich nichts als – aber gern, wenn gemerkt, und dann eifrig abgelegte – Kenntnislosigkeit, die eben auch die Performance selber anbelangt. Wo Dreistigkeit auf den Fahnen steht sowie weibliche Abgründe angerufen werden, möcht ich dann schon mehr sehen (und selber riskieren), als Übertretungen, die keine sind, sondern ein vorsichtig, gelegentlich den Kitsch streifendes Fragen, ob man denn auch dürfe, und frau. Es soll doch keiner verletzt in ihrer und seiner Empfindlichkeit werden …
So ähnlich merkte ich manches auch an, zog mich aber schnell wieder ins Schweigen zurück, weil ich ungern den Eindruck revitalisierte, ich risse Diskussionen immer an mich. Da lautet dann nämlich der Vorwurf: Egomanie – was gesagt wird, spielt keine Rolle. Soziales „Wohlverhalten“: Bescheidenheit vor Erkenntnisgewinn.
Doch im persönlichen Gespräch war es anders; Ditzler sogar selbst kam auf mich zu. „Tut mir leid“, sagte ich, „wenn ich manchmal etwas hart argumentiere.“ „Aber nein doch! Das ist völlig in Ordnung.“ Und wir plauderten ungefähr über das, was ich hierüber schon angemerkt habe. Unumwunden gestand sie zu, daß sie die Tonspur nicht wirklich gut abgemischt habe, und als ich fragte, wo denn heute abend die Dreistigkeit gewesen sei, hielt sie meinem Einwand das Brotmesser entgegen, das ja doch deutlich eine gewisse Gewalt und Gewalttätigkeit symbolisiere. „Weshalb dann aber nicht ein richtiges Messer?“ „Ich nehme halt einfach, was grade da ist.“ Und weshalb, noch einmal, sei nur-Literatur langweilig? Ich machte momentan, da ich mich den Serien und Filmen entzöge, eine völlig gegenteilige Erfahrung; die innere Eigenbebilderung des Gelesenen werde von einer äußeren Bebilderung wenn nicht zer-, so doch zumindest gestört, in jedem Fall unterlaufen. Es war insgesamt an den Reaktionen des Publikums aber deutlich zu spüren, daß gerade diese Außenbebilderung, zumal multimedial, einem Bedürfnis entgegenkommt. So daß Ditzler vermutlich auf dem völlig richtigen Weg ist, ich aber auf einem aus Holz steh. Nicht ganz, sowohl in den Hörstücken als besonders auch in meiner → Videoserie habe ich ja selbst mit anderen Darstellungs-, bzw. Interpretationsformen zu experimentieren begonnen:
Ich sprach noch einmal, nun konkret, frühere Performanceformen an, etwa Bodyart, Nitschs Mysterien, Vostells, den ich ja kannte, Environments und Happenings, denen nicht selten Übergriffigkeiten nicht nur eigneten, sondern die sie notwendig machten — Übertretungen eben, die sich auch nicht gleich wieder verharmlosen ließen, sondern ihr vermeintlich Skandalöses auch lange, nachdem sie geschehen, behielten, weil sie eben in uns eingreifen, uns nicht in Ruhe lassen, sondern fordern, und sei es zum Protest. Wenn man mit Dreistigkeit schon posiere – sie ist immer Übertritt –, müsse künstlerisch doch zumindest versucht werden, Grenzen auszureizen. Jemanden stören – was die Gestörten als Verletzung empfinden –  werden wir sowieso fast stets, sofern wir aus dem vermeinlichen Wohlverhalten und also dem Schutzraum für alle heraustreten; treten wir aber nicht heraus, entsteht keine Kunst. Ob es dann Kunst i s t, nun jà, ist dann immer noch eine andere Frage, eine, die wahrscheinlich wir selbst werden niemals beantworten können.
werden wir sowieso fast stets, sofern wir aus dem vermeinlichen Wohlverhalten und also dem Schutzraum für alle heraustreten; treten wir aber nicht heraus, entsteht keine Kunst. Ob es dann Kunst i s t, nun jà, ist dann immer noch eine andere Frage, eine, die wahrscheinlich wir selbst werden niemals beantworten können.
So ging, nach immerhin vier Gläsern Wein, der Abend für mich allmählich zuende — auch wenn es die reizvolle Möglichkeit gab, in zwei zur allgemeinen Verfügung bereitgelegten VR-Brillen (Ganzgesichtsaufsätzen eher) Ditzlers Videoinstallationen als 360o-Projektionen zu betrachten. Wovon ich besser abließ, weil ich zu gut weiß, wie ich dann abhebe. Das mochte ich weder mir noch jemandem anderes zumuten. Und spazierte durch die nun endgültig Nacht | fröhlich denkend heim.
ANH, 20.14 Uhr
[Gebhard Ullmann TRAD CORROSION, mit Andreas Wilbers und Phil Haynes (1996)]
P.S.:
Ditzers Verlag, ELIF, hat mir die Zusendung ihres Gedichtbands schon angekündigt;
also wird es hier wahrscheinlich einen Nachtrag geben.

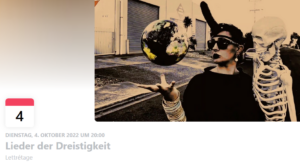
Einer meiner liebsten Einträge dieses Herbstes…!
Wollte zunächst Lieblingsstellen copypastend hervorheben (beginnend mit „(…)wurde später, aber noch vor ihrer Performance, denn auch mehrmals gefragt, ob sie Lampenfieber habe. Was sie mit leicht nervösem Lachen verneinte, also aufs eulenspiegelndste bejahte.“
Wurden mir dann aber entschieden zu viele 🙂
Der vorletzte Absatz vor allem bringt gut auf den Punkt, was Kunst kann und wo sie scheitert und implizit auch, wenn Provokationen zu einer Pose geraten und damit die Kunst verraten – im Sinne von Verrat begehen.
In etwas anderem Kontext zwar, aber auf ein ähnliches Problem rekurrierend, nämlich das einer ästhetischen Entleerung und eines Krisenszenarios hat es Adorno in seinem Surrealismus-Essay geschrieben:
„Nach der europäischen Katastrophe sind die surrealistischen Schocks kraftlos geworden. Es ist, als hätten sie Paris durch Angstbereitschaft gerettet: der Untergang der Stadt war ihr Zentrum. Will man danach den Surrealismus im Begriff aufheben, so wird man nicht auf Psychologie, sondern auf die künstlerische Verfahrungsweise zurückgehen müssen. Deren Schema sind aber fraglos die Montagen.“ (Adorno, Rückblickend auf den Surrealismus)
PS: Schade, diese Veranstaltung hätte ich mir gerne angesehen. Es klingt interessant. Und was Sie da zur Diskothek schreiben: ja, das ging mir früher ganz ähnlich, egal ob das in HH damals ein In-Schuppen war wie das Front oder außerhalb von HH sowas wie Massenbetriebstanzklubs mit Touch to much wie das MicMac Moisburg. Ich mag Massenveranstaltungen nicht, außer ich bin mit der Kamera „bewaffnet“, die für mich eine Art von Distanz erzeugt, so daß ich als Photograph dabei und doch nicht dabei bin – auf diese Weise fand ich sogar Faschingsfeiern irgendwie witzig. Anyway, ich schweife ab: Und ebenso sind mir solche Stuhlkreissachen nie geheuer gewesen. Aber Sie haben das beste daraus gemacht, wie man hier nachlesen kann. Eine schöne Performance-Kritik.