Meine Strümpfchen sind rot.
Wen ich lieb, mach ich tot.
Wer mich liebt, den mach ich tot.
Drum sind meine Strümpfchen rot.
Sind es Kinderstrümpfe,
sind es keine Strümpfe.
Rot ist nicht rot —
tot ist tot.
Rot ist nicht der Tod —
Wie um Göttinswillen erzähle ich von diesem Roman? Es war schon schwer auszuhalten, ihn zu lesen. Wer bei meinen Büchern, behauptet, d i e seien eine Zumutung[1]Um ganz von den angeblich unaushaltbaren Szenen in Meere zu schweigen., hat noch niemals eine erlebt, sondern zuckt ums Leben, weil ein Tropfen Bluts in sein warmes Badewasser fiel und auf dem in der Wanne hochgeflockten Seifenschaum ein rötlich Fleckchen hinterließ. Die Wurliblume zieht aber tatsächlich eine Spur der Verheerung hinter sich her, die zugleich Verheerung, ihrer selber, ist, und der, ja, ihm inhärente Skandal dieses Textes, daß eben nicht einfach von einer Täter-Opfer-Umkehr gesprochen werden kann, wie ich u.a. → dort las, sondern der sich hier ziemlich hämisch feiernde Sadismus steht vielmehr in wechselseitigem Austausch mit dem der deutschen Dörfler, unter und zwischen denen sich die Handlung begibt. Skandalös ist aber vor allem, besonders in diesen neumoralischen Zwanzigerjahren, daß die Geschichte[2]1972 bei Rowohlt als Taschenbuch erschienen; mein Exemplar gibt eine Auflage vom 34. bis 43 Tausend (!) an, was — einen absoluten Bestseller bedeutet. von einem Mädchen erzählt wird, das zu Beginn das Buches etwa zehn, am Ende dreizehn Jahre alt ist und von allem Anfang an geradezu geworfen – und dorfpassend inzestuös[3]Zu meinem Tier ist er [des Mädchens einer Bruder] sehr lieb, er hat nicht so harte Fingernägel [wie sie], seine Fingerkuppen sind größer und fleischiger als die meinen. Dieses Spiel ist wirklich … Continue reading – sexualisiert ist. „Mein Tier ist gespalten“, fängt „die Kleine“ gleich zu erzählen an, „der Ort, an dem ich wohne, auch; deshalb sag ich zu ihm Spalt, auch blauer Mund oder Zipfel, weil da ein Zipfel ist (…)“, nämlich die Clitoris, die ihr, aber vor allem auch geradezu sämtlichen Jungens und Männern, die’s mit der Wurliblume zu tun bekommen, extem zu schaffen macht. Ein glückhaftes Zusammengehen ist ihr nur im Traum gegönnt:
Mein Geist [der ihr aus dem von ihrer Mutter vorgelesenen Winnetou ersteht, ANH] kommt so ziemlich jede Nacht zu mir. (…) Er weiß sicherlich, daß ich mich nur aus Angst vor ihm schlafend stelle. Er ist so vorsichtig, spricht niemals, um die anderen nicht zu wecken. Zu ihnen geht er nie, nur zu mir. Deshalb, und weil sein Kommen so unheimlich schön ist,
hier bereits deutlich die das Buch bestimmende perverse Ambivalenz: sich aus Angst schlafend stellen, weil es unheimlich schön ist,
nenne ich ihn meinen Geist. (…) Ich liege vor dem Einschlafen immer auf dem Rücken, so kann ich ihn sehen, wenn er (….) in der Schlafzimmerür erscheint. Gefühlt habe ich ihn schon längst (…), ich seh, wie er auf mein Gitterbett zukommt, an meiner Seite stehen bleibt, sich dreht und wendet in den Laken, langsam mit den Armen schwingt, heiße und kalte Luft um sich wehen läßt, die mich piesackt wie Stecknadelspitzen prickeln; es tut richtig weh. Das Schöne ist etwas anderes: Er schleicht ziemlich lange um mein Bett, dann hebt er sich ganz langsam vom Boden, mir wird wahnsinig heiß, weil ich weiß, daß er jetzt waagerecht über mir schwebt — sein verhüllter Leib berührt mich nur ganz wenig, und dann fühle ich den heißen Atem direkt vor meinem Gesicht, gegen meine Lippen bläst er, gegen meinen Hals, in die Augen, die ich jetzt fest geschlossen habe, er darf niemals merken, daß ich noch nicht schlafe. Einmal, zu Muttis Geburtstag, hatte ich Wein getrunken, daher weiß ich, was ein Rausch ist. Das, was ich mit meinem Geist fühlen kann, ist tausendmal stärker, viel gefährlicher und unendlich schön. Ich kann nie verfolgen, wie er von mir weggeht, muß immer irgendwo anders sein zu dieser Zeit, und dann bin ich traurig und habe keine Angst mehr [Um nicht traurig zu sein, muß sie Angst haben! ANH], möchte ihn zurückrufen. Ich schieb mein langes, albern weißes Nachthemd über meinen Buch bis unter den Hals zu einer dicken Wurst zusammen, vielleicht erscheint er noch einmal. Er ist nie zweimal gekommen, alles Bauchstreicheln nutzt mir nichts, aber er kommt jede Nacht. Deshalb schlaf ich morgens etwas länger, damit der Tag schnell um ist und ich ihn wieder fühlen kann.
S. 10
Einmal abgesehen davon, daß durchaus nicht heraus ist, ob der in Bettlaken gehüllte „Geist“ nicht tatsächlich ein Mann, ein Freund der „Mutti“ etwa, ist, der nicht erkannt werden will und von dem erregten Mädchen ins Traumgebilde eingesponnen wird, und daß mir dieses für sie, die Mutter, strikt durchgehaltene Wort „Mutti“, stetig fürchterlicher wurde und schließlich kaum mehr zu ertragen war, derart gewalttätig ist diese rohe Frau sowohl seelisch als auch direkt körperlich — davon also erstmal abgesehen, laufen die kommenden Legionen der Übergiffe, Mißbräuche und schließlich auch penetrierenden Vergewaltigung nicht im entferntesten derart sanft ab wie im geschilderten (Halb)Traum, paaren aber mit ihnen zugleich der Wurliblume eigenkörperliche, sexuelle eben, Lust:
Er sagt dann, wir müßten beide unsere Röcke ausziehen und auf die Erde legen, auch die Unterhosen. Ich frag ihn, was das soll und was wir dafür kriegen. Er meint, die mit dem schöneren Hintern wolle er bohren. Wie er das wohl machen will? Er sagt, ganz echt, so wie er es bei seiner älteren Schwester machen dürfe, wenn sie alleine seien. Ich bin neugierig, weil ich mit meinem Bruder noch nie gebohrt, sondern immer nur gewippt[4]Was sie damit meint, wird weiter unten deutlich; hier bewußt k e i n e „Erklärung“. ANH habe, und so mache ich mit, hab meine Hose schnell runtergezogen und schäm mich, weil es eine dieser rosanen Strickdinger ist (…). Aber als ich Renate sehe, die so spindeldürr ist, nur Knochen und weiße Haut, bin ich doch gleich wieder obenauf, es ist auch so dunkel, daß sie meine Hose gar nicht erkennen können. Unsere Popos blitzen trotz der Dunkelheit. Wir stehen beide vor ihm, sehen ihn an. Er sagt, er wolle erst das Rückwärtige sehen, bevor er bohrt, wir sollen uns mit dem Gesicht zur Holzwand stellen, am Balken festhalten, die Beine steif machen, Knie nach hinten durchdrücken und uns so im Kreuz biegen, daß die Wölbung richtig zur Geltung komme. Wir machen alles mit. Es ist still hinter uns und das etwas zu lange. Ich frag, was denn nun komme, ob er nicht mehr weiterwisse? Er meint, es dauere ein bißchen. Dann hör ich die Schnalle, die silberne mit der Lilie, von seinem Gürtel klimpern. Er fragt, ob er meinen Popo – [Ihre Vulva nennt sie übrigens oft, neben „mein Tier“, mein Pipi] – mal streicheln dürfe, aber ich will nicht, ich will wissen, wer den schöneren Popo hat, er soll – [Das ist nicht mehr indirekte Rede!] – sich endlich entscheiden, wen er bohren möchte. Meiner sei schöner, sagt er. Ich bin ganz stolz, will aber wissen, warum.
„Weil Renates zu dünn ist.“ Wir fragen, ob wir uns umdrehen dürfen, wir dürfen. Er hat den Hosenschlitz aufgeknöpft und holt sein kleines Würstchen hervor, ich dachte, er müsse doch so ein Dings haben wir mein Bruder. Aber nein, das Würstchen wird weder härter noch länger, ich hab wirklich kaum mehr Lust, mich bohren zu lassen.
S. 41/40
Was bedeutet, wie sie in diesem Zitat selbst betont, daß sie Lust gehabt habe. Machen wir uns unbedingt weiterhin klar, daß diese Rollenprosa nicht etwa von einem wie immer auch notgeilen oder schwerzynischen Mann, sondern von einer Frau geschrieben worden ist. Selbst wenn wir die Erzählung als eine grobgemütlose, um von „Geschmack“ zu schweigen, Satire aufs primitivste Proletariat lesen wollten, bleibt der Eindruck eines extremen Sado-Voyeurismus im unangenehmsten Recht, etwa in der folgenden nun überdies sodomitischen Szene:
Da ist das Grunzen wieder, diesmal ganz dicht. Die nackte Angst durchrieselt mich. Meine Beine sind schwer, ich kann sie nicht mehr heben, meine Arme sind steif, ich bin gelähmt! Das Grunzen ist hinter mir, stößt gegen den Schlitten, der Schlitten wird schwerer, ich kann ihn nicht mehr ziehen. Das Grunzen hält ihn fest, und dann fühl ich es an meinem Arm, im Nacken sitzt’s mir eiskalt, von ganz dich, durch Stoff und Haut, greift mich an, gräbt scharfe Fingerkrallen in meinen Oberarm, zerrt an mir, bis ich in den Schnee stürze. An meinem Hals hinten spüre ich die nasse Schnauze von dem Vieh, dem Schwein, dem Wildschwein! Ich reiß mich vom Boden hoch, strampel mit den Füßen, ras in Richtung Heimat.
„Was wühlst du mit der Schnauze da unter dem Mantel? Du Luder, dir werd ich’s zeigen! Laß die Klauen von meiner Puppe! Mistvieh! Verschwinde, du Aas!“
Da krümmt es den Rücken, taumelt in schlierigen Stapfen auf mich zu, spreizt die Haxen, springt auf der Stelle, dreht sich, es ist bei mir. Ich will weglaufen, da steckt es die Hinterbeine in den Schneematsch, schlingt die Vorderklauen um meinen Hals, umklammert mich, läßt nicht los, die heiße Schnauze. Es drückt mir die Luft ab! Ich kann mich nicht bewegen, weil es mich so fest umklammert hält. Ich kann nicht schlagen, aber ich weiß, was man mit solchen Viechern macht! Ich zieh mir, so gut es geht, die Hosen runter. Das Schwein preßt den heißen, glatten Bauch gegen meinen Rücken. Ich werf mich blitzschnell vornüber, geh ein bißchen in die Hocke, jetzt hängt der Lappen über mir, schnaubt wütend [,] und dann greif ich mit meiner Hand von vorn zwischen meine Beine durch, und da hab ich auch schon das heiße, weiche Ding in meiner Hand. Ich zieh es durch meine Beine nach vorn, klemm die Schenkel ganz fest zusammen, damit es nicht zurückrutschen kann. Es ist ganz schnell aus dem Haarsäckchen geschlüpft. Mein Tier ist genauso aufgeregt. Ich steck die beiden zusammen [Sie steckt!], zeig ihm, wie man es macht, dann geht es wie bei meinem Onkel: rit-mus-rit-mus. Der heiße Wurm wird so groß, daß ich ihn wachsen fühle. Das Schwein hat ganz vergessen, was es wollte. Es schnaubt mit seinen Bewegungen, zuckt in den kurzen Schenkeln, ich muß mitzucken, weil ich aufgespießt bin, mach mich endlich los. Das Schwein fällt vor mir auf seine vier Haxen, streckt mir seinen Hintern hin, ich geb ihm einen ordentlichen Tritt.
„Willst wohl mit nach Haus?“ Ich tret ihm in die hochgereckte Schnauze, sein Stummelschwanzwedeln bedankt sich dafür.
Mein Christus [die „Puppe“, eine Holzstatue] liegt seitlich ausgestreckt auf dem Boden im Schnee. Der andere Arm ist auch abgebrochen. „Du Vieh!“ Ich zieh dem Schwein damit eins über den Schädel. Den Kopf von meinem Jesus [Hier unversehens wieder Kindersprache.] bette ich auf den abgebrochenen Arm. Ich knie mich neben ihn. Wenn ich mein Gesicht ganz neben seins lege, kann ich sehen, daß er tot ist. Er schläft vielleicht nur, aber in den Augen ist so viel Weißes!
S. 111/112
Wie geschickt die Autorin das Schimpfwort „Schwein“ hier, weil es biologisch tatsächlich eines ist, legitimiert! Und geradezu entsetzlich organisch werden in der Szene der Eber und des Mädchens mißbräuchlicher „Onkel“ identisch. Doch ist das nur eine der zahllosen Stellen, die bei allem Leserabscheu extrem aufmerken lassen. Ebenso die Rhythmisierung. Und dann die auch nicht zu erwarten gewesene Symbolisierung: Christus ist tot, es gibt keine Erlösung. Aber vielleicht schläft er ja nur … — Doch leider, leider nicht:
Er aber knöpft sich seine Hose noch weiter auf, will sich auf mich drängeln, das ist jetzt wohl jenes Scheißspiel, das mein toter Bruder mit mir spielen wollte,
der sich umgebracht hat, nachdem sein Mißbrauch bemerkt wurde, zu dem ihn die Wurliblume allerdings durchaus auch verführt, wenigstens mitverführt hat; auch ihr zweiter Bruder wird sich umbringen (ihre gehaßte hochschwangere Schwester hingegen bringt sie selbst um, und das grad noch geborene Baby wird von einem nächsten Mißbraucher am Ufer verscharrt),
bei dem mir die Eingeweide so brennen! Ich mag das gar nicht und witsch immer wieder unter ihm weg. Er zieht mich zurück. In der einen Hand hält er sein Ding, es ist jetzt auch ganz fest, ich hab’s gemerkt, weil er mir damit in meinen Bauch gestoßen hat und dann noch einmal, aber ich will nicht! Ich hab Angst vor dem Bauchweh, ich kann das Spiel nicht leiden und werd wütend, weil er mich so fest umklammert. Schrei ihn an, er solle mich loslassen. (…) Er hält mich nur noch fester, daß es weh tut. Ich beiß ihn, so fest ich kann, in die Stelle, wo er Haare auf der Brust hat, immer fester grab ich meine Zähne hinein, strampel mit den Füßen.
„Ich will los!“ Er schreit auf. Ich beiß noch fester. In diesem Moment hat er mir seinen Miststock in mein Tier gebohrt. Ich heul und heul, weil ich dieses Scheiß-Scheiß-Spiel hasse und den verdammten Onkel! Ich spuck ihn an: „Ich werd dich totspucken!“ Er wird plötzlich ruhig, nachdem er ein paarmal mit dem Hintern gewackelt hat, zieht seinen Pint raus, hockt sich über mich und knallt mir eine mitten ins Gesicht (…), und dann viel später, nach einigen Stunden, hat [er] mich in die Decke gewickelt, ins Zimmer getragen. Ich kann sehen, daß seine Augen feucht sind. Er legt mich neben sich ins Bett, streichelt mich, reibt überall, damit ich auftaue [Sie war zwischendurch weggelaufen, hinaus in den Schnee.]. Den Rest der Nacht schlafen wir beide schlecht. Ich kann nicht, weil ich husten muß; er weint. Weil er mir leid tut, streichle ich sein Würstchen, er mein Tier, davon wird mir wieder warm. (…) Dann nimmt er seine Hand von meinem Ding, legt seinen Kopf wieder zwischen meine Beine und spielt mit meinem Tier. Nach einer Weile kommt er mit dem Kopf aus der Decke raus, fragt, ob ich das leiden mag, ich sag: „Ja“. Er kriecht wieder unter die Decke, ist ganz lieb zu meinem Tier.
S. 142
So viel gegenseitige Verlorenheit, eigentlich. Es wäre zum Flennen, gäbe es zu den Vergewaltigungen in Reihe – sämtlichst von Männern verübt, die in keiner Weise Geist noch auch eigentlich Macht haben, sondern machtlos selber, Geworfene auch sie, sind – nicht auch noch diese anderen Stellen:
Die Rinden, die sich krümmen wie meine Schnecken unter dem Streichholz (S. 13) – (…) ich kann ungestört mit den Schnecken spielen oder auch Ameisen ertränken oder Regenwürmer zerteilen. Mein kleiner Bruder muß sie manchmal schlucken, ich sag ihm, daß es Stöckchen sind. Er ist zwei Jahre älter als ich, aber viel dümmer, er glaubt und macht alles, was ich ihm vorspreche. (S. 20) Mit der Nadel spieße ich die Käfer und größeren Spinnen auf, nach dem Knax leben sie noch lange weiter, auch Spucktropfen stören sie nicht besonders, Beinauszupfen macht sie kribblig. Wenn ich die Streichholzflamme dagegenhalte, schrumpfen sie zu winzigen Häufchen zusammen, die nichts mehr mit Käfern und Spinnen zu tun haben, und nach verbranntem Haar stinken. (Ebda.)– Einige [Schnecken] kommen immer wieder von der Bahn ab; zur Strafe mach ich sie einäugig, mit meinen abgebissenen Fingernägeln ist’s recht schwierig, die Augen abzukneifen, aber weil ich Zeit habe, gelingt es mir immer. Die Sieger gegen die die Sieger, die Untauglichen ins Pinkelbecken, wo sie bald die ausgestreckten Schleimbäuche nach oben kehren. Oder mit blitzschnellen Stichen aufs Käferhölzchen gespießt, sie befühlen sich im sinnlosen Lauf, die Käfer, die Spinnen, die Schnecken, ich wünschte, Mutti oder meine Schwestern könnte ich so klein verzaubern, ich würde sie unter der dicksten Spinne festsetzen, stundenlang auf dem Bauch liegen, zusehen, ihren Fistelstimmen lauschen. Ich lasse niemals eines dieser Tiere am Leben, auch Bienen und Wespen mag ich nicht. (S. 21)– „Sargnagel“, sagt sie [die Mutter]. Wär ich doch bloß einer und dann so lang und spitz geschliffen, daß bei dem Zuschlagen des Deckels meine angefeilte Nagelspitze in ihr Auge bohrt, über dem Schädel soll es auslaufen, der langsam verbleichen, sich schälen soll wie ein Bratapfel. Ich möche auch, daß sie im Winter stirbt, damit’s recht eisig ist unter der Erde, und ich um die Weihnachtszeit an sie denken kann, wenn ich am warmen Ofen sitze und richtige Bratäpfel esse.
(S. 29)
Wobei dieser grenzenlose Haß auf ihre „Mutti“ durchaus berechtigt ist; im Tableau dieses Romans nehmen die Figuren einander an Grausamkeit nichts, aber auch gar nichts:
Die Männer, in ihre Decken gehüllt, stehen dicht am Ausgang, sie wollen zu den Mädchen. Der eine Zigeuner zittert am ganzen Leib, er zuckt, öffnet sein zahnloses Maul, aus dem Schaum sprüht, plärrt wie ein abgestochenes Schwein, wie der Hirsch im Frühtau [ein Einfall, der jetzt wieder erstaunt und allem Elend eine besonders unangenehme Größe verleiht), springt den Durkan an, der sich bedächtig umdreht. Dem Alten sind die schmutzigen Lappen vom Gestell gerutscht, er will neben dem Durkan aus dem Eingang stürzen, der eine Arm ist verwachsen, ein Fleischknödel muß abgepreßt worden sein und irgendwie wieder verheilt, sieht aus wie das Loch einer Kuh, bevor sie Fladen fallen läßt, dadurch hat er ein Messer gesteckt und will’s dem Diurkan in den Leib stoßen. Gelassen dreht sich der Durkan um gegen den wütenden Trottel, der mit seinem gesunden Arm in die Luft sticht, wie wild fuchtelt, der Durkan drischt die Faust in das verschrobene, verzerrte Gesicht, der Mann steht versteinert, völlig unbeweglich plötzlich, kein Zucken mehr, kein Laut, Schaum spritzt aus dem Schlund und etwas Blut. Der Durkan zieht das Messer aus dem Arschloch und führt es mit unheimlich gekonnten Strichen zuerst waagerecht, dann senkrecht über die Stirn des Irren, kein Tropfen Blut ist auf dem Schädel zu sehen, die Haut biegt sich trocken gegen den Hautansatz, wölbt über der Stirn, Haarschopf, Kringelnacken, am Haaransatz im Nacken macht sie eine Krause, der Schädel ist rot wie die Ziegenköpfe beim Schlachter, denen man das Fell abgezogen hat, das da hängt oder liegt und auch nicht mehr blutet. Die andere Hauthälfte trennt sich im unteren Gesichtsteil von den Augen, zwei haarumsäumte Wimpernlöcher zwinkern, die Nase wird mit einem flinken Ruck frei, dann das Mundloch, der Lappen hängt unter dem Kinn, kringelt sich da zusammen wie die Apfelsinenschale auf dem Ofen. Der Irre sieht aus wie ein geplatzter Granatapfel im Hochsommer, mit einem ganz kurzen hieb schlägt der Durkan das alte Ding ab, steckt dem Krüppel, der immer noch noch steif steht, das Messer ins Arschloch, dann geht der Durkan zum Toreingang. (…) Aus dem abgeschlagenen Pint drückt von innen Fleisch nach, er scheint noch lebendig zu sein, aber das glaube ich nicht!
S. 51/52
Besonders infam wird es bei der an einem vereisten Fluß stattfindenden Geburt ihrer Nichte und der Ermordung der Mutter, ihrer schwangeren Schwester:
„Nein,nein, nein! Mutti, Muttilein! Uahh, aua!“ Sie wälzt sich, muß verrückt geworden sein. Ich hab den Koffer aus dem Wasser gezogen, mach ihn auf, schmeiß die ganzen Klamotten in den Fluß und den Koffer hinterher. (…) Sie hat sich in die Hose gemacht. Da ist ein dunkler, wachsender Fleck, der die helle Unterhose verfärbt, ausbeult. (…) Ich hock mich auf den Platz zwischen ihren Beinen, weil ich so den Fleck besser beobachten kann. Kurz bevor sie still war, sagte sie: „Das Kind, das muß es sein.“
Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Der Mantel ist klitschnaß, die Sachen darunter sind es auch (…). Ich zieh ihr die Hose ganz aus, sie hat anscheinend nichts dagegen, bewegt sich überhaupt nicht mehr.
Aus dem Loch zwischen ihren Beinen kriecht ein Stummel, ein heller Schwanz. Ich faß ihn an, zieh ein bißchen, er hat Rillen, die sich rauh anfühlen. Nur langsam wächst er aus der dunklen Höhle. Ich faß mit beiden Händen an, zieh vorsichtig, der Schwanz dehnt sich in die Breite, die Rillen fingerdick geschwollen. Dann geht es nicht mehr weiter. Aber da ist noch was drin, weil es klemmt, hinterhakt. Ich zieh mit aller Kraft.
„Hilf mir doch, du da!“ Der Schwanz ist so lang und breit wie mein Arm, aber da ist noch was dran. Jetzt kommt es. Ein helles Bündel an der einen Seite vom Schwanz, an der gegenüberliegenden Seite auch. Das sind zwei Beinchen! Richtige Beinchen mit Füßchen dran und winzig gekrümmten Zehen! Ich muß es ganz haben, muß stärker ziehen.
Und dann, als das Baby auf der Welt ist:
Ich steichle über die nasse Stirn, ganz leicht mit zwei Fingern. (…) Weiche, rosige Haut. Noch nie hab ich eine so schöne Puppe gehabt. Ich möchte, daß sie lacht, mit mir spielt.
Die Schwester interessiert fast nicht mehr. Dann aber doch:
Du liebe Zeit, meine Schwester, mein Plan! Sie liegt noch immer so da. Ich glaube, sie ist ein Stück weiter ins Wasser gerutscht. Ich mach ihr die Beine zusammen, sie sträubt sich. Ich werd wütend.
„Wenn du nicht gleich mithilfst, schmeiß ich dich ins Wasser! Stell dich nicht so blöd an, Rabenmutter!“ Ich leg das in den Mantel gewickelte Kindchen ein Stück weg von meiner Schwester in den Schnee, steig vorsichtig ins Wasser, denn ich will nicht absaufen. Es ist so eisig, Ich werd mir die Füße abfrieren. Dieser faule Haufen. Nur gut, daß sie nicht redet, immer noch ganz ruhig schläft. Ich faß sie unter den Achseln, greif so fest ich kann in den Mantelstoff, und dann zieh und zieh ich sie Stück für Stück ins Wasser. (…) Jetzt wird es zu tief, ich kann meine steifen Beine kaum mehr anheben. Ich laß den Sack so liegen, klettere auf allen v[V]ieren ans Ufer zurück, weil ich sie jetzt an den Beinen anfassen muß, die sie schön steif hält. Sie rutscht gut. Ihr Kopf muß schon im tiefen Wasser sein, genau kann ich das nicht sehen, aber sie pendelt leicht. Der letzte Rutsch geht spielend. Ich steh auf zwei großen [Komma gestrichen. ANH] nebeneinanderliegenden Steinen. Ein Schubs, ein Ruck – beinahe wäre ich vornübergekippt. Ich mach Gleichgewichtsübungen mit meinen Armen. Das kann ich, hab’s auf unserer Terrasse geübt. Ich seh, wie sie erst ein Stück auf die Flußmitte zutreibt, sie schwimmt gut! Dann dreht sie sich und segelt mit dem Kopf voran Richtung Ostsee.
S. 124/125
Daß das Kind tot geboren wurde oder im Schnee stirbt, muß ich wahrscheinlich gar nicht erzählen. Die Wurliblume schert es nicht, die nun dem schon erwähnten „Onkel“ begegnet — einem Mann, der dieser seinem Eindruck nach Verlorenen erst einmal nur helfen möchte, schließlich aber, es war nicht anders in diesem Buch zu erwarten, ebenfalls hart übergriffig wird:
Er hält meinen rechten Schenkel fest, damit ich nicht friere. Ich sag zu meinem Onkel immer ‚Sie‘ und ‚Onkel‘. Ich solle doch Günther zu ihm sagen, das alberne Wort ‚Onkel‘ weglassen. Ich verspreche mich sehr oft. Wir wetten; jedesmal wenn ich ‚Sie‘ sage, muß ich ihm einen Kuß geben. Ich finde das recht witzig, aber auf die Dauer langweilig, also verspreche ich mich nicht mehr.
S. 132
— … und ihm eine rührselig verlogene Geschichte dessen erzählt, was tatsächlich geschehen ist. Das Baby bleibt lange Zeit vergessen. Die beiden sonnen sich auf Liegestühlen, als die Sonne über das verschneite Land brennt. Danach kommt es zu weiteren gewaltsamen Übergriffen, die das Mädchen sowohl will wie ablehnt, Libido wird scharfe Aggression, es wiederholt sich die immergleiche Dynamik:
Ich möchte eigentlich gern wiederkommen zu Onkel Günther. Dieses Kreidelecken [einen Cunnilingus; siehe Schlußbemerkung.] mag ich sehr gern. Er hat mir auch versprochen, mich nie mehr zu bohren. Ich hab noch ein paarmal das schöne Gefühl, und dann bin ich hundemüde und schlaf irgendwann ein.
S. 142
Zwischenzeitlich habe ‚Onkel Günther‘, erzählt er, das tote Kind genau dort vergraben, wo die Wurliblume ihre im furchtbarsten Wortsinn ohnmächtige Schwester ins Wasser hineingeschoben hat. Jetzt, endlich auf dem Heimweg, will sie sichergehen und schaut bei Tage besser nach:
So, eine halbe Stunde habe ich Zeit. Wenn er mich belogen hat? Ich laufe das Stück Weg entlang bis zur Wiese, über die ich mit meiner Schwester zum Fluß gewankt bin. (…) Am Tage sieht alles anders aus. Man kann ganz genau braunrote Flecken sehen und an der Stelle, wo der breite Streifen in den Fluß führt, ist eine festgestampfte Erhebung. Ich greif einen Stein aus dem Wasser, kratz in das gefrorene Häufchen einen kleinen Tunnel. Da ist ein Fleckchen lila Fleisch, das Kindchen. Ich möcht es gerne mitnehmen, es zu Hause baden, aber das geht nicht. Der liebe Onkel Günther! Ich muß zurück, wieder in meinen Fußstapfen, aber diesmal in denen für den Rückweg.
S. 143
Wobei ich Ihnen Zitate der wohl heftigsten Übertretung jetzt erspare, wenn sie nämlich den Phallus ihres noch hängenden anderen Bruders, nachdem der sich ebenfalls umgebracht hat und vom Wurliblümchen und ihrer mütterlichen Freundin Wurio noch am Strick gefunden wird … — wenn sie nämlich mit deren Hilfe versucht, den todesstarren Phallus „in ihr Tier“ hineinzustecken. Vielleicht aber doch das:
Wurio hebt mich hoch, ich klammer mich an seinen Schultern fest, an den Pullover. Kann die Fischaugen mit den roten Flüßchen drin von ganz dicht sehen. (…) „So ist’s brav!“ Ich setz mich selbst auf seinen Finger. So wie ich will. Mach die Bewegng, die er gemacht hat, aber so, wie ich will. (…) Wurio steht unter mir, hält mir ihre Hände entgegen. Nein, nur die eine, die andere hat sie unterm Rock.
S. 177
Wie kam ich nur auf dieses entsetzliche, aber in der künstlerischen Faktur extrem gut gebaute Buch[5]Sogar die, hier aber nicht durchgängig, falschen Konjunktive lassen sich als Rollenprosa abbuchen. ANH? Ich weiß es nicht mehr, fand es beim Umräumen neulich bei den, ja, Kinderbüchern, wo es einzuordnen mich ganz sicher die Illustration des Umschlags verleitet hat. Hineingeschaut hatte ich nicht und bin Göttinseidank auch nie auf den Gedanken gekommen, es meinem damals noch kleinen Sohn vorlesen zu wollen. Genau dafür muß es aber bereitgelegen haben. Und nun sortierte ich aus, was ich aus Herzensgründen aufheben mochte (Jim Knopf, Der kleine dicke Ritter, Nils Holgersson usw.), schaute d a erst hinein. Und dann … —
Über die Autorin, übrigens, hat sich nur wenig herausfinden lassen; ich habe ziemlich gesucht. Wie ein Tuch scheint sich über sie das Schweigen gelegt zu haben,  obwohl dieses Buch sogar ins Amerikanische übersetzt worden ist und – vielleicht auch aufgrund des eher ans Horrorgenre, jedenfalls nicht an ein
obwohl dieses Buch sogar ins Amerikanische übersetzt worden ist und – vielleicht auch aufgrund des eher ans Horrorgenre, jedenfalls nicht an ein  Kinder- oder Jugendbuch erinnernden englischsprachigen Titels The Demon Flower –, in den USA einigen Erfolg gehabt zu haben scheint. In Deutschland blieb die Autorin nicht einmal eine literargeschichtliche Fußnote, auch wenn ihr Wolf Donner, allerdings erst drei Jahre nach der Ersterscheinung des Buches, eine ausführliche und spürbar faszinierte → Rezension in der ZEIT geschrieben hat, gegen den Mainstrich offenbar. Als Uta Haack geboren und erst kürzlich, 2014, verstorben, habe sie auf Ibiza gelebt und sei als Ute Schröder bei der Biennale d’art contemporain de Lyon mit Environments vertreten gewesen. Sie starb im Februar 2014. Nichts davon habe ich verifizieren können.
Kinder- oder Jugendbuch erinnernden englischsprachigen Titels The Demon Flower –, in den USA einigen Erfolg gehabt zu haben scheint. In Deutschland blieb die Autorin nicht einmal eine literargeschichtliche Fußnote, auch wenn ihr Wolf Donner, allerdings erst drei Jahre nach der Ersterscheinung des Buches, eine ausführliche und spürbar faszinierte → Rezension in der ZEIT geschrieben hat, gegen den Mainstrich offenbar. Als Uta Haack geboren und erst kürzlich, 2014, verstorben, habe sie auf Ibiza gelebt und sei als Ute Schröder bei der Biennale d’art contemporain de Lyon mit Environments vertreten gewesen. Sie starb im Februar 2014. Nichts davon habe ich verifizieren können.
Es scheint mir die Zeit zu sein, die heutige besonders, dieses Buch wieder ins Licht zu heben, auch wenn es – oder eben, weil es – uns mit etwas,  ich sag mal, „Möglichem“ konfrontiert, das wir so eigentlich besser nicht wissen wollen. Und vielleicht ist es ja doch anders, und Die Wurliblume gehört tatsächlich in die Nachfolge der lautréamonschen Maldorors. Ein Indiz dafür findet sich im auch stilistischen, deutlich surreal-phantastischen Höhepunkt des übrigens so schmalen Romanes nicht, wie er im Taschenbuch mit seinen als solchem 187 Seiten zu sein scheint; in einer bei, sagen wir, Schöfling & Co. erschienenen Ausgabe hätte es locker doppelt so viele, wenn nicht sogar (ich mag die Zeichen jetzt nicht auszählen) weit mehr. Also hören Sie (ja, hören!):
ich sag mal, „Möglichem“ konfrontiert, das wir so eigentlich besser nicht wissen wollen. Und vielleicht ist es ja doch anders, und Die Wurliblume gehört tatsächlich in die Nachfolge der lautréamonschen Maldorors. Ein Indiz dafür findet sich im auch stilistischen, deutlich surreal-phantastischen Höhepunkt des übrigens so schmalen Romanes nicht, wie er im Taschenbuch mit seinen als solchem 187 Seiten zu sein scheint; in einer bei, sagen wir, Schöfling & Co. erschienenen Ausgabe hätte es locker doppelt so viele, wenn nicht sogar (ich mag die Zeichen jetzt nicht auszählen) weit mehr. Also hören Sie (ja, hören!):
Ich geh den Bach entlang bis zum Wald. Da seh ich zwischen drei Baumstämmen, deren Wurzeln aus dem Schnee ragen, ein unheimlich tiefes Loch. Der Schnee drumherum ist flachgetreten, an den Lochrändern hochgeschaufelt. Auf der einen Seite führen Schneetreppen in die Tiefe,
und sie steigt hinab, betritt einen an eine Wäschekammer erinnernden Raum, aber hört etwas von nebenan, tritt durch die Öffung und:
Ein See, ein großer See mit Wellen! Keine Bäume, nur der See, zu beiden Seiten steile Felswände, über ihm eine breite Felsdecke.
So daß wir in den Tiefen des verne’schen Voyage au centre de la terre angekommen sind.
Ich bin nicht allein hier. Am Ufer steht eine völlig ausgezogene Frau, die ich noch nie gesehen habe. Ich sag: „Grüß Gott!“ Sie schau mich an, nickt mit dem Kopf, sie scheint zu frieren. Es ist auch eiskalt hier. Bei uns im Ort hab ich noch niemals so lange [Komma gestrichen. ANH] blonde Haare gesehen. Windig ist es. Sie schaut wieder auf das Wasser, auf die Wellen. Als sie sich umdreht, kann ich sehen, daß sie zwei Beine hat, einen Popo, einen sehr breiten, und gleich den Kopf mit den vielen Haaren. Sie hat auch keine Arme, sonst hätte sie mir bestimmt die Hand gegeben. (…) Weil sie immer so auf das Wasser schaut, mach ich das auch. Da bewegt sich etwas. Der Wind braust, die Wellen schlagen gegen die Felsen, umspülen die Füße der Frau. Sie steht unbeweglich, ihre Haare flattern. Ein Haarbüschel löst sich, fliegt wie ein Vogel auf die Wellen. Da ist ein Wirbel, ein Strudel zuckerweißer Schaumspritzer, ein Sog, der die Haare nach unten zieht. Der Wind tobt. Ich halte mich am Türrahmen fest. Laut ist es hier von dem Echo der Wellen, die gegen die Steine geschleudert werden. Aus dem Sog steigt ein Kopf, ein Männerkopf. Aufrecht kommt er aus dem Wasser, der Mann mit dem blauen Umhang. So lange steigt er, bis er mit den Füßen auf der Oberfläche ist. Er breitet seinen Mantel weit auseinander. Der Wind greift in die Falten, achiebt ihn von hinten gegen das Ufer. Er ist nicht mehr weit weg, ein paar Meter nur. Der Wind preßt ihn gegen die Frau, die immer noch wie vorhin dasteht und zittert, weil es so kalt ist.
„Hol dir eine Kiste mit den Fischen“, sagt er zu mir. Der Wind hat sich beruhigt. Ich will tun, was er sagt, geh in den Nebenraum und hol die Kiste. Sie stinkt, ist schwer. Ich zerre sie über den Boden bis zum Türahmen.
„Dort bleib stehen!“ sagt er zu mir.
„Ich werde jetzt mit diesem Wesen Stellungen machen,“ redet er weiter. Ich weiß nicht recht, was er meint. Bin auch zu feig, um wegzulaufen.
„Du wirst“, spricht er weiter, „je nachdem, wie gut du die Stellungen findest, eine entsprechende Menge Fische auf uns werfen. Gefällt es dir nicht, wirfst du weniger. Hast du Freude dran, schmeiß ganze Haufen.“ Ich hab ihn vestanden, sag: „Jawohl.“
Er breitet den blauen Umghang auf dem Boden vor dem Wasser aus, zieht der Frau, indem er sich blitzschnell bückt, die beiden Beine unterm Po weg. Sie fällt mit dem Hinterkopf auf das Tuch. Er ist ganz nackt unter seinem Umhang, sieht beinah aus wie Onkel Günther, nur kräftiger. Dann breitet er die Arme wieder aus, wippt auf den Zehenspitzen auf und ab. Kreischt, der Vogel, hebt sich in die Luft, läßt sich auf sie fallen und öffnet ihr die Beine.
„Fische!“ schreit er mich an. „Fische sollst du werfen! Wozu meinst du, daß du hier bist“ Ich hab mich erschrocken, weil er so brüllen kann, greif in den glitschigen Kasten hinter mich, hab einen Fisch in der Hand. Er zappelt, bewegt sich, ich kann ihn nicht festhalten. Er ist schleimig, will aus meiner Hand gleiten. Ich hab ihn grad noch am Schwanz erwischt, hol weit aus und schleuder ihn zu den beiden. Klatsch, ich hab ihn getroffen! — Klatsch — noch einen und noch einen! Drei auf einmal!
„Mehr! Mehr!“
„Da hast du!“
Peng! Gegen sein Gesicht, auf auf den Hintern! Brüste hab ich getroffen! Immer treffe ich!
(…)
Sie sind naß — ich bin naß.
Ich bin glitschig, ich bin ein Fisch,
ein Schleimfisch,
Er ist ein Schleimfisch.
Sie ist ein Fischschleim, sein Fischlein ist sie.
Sie hat mein Fischklein — sein Fischlein.
Ich mach alle Fischlein zu Fischschleim.“
(…)
Auf die Leiber! Und ins Wasser
Werden meine Fische nasser!“
S. 168 – 171
[Bildquelle: Verlag Autonomie und Chaos,
→ Veröffentlichungen 1980 – 2020
Nein, das Buch gefällt mir nicht. Doch dazu ist es zu gut. Es gehört zu denen, die ich nie wieder vergessen werde. Es hat mich abgestoßen und aber sofort wieder zugefaßt. Noch immer zerrt es an mir. Obwohl doch derart deutlich ist, was die Wurliblume will und schon mit zwölf wollte. Nicht nur Zärtlichkeit und Zuneigung, die ihr beide so grausig fehlen, daß sie alle, die sie ihr zu geben versuchen, bestraft. Sondern sie will auch Sex und lieber mit älteren Männern als mit den Jungs, die sie eigentlich lächerlich findet. Aber sie will diesen Sex ohne Penetration, die nicht grundlos nicht nur von den Jungs und Männern, sondern auch von ihr selbst „bohren“ genannt wird. „Gebohrt“ zu werden, tut ihr einfach viel zu weh. Und dennoch zuckt und zuckt ihr Tier. Wie soll sie da noch auseinanderhalten, was Wohl tut und was Leiden?
Wer mich liebt, den mach ich tot,
drum sind meine Strümpfchen rot.
ANH
Oktober 2022
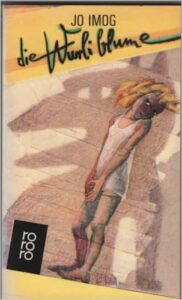
Jo Imog[6]Wolf Donner leitete den – ja, nom de guerre von österreichisch „Ja, ich mag“ ab.
Die Wurliblume
Roman
Bestellen → im Modernen Antiquariat
Neue Ausgabe (2020) → online (PDF
References
| ↑1 | Um ganz von den angeblich unaushaltbaren Szenen in Meere zu schweigen. |
|---|---|
| ↑2 | 1972 bei Rowohlt als Taschenbuch erschienen; mein Exemplar gibt eine Auflage vom 34. bis 43 Tausend (!) an, was — einen absoluten Bestseller bedeutet. |
| ↑3 | Zu meinem Tier ist er [des Mädchens einer Bruder] sehr lieb, er hat nicht so harte Fingernägel [wie sie], seine Fingerkuppen sind größer und fleischiger als die meinen. Dieses Spiel ist wirklich sehr schön, aber es ist so, wie Mutti sagt: „Er ist Egoist, ein Mensch, der alles selber frißt“ und so ist’s auch bei dem Spiel. Er ist längst nicht so ausdauernd wie ich, immer muß ich bei ihm anfangen,.immer ist er es, der stärker schnauft, danach fertigt er mich schnell ab, schenkt mir irgendeinen Dreck, mit dem ich halb so viel anfangen kann wie mit seinem Finger. Wir haben uns eine recht gute Lösung ausgedacht: er drückt seinen Wurm gegen mein Tier, macht auf und ab und hiun und her oder bewegt es in kleinen Kreisen. Ich frag ihn immer wieder, wie die Erwachsenen dazu sagen, und immer wieder vergesse ich das Wort. Ich mag iuhn jetzt nicht mehr fragen, er muß mich ja für dumm halten, so sag ich zu mir: wippen. S. 17 |
| ↑4 | Was sie damit meint, wird weiter unten deutlich; hier bewußt k e i n e „Erklärung“. ANH |
| ↑5 | Sogar die, hier aber nicht durchgängig, falschen Konjunktive lassen sich als Rollenprosa abbuchen. ANH |
| ↑6 | Wolf Donner leitete den – ja, nom de guerre von österreichisch „Ja, ich mag“ ab. |

 Sie sind naß — ich bin naß.
Sie sind naß — ich bin naß.