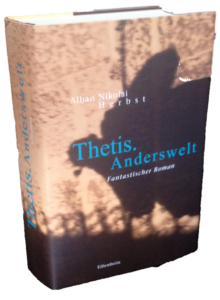[Arbeitswohnung, 9.25 Uhr
Wollny & Kühn, → Duo
Von dieser Einspielung kann ich gar nicht mehr lassen
(meine Kritik liegt schon bei Faust, doch möcht‘ ich nicht „spoilern“)]
Daß Faust meine Horcynus-Orca-Rezension → übernommen hat, zumal mit meiner bösen Bemerkung zum Zentralorgan der AfD für die deutsche Linke[1]Womit selbstverständlich die Junge Welt gemeint ist, ist durchaus nicht ohne Risiko, nachdem meiner Aufforderung, meine dort erschienenen Artikel vom Netz zu nehmen, eine scharfe Absage erteilt worden ist. Die nun entweder dazu führen wird, daß ich prozessiere, wozu ich wenig Lust habe, oder ich gehe nun meiner durchaus vorhandenen Lust nach, dieses politische Schmutzblatt wieder und wieder publizistisch zu attackieren, auf daß dieses mich verklage. Nach Nawalnys Ermordung wäre das sogar ein Ritterschlag. An den ich freilich so wenig wie daran glaube, daß sich die allgemeine literarbetriebliche Bewertung meiner literarischen Arbeit noch ändern wird, jedenfalls zu meinen noch Lebzeiten. Einzelne Ausreißer freilich gibt es; um mir zumindest finanziell Entlastung zu verschaffen, sind es leider nicht genug; dafür müßten sich, zum Beispiel in den Jurys, Mehrheiten finden — für einen „alten weißen Mann“, der außerdem nicht „woke“ ist, quasi ausgeschlossen. (Über dieses „alt“ allerdings muß ich immer wieder grinsen, und der einzige wirklich „weiße“ Mann, dem ich jemals begegnet bin,  war – schwerer Krankheitsgründe wegen – Jassir Arafat, vor einundzwanzig Jahren in Ramallah. (Er: „So, jetzt dürfen Sie etwas sagen.“ Ich: „Nö, jetzt nicht mehr.“ – Das erste und letzte Mal bisher, daß ich einem Feudalherrscher begegnet bin; auf dem Bild links neben ihm sein damaliger, einem Sowjetfunktionär furchtbar ähnelnder christlicher Berater. Daß ich, was ich hatte sagen wollen, nun also doch nicht sagte, hat meine Gruppe später sehr erleichtert. Den Vortrag, den ich in Ramallah hielt und zuvor in Tel Aviv und Be’er Shewa gehalten hatte, sollte ich für Die Dschungel vielleicht einmal aufbereiten.)
war – schwerer Krankheitsgründe wegen – Jassir Arafat, vor einundzwanzig Jahren in Ramallah. (Er: „So, jetzt dürfen Sie etwas sagen.“ Ich: „Nö, jetzt nicht mehr.“ – Das erste und letzte Mal bisher, daß ich einem Feudalherrscher begegnet bin; auf dem Bild links neben ihm sein damaliger, einem Sowjetfunktionär furchtbar ähnelnder christlicher Berater. Daß ich, was ich hatte sagen wollen, nun also doch nicht sagte, hat meine Gruppe später sehr erleichtert. Den Vortrag, den ich in Ramallah hielt und zuvor in Tel Aviv und Be’er Shewa gehalten hatte, sollte ich für Die Dschungel vielleicht einmal aufbereiten.)
Ramallah, Israel, Gaza, Ukraine. Ich zucke nicht zusammen, nein, stelle mich gleichsam subkutan darauf ein, möglicherweise doch noch einen Krieg zu erleben, nicht „nur“ als, sagen wir, Zeuge, sondern als Betroffener, wenn nicht Kämpfender-selbst – und zwar je größer die Wahrscheinlichkeit wird, daß des blassen Lurches (→ Bersarin) Angriffsterror letzten Endes obsiegt, ganz so, wie in Nahost das Kalkül der Hamas aufgegangen ist und sich die halbe wenn nicht dreiviertel Welt unterdessen gegen Israel positioniert, weil in Gaza das Elend in der Tat unerträglich ist; was soll das Land aber tun? Abziehen und das nächste, im übrigen längst und mehrfach schon angekündigte Massaker riskieren? Ich sehe es genauso: Selbst ein Waffenstillstand interim würde den Terror sich neu formieren lassen. Und ich habe Vilém Flussers, als er aus Israel zurückkam, Worte in den Ohren: „Wie soll da jemals Frieden herrschen? Solch ein kleines Land, umgeben nur von Feinden … Lebte ich dort, ich würde es sofort verlassen.“ Und welch eine Tragik! Endlich, endlich möchte er nach Prag zurück, das er 1939 grad noch rechtzeitig verlassen hatte, und jetzt g e h t es, 1991, doch auf der Rückfahrt kommt er in einem Verkehrsunfall um. Indes ich selbst, furchtbarerweise, mich immer wieder bei dem Gedanken erwische, daß eigentlich … die NATO, jedenfalls der Westen … daß wir voller Macht für die Ukraine eingreifen müßten, also selbst in den Krieg ziehen … – „ziehen“, welch ein Euphemismus! Denn wissen doch, was dies bedeuten würde, den atomaren Untergang. Siegen wird da niemand. Ich kann Olaf Scholz sehr gut verstehen. Und mache mir zugleich Gedanken um meine Literatur, mache mir immer noch Hoffnung, Apfelbäumchen, Apfelbäumchen. Wobei, wirklich schreiben tu ich momentan ja kaum; selbst sowas wie das hier, dieses Arbeitsjournal, fällt mir nicht mehr leicht. Hin und wieder schau ich in die → Sappho, bin aber momentan wie gehemmt. Andererseits, Dichtungen haben Jahrtausende überlebt, Tausende Kriegs-, Pogrom- und Massakerjahre, ganze Genozide. In denen waren auch Christen ziemlich gut. Das wird, wenn wir von Hamas und IS sprechen, schnell einmal vergessen. Homo homini bellua.
Da war es ziemlich leicht, fast ein bißchen erlösend, als am Sonntag लक्ष्मी anrief, vormittags bereits, ob ich Lust auf einen Spaziergang hätte. Mir war grad mal wieder, eigener Unvorsichtigkeit wegen, der Laptop abgestürzt, und ich hatte keine Lust, den ganzen Tag mit der Fehlersuche zu verbringen. „Muß mich nur noch rasieren, dann schwing ich mich aufs Rad.“
Das ich vorm Flohmarkt des Mauerparks an einen Baum schloß; da saß die Familie schon am Crêpe-Stand. Nur unser Sohn war nicht dabei, war eben erst aufgestanden. Daß wir jetzt aber wirklich spazierengehen wollten, nervte die Zwillinge ein wenig; sie setzten sich ab. Hätt ich in ihrem Alter auch gemacht, Jugendliche halt. लक्ष्मी und ich drehten unsre Runde, spazierten zum Arkonaplatz noch, da ist der Flohmarkt schöner, weil tatsächlich einer. Am Mauerpark dominieren längst Berufshändler.
Schließlich landeten wir auf der Kastanienallee, es war nicht sehr kalt, wir nahmen draußen den Nachmittagswein, ein Freund kam hinzu wir, plauderten und plauderten, und es wurde spät. Als der Freund wieder ging, beschlossen wir, unsern Sohn in der Kohlenquelle zu besuchen, Kopenhagener Straße, „auf einen letzten Drink“. Er schmeißt den Laden dort, als Job. Seine Mama tat so etwas ebenfalls lang und hat es sehr geliebt; unser Sohn hat es quasi als Gen mitbekommen. Schon erstaunlich, wie die Eltern in den Kindern wiedererstehen, aber anders, völlig anders, seltsam vermittelt autonom. Übrigens mischt er den besten Negroni, den ich je nahm:
 |
 |
So ward’s ein „klassisch“ wunderbarer Sonntag, beide leicht schwankend, brachte ich लक्ष्मी noch nachhaus und schritt durch die Nacht dann heim.
Montagfrühmorgens ging’s mit dem Computer gleich weiter; gelöst das Problem hab ich noch nicht (nach einem Treiber-Update geht das Mikro wieder nicht). War aber irgendwann egal, hielt nur auf. Ich wollte meinen für die Junge Welt geschriebenen Callastext in Die Dschungel übernehmen und stieß, als ich ihn in den Dateien suchte, auf → das da. Was ich erst einmal vorzog, denn an dem Artikel ist doch einiges zu ändern, der allzu aufs Erscheinungsdatum der Zeitung bezogen war, etwa daß 3SAT den anderen, anders als Callas – Paris 1958, tatsächlich 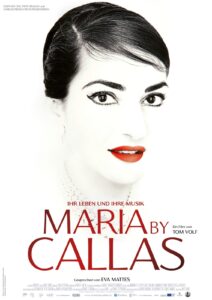 g u t e n Film an dem Abend ausgestrahlt hat; jetzt ist er dort nicht mehr zu sehen, → bei ARTHAUS allerdings sehr wohl. Sowas muß unbedingt berücksichtigt werden. Dazu die ganze Formatiererei. – Dann war dringend die Abrechnung für den Bamberger Lehrauftrag zu schreiben; mein Konto sieht grad mehr nach Sumpf als und sei es bloß ’nem Pfützentümpel aus. Würde wenigstens mal wieder eines meiner Hörstück wiederholt! Nee, macht nicht wirklich Freude. (Ich hatte aber schon schlimmere Zeiten, also in oben behalten, den Kopf.
g u t e n Film an dem Abend ausgestrahlt hat; jetzt ist er dort nicht mehr zu sehen, → bei ARTHAUS allerdings sehr wohl. Sowas muß unbedingt berücksichtigt werden. Dazu die ganze Formatiererei. – Dann war dringend die Abrechnung für den Bamberger Lehrauftrag zu schreiben; mein Konto sieht grad mehr nach Sumpf als und sei es bloß ’nem Pfützentümpel aus. Würde wenigstens mal wieder eines meiner Hörstück wiederholt! Nee, macht nicht wirklich Freude. (Ich hatte aber schon schlimmere Zeiten, also in oben behalten, den Kopf.  Wie schreibt Ralf Schnell → in seinem Aufsatz zu Drawerts Der Körper meiner Zeit und meinem → Aeolia-Gesang?
Wie schreibt Ralf Schnell → in seinem Aufsatz zu Drawerts Der Körper meiner Zeit und meinem → Aeolia-Gesang?
 Wenn nicht alles täuscht, eröffnen die beiden langen Gedichte Kurt Drawerts und Alban Nikolai Herbsts mit ihrer impliziten Poetik der Poesie neue Horizonte. Sie erweitern durch ihre räumliche Dimension die Qualität der lyrischen Formensprache. Sie rehabilitieren das Erzählen für die Lyrik. Sie konfigurieren und kontextualisieren Brüche und Widersprüche, Reflexionen und Selbstreflexionen. Sie visualisieren in ihrer Struktur den Duktus und Gestus der poetischen Bewegung
Wenn nicht alles täuscht, eröffnen die beiden langen Gedichte Kurt Drawerts und Alban Nikolai Herbsts mit ihrer impliziten Poetik der Poesie neue Horizonte. Sie erweitern durch ihre räumliche Dimension die Qualität der lyrischen Formensprache. Sie rehabilitieren das Erzählen für die Lyrik. Sie konfigurieren und kontextualisieren Brüche und Widersprüche, Reflexionen und Selbstreflexionen. Sie visualisieren in ihrer Struktur den Duktus und Gestus der poetischen Bewegung  und des textuellen Rhythmus. Sie steigern die Ausdrucksmöglichkeiten der Poesie durch sinnliche Abstraktion. Sie nehmen auf; bewahren und machen lebendig, was im Roman der Gegenwart verlorenzugehen droht: stoffliche Fülle, Komplexität der Konstruktion und Formenreichtum. Sie weisen der Literatur eine Zukunft.
und des textuellen Rhythmus. Sie steigern die Ausdrucksmöglichkeiten der Poesie durch sinnliche Abstraktion. Sie nehmen auf; bewahren und machen lebendig, was im Roman der Gegenwart verlorenzugehen droht: stoffliche Fülle, Komplexität der Konstruktion und Formenreichtum. Sie weisen der Literatur eine Zukunft.
Gesehen also wird das s c h o n . Nur daß es der Betrieb nicht wahrhaben will, und die verschiedenen „Szenen“ haben’s auch nicht so gern.)
Gut, Planung. Triestbriefe, längeres Telefonat mit meinem Arco-Verleger. Nach der Buchmesse Leipzig (da ich dort kein neues Buch haben werde, ist noch nicht heraus, ob ich nicht einfach nur für einen Tag hin- und abends gleich wieder zurückfahren werde; allerdings habe ich für alle vier Tage die Presse-Akkreditierung bekommen) wird er für eine Woche nach Berlin reisen, die wir für die Schlußredaktion nutzen wollen, also vom 25. bis zum 31. März. Der Premierenort im Herbst steht immerhin schon fest; ich verrate ihn aber noch nicht. Doch in der Tat müssen wir uns schon jetzt um eine Lesungsreise kümmern. Es ist nicht überall gut, wenn ich selber es tu; leider war’s oft unumgänglich, auch bei größeren Verlagen.
Gestern dann Treffen mit Benjamin Stein zum gemeinsamen Mittagessen. Plötzlich sieht er zur Uhr: „Meine Güte, die Kinder … Es ist schon halb vier!“ – Derart intensiv war unser Gespräch, daß ich in den falschen Bus stieg und statt zur SBahn Halensee zur SBahn Charlottenburg fuhr und also den Umweg übern Bahnhof Zoo erst zum Westhafen nahm, wo ich dann endlich in die Ringbahn konnte. Was eingekauft bei PENNY, die Ahlbecker runter, drüben rein und in der Arbeitswohnung erstmal geschlafen, fast bis frühabends sechs. Damit war der Dienstag als Arbeitstag zu streichen. Und heute ist das Arbeitsjournal dran. Ich brauche dringend wieder Struktur, fürchte aber, es wird damit nichts werden, bevor Triest nicht endlich im Satz ist. Dann liegt gleich das nächste Projekt an, Mein Prenzlauer Berg, der Vertrag lag schon in der Post, ich muß jetzt nur noch gegenzeichnen. Auch Elvira hat schon zugesagt. Dieses Buch soll bereits im Frühjahr nächsten Jahres da sein. Es wird ![]() einerseits (und soll’s, wünscht sich → der Verlag) ein persönliches sein, andererseits will aber ich die Geschichte des Kiezes und seine Wandlung erzählen, die ich in den im Frühsommer dreißig Jahren erlebt habe, die ich nun hier wohne. Nebenbei empfinde ich dieses Auftrags wegen auch einen kleinen Triumph angesichts des Umstands, das mich hier nie auch nur eine einzige Buchhandlung mal zu einer Lesung eingeladen hat und sowieso meine Bücher nie führte, von Thalia, Schönhauser Allee-Arkaden, abgesehen; die Kette hat aber mit dem Prenzlauer Berg wenig bis gar nichts zu tun, da wird zentral bestellt.
einerseits (und soll’s, wünscht sich → der Verlag) ein persönliches sein, andererseits will aber ich die Geschichte des Kiezes und seine Wandlung erzählen, die ich in den im Frühsommer dreißig Jahren erlebt habe, die ich nun hier wohne. Nebenbei empfinde ich dieses Auftrags wegen auch einen kleinen Triumph angesichts des Umstands, das mich hier nie auch nur eine einzige Buchhandlung mal zu einer Lesung eingeladen hat und sowieso meine Bücher nie führte, von Thalia, Schönhauser Allee-Arkaden, abgesehen; die Kette hat aber mit dem Prenzlauer Berg wenig bis gar nichts zu tun, da wird zentral bestellt.  Die übrigen Buchhändlerinnen und Buchhändler ignorierten mich, auch wenn sie, etwa bei → Büchner, sehr genau wußten und wissen, daß ich hier lebe. Es ist schon ziemlich jämmerlich. Und nun werde i c h es sein, im wichtigsten Regonalia-Verlag der Stadt und des Landes über den Prenzlauer Berg zu schreiben. Da sei mir etwas Häme wohl erlaubt – und mit Lust zitiere ich hier aus → THETIS eine Stelle, die mich damals schon den Deutschlandfunk gekostet hat (der mir bis dahin entfernt befreundete Redakteur: „So etwas darf man nicht schreiben!“) und die ich ganz sicher auch in das Prenzlauer-Berg-Buch aufnehmen werde:
Die übrigen Buchhändlerinnen und Buchhändler ignorierten mich, auch wenn sie, etwa bei → Büchner, sehr genau wußten und wissen, daß ich hier lebe. Es ist schon ziemlich jämmerlich. Und nun werde i c h es sein, im wichtigsten Regonalia-Verlag der Stadt und des Landes über den Prenzlauer Berg zu schreiben. Da sei mir etwas Häme wohl erlaubt – und mit Lust zitiere ich hier aus → THETIS eine Stelle, die mich damals schon den Deutschlandfunk gekostet hat (der mir bis dahin entfernt befreundete Redakteur: „So etwas darf man nicht schreiben!“) und die ich ganz sicher auch in das Prenzlauer-Berg-Buch aufnehmen werde:
Sie steht also an der Hauswand, von der Fladen und Fetzen blättern. Mißgelaunter Blick auf meine Krawatte. Ich schreite erst langsam an ihr vorbei, dann spontane Kehre ihr zu, den Karabinerhaken zwischen Daumen und Zeigefinger, Vorstoß, hab das geübt, es klickt. Schon der Nasenring in der Öse. Da schnalz ich einmal mit der Zunge. Die junge Dame sprachlos. Ich wend mich um und zieh sie hinter mir her. Sie brüllt los, es muß ziemlich wehtun.
Wenn’s nicht bluten und der Nasensteg halten soll, wird sie mir folgen müssen.
Es ist ganz wunderbares Sommerwetter.
Paar Leuten bleiben stehn und gaffen. Drei Typen applaudieren.
Ich lächle. Und mit meiner Beute immer die Straße entlang. Will meine Geisel sich wehren, reiß ich knapp an der Kette.
Am Helmholtzplatz schäumt grün – besinnungslos und geil nach Erde riechend – der kleine Park. Die junge Dame zetert und jault im Geschlepp. Das wird mir zuviel. Ich löse die Kette aus der Gürtelschlaufe und mach sie mit einem Abusschloß an einem Ring für Hundeleinen fest. »Arschloch!« brüllt meine Freundin. »Beschissenes Arschloch!« Doch sie hält still. Hörte sonst Engel im Himmel, an die sie nicht glaubt. Unter meinen Füßen knirscht der Sand des Weges, zur Seite raschelt Gebüsch, das sehe ich nur, kann’s nicht hören, denn unablässig rattern Automobile, klirren
Scheiben, schnaufen Hydrauliken. Kieksige Schreie. »Äh! Geil!« ruft ein Junge, und als ich mich entfernt habe und am andren Ende des
Platzes noch einmal umdreh, seh ich die Angekettete von einem Pulk Piercing-Freunde umschart.
Literatur ist nicht dazu da, moralisch zu sein; sie inszeniert Fantasien. Selbstverständlich kann man darüber streiten, und frau, ob sie deren Realisierung befördert oder nicht vielmehr, wie ich meine, verhindert, zumindest hemmt. Doch anthropologisch spricht sie die Wahrheit – eine über uns. Und wirft kein versteckendes Tuch darüber. Im Roman ein umgebrachter Mensch ist kein umgebrachter Mensch. Der 1-zu-1-Realismus indessen kapiert’s nicht. So haben wir nun ein Kunstproblem. (Wahrscheinlich hatten wir’s schon immer.)
Ist alles nicht wichtig, die Zeiten sind insgesamt dunkel geworden. Wichtig bleibt, was in den Triestbriefen steht:
Liebt Euch, ach, Ihr Paare dieser Erde, so lange Ihr noch könnt! Begrabt Euch sinnlich ineinander, bevor es Euch und uns alle, in weggerissenen Teilen, uns versuppend oder unerbrannt verbrennend begräbt!
Briefe nach Triest, Lektoratsfassung S.467
Ihr ANH, 17.37 Uhr
References
| ↑1 | Womit selbstverständlich die Junge Welt gemeint ist |
|---|