
Das klingt kompliziert, war aber ein höchst einfacher, weil für Scelsis Musik ziemlich naheliegender Einfall >>>> Markus Feins, der die Reihe 2 x hören für das Konzerthaus Berlin konzipiert hat und als ein cleaner good American boy auch durchführt, dessen (an)ständiges Lächeln die alten Damen glücklich macht und das präzise, spezialisierte Wissen vergessen läßt – und die asketische Schwere, mit der sich die Neue Musik wegabstrahiert hat. Denn Fein ist in allererster Linie einmal Vermittler, viel mehr als Erklärer, und zwar auch dann, wenn seiner Vermittlung eine Reduktion einhergeht, die wider das Geheimnis läuft. Wenn er es aber fertigbringt – und das geschah -, ein an sich eher störrisches Publikum, sei’s des Unverständnisses gegen Neue Musik, sei’s ihrer elitären Gemeinden, dazu zu bringen, geschlossen zu Streichquartett und Sitar den kosmischen >>>> Om-Klang zu singen, dann ist das phänomenal und wäre absolut vermessen, sich über den Mann zu erheben. Selbst Ironie ist fehl am Platz, da sogar ich mitsang, der ich so spontan wie regelmäßig höchst aggressiv reagiere, fordert man mich von einer Bühne herab zum Gruppenklatschen auf. Vielmehr, der ganze in seiner nüchternen Klarheit wunderschöne Werner-Otto-Saal schwang. Wir wurden zugleich in die Musik hinaus- wie in uns selbst hineingeschwungen: Laute zu singen ist anders, als rythmisch die Rahmen zu halten; man atmet, sozusagen, nur noch ein – und atmet eben auch die Musik ein, die Fein vermitteln wollte. Das ist das, ich sage einmal, Kunststück daran. Scelsi wurde nicht mehr nur noch gehört, sondern so, wie er selbst, heißt es, stundenlang immer denselben Ton angeschlagen und sich in ihn versenkt habe, genau so taten nun wir es. Markus Fein nahm Scelsi im Wortsinn beim Wort. Es gibt genügend Äußerungen dieses Komponisten darüber, wie seine Musik zu verstehen sei, ja woher er sie habe; dem mußte nur gefolgt werden. Scelsis Affinität zu fernöstlicher Philosophie, namentlich Indiens und Tibets, ist bekannt, bis hin zu seinem selbstbekannten Glaube an Wiedergeburten; sie langt bis in die Titel, die, so gesehen, geradezu plakativ sind. Insofern lag es praktisch nahe, eine seiner Musiken direkt mit den Klängen des Ostens zu konfrontieren, auch wenn – das ist die Kehrseite – dadurch ein vielleicht doch zu einfaches – banalisiertes – Verständnis erzeugt wird, und zwar um so mehr, je„schlagender” die Höreindrücke sind, so daß ein schon eingehörter Hörer nachher ein wenig das Gefühl hat, an Orffschem Schulwerk mitgewirkt zu haben: funktionale Pädagogik pur. Es war den Musikern denn auch, als Markus Fein sie vorm Publikum befragte, ein gewisses Unbehagen anzuspüren, das sich aber sofort immer zerflatterte, wenn sie wieder spielten – und auch und gerade, wenn sie Teile der kurzen Streichquartett-Sätze zu den fernöstlichen Klängen… ja, ich möchte gern schreiben: improvisierten. Was ganz so freilich nicht stimmt, weil Scelsi seine Musik hat fest notieren lassen und weil wiederum ein Video sowieso improvisieren nicht kann. >>>> Yogendra immerhin, der als „Überraschungsgast” geladene Sitarspieler, versuchte es, blieb aber schon, der Kürze seiner an-interpretierenden Vorträge halber, im klassischen Indien-Standard hängen; das stand einmal sogar derb stanzig über der Streichquartett-Partie. Und die Tanpur wurde letztlich alleine von unserem, des Publikums, Om-Gesumme mit Scelsi legiert. Aber dies war eben auch ein bewußt aufgelockerter Vermittlungs-Abend und nicht eine wirklich konzentrierte Meditation in Sachen
Markus Fein nahm Scelsi im Wortsinn beim Wort. Es gibt genügend Äußerungen dieses Komponisten darüber, wie seine Musik zu verstehen sei, ja woher er sie habe; dem mußte nur gefolgt werden. Scelsis Affinität zu fernöstlicher Philosophie, namentlich Indiens und Tibets, ist bekannt, bis hin zu seinem selbstbekannten Glaube an Wiedergeburten; sie langt bis in die Titel, die, so gesehen, geradezu plakativ sind. Insofern lag es praktisch nahe, eine seiner Musiken direkt mit den Klängen des Ostens zu konfrontieren, auch wenn – das ist die Kehrseite – dadurch ein vielleicht doch zu einfaches – banalisiertes – Verständnis erzeugt wird, und zwar um so mehr, je„schlagender” die Höreindrücke sind, so daß ein schon eingehörter Hörer nachher ein wenig das Gefühl hat, an Orffschem Schulwerk mitgewirkt zu haben: funktionale Pädagogik pur. Es war den Musikern denn auch, als Markus Fein sie vorm Publikum befragte, ein gewisses Unbehagen anzuspüren, das sich aber sofort immer zerflatterte, wenn sie wieder spielten – und auch und gerade, wenn sie Teile der kurzen Streichquartett-Sätze zu den fernöstlichen Klängen… ja, ich möchte gern schreiben: improvisierten. Was ganz so freilich nicht stimmt, weil Scelsi seine Musik hat fest notieren lassen und weil wiederum ein Video sowieso improvisieren nicht kann. >>>> Yogendra immerhin, der als „Überraschungsgast” geladene Sitarspieler, versuchte es, blieb aber schon, der Kürze seiner an-interpretierenden Vorträge halber, im klassischen Indien-Standard hängen; das stand einmal sogar derb stanzig über der Streichquartett-Partie. Und die Tanpur wurde letztlich alleine von unserem, des Publikums, Om-Gesumme mit Scelsi legiert. Aber dies war eben auch ein bewußt aufgelockerter Vermittlungs-Abend und nicht eine wirklich konzentrierte Meditation in Sachen 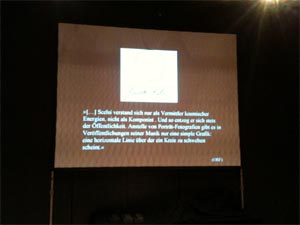 Neuer Musik. Was schon der Umstand indiziert, daß man zwei Fotografien Scelsis auf die Leinwand projezierte, der solche „Personality” abgelehnt hat, um auf einer Distanz zu beharren, die Markus Fein in Hörernähe aufheben wollte und zeitweise tatsächlich aufgehoben hat. Zumal gab die den Abend mitveranstaltende >>>> Körber-Stiftung nachher einen aus. Daran nahm aber ich nicht mehr teil.
Neuer Musik. Was schon der Umstand indiziert, daß man zwei Fotografien Scelsis auf die Leinwand projezierte, der solche „Personality” abgelehnt hat, um auf einer Distanz zu beharren, die Markus Fein in Hörernähe aufheben wollte und zeitweise tatsächlich aufgehoben hat. Zumal gab die den Abend mitveranstaltende >>>> Körber-Stiftung nachher einen aus. Daran nahm aber ich nicht mehr teil.
Was an der betäubend intensiven Spielart des Pelligrini-Quartetts lag und an Scelsis Musik sowieso, die nach ihrer Aufführung verlangt, daß man für sich alleine sei und in die Nacht hinaustritt, um sie, die Nacht, zu hören und wie in sie hinein immer noch Scelsis Töne schwingen. Es sollte doch mit den Musikern noch gesprochen werden, das Publikum eintreten in einen Dialog. Wenn einer aber einen Zen-Meister fragt, was Zen denn sei, und wenn der antwortet, dann, so heißt es, wüßten es beide nicht –
Im Nachklang, jetzt, anderthalb Tage später, bleibt immer noch die Intensität des Streicherspieles erhalten, vielleicht eben deshalb, weil es s o einfach schließlich doch nicht ist, eine Musik zu „erklären” und letztlich auch nicht wünschenswert, sie der Restlosigkeit anheimzugeben. Doch bleibt auch der hohe Reiz des Ambibalenten, das in Markus Feins musikpädagogischem Ansatz steckt, indem hier eine Pädagogik für Erwachsene als zwischen Entertainment und Introspektion aufgespannte Talkshow inszeniert ist, was sich sehr wohl dazu eignet, den Hörern Neue Musik zu erschließen – und ihr sie. Wobei das Unternehmen in einer Tradition steht, die bereits in den Achtzigern bei den Frankfurtmainer „Happy New Ears” das ganze Schauspielhaus zu füllen wußte und immer noch zu füllen weiß. Bis auf den letzten Platz.
[Für den erkrankten Antonio Pellegrini sprang an der ersten Geige Friedemann Treiber ein. Meinen eigenen Text zu Giacinto Scelsi, für die FAZ geschrieben, finden Sie >>>> dort. Und meinen Gedichtzyklus zu Scelsi, eine Art Hommage, finden Sie in >>>> Der Engel Ordnungen. Sollten Sie diesen Gedichtband im Buchhandel nicht bekommen, können Sie ihn für 20 Euro >>>> direkt bei mir bestellen.] 

