[Geschrieben für die Weltwoche, Zürich
Dort erschienen im September/November 1996
Interessanterweise ist die Taschenbuchausgabe
nicht mehr bei Rowohlt, sondern >>>> Heyne
So wird Gold anheimgegeben]
Kazuo Ishiguro wurde mit dem Roman „Was vom Tage übrigblieb“ so berühmt, daß er noch berühmter durch den gleichnamigen Kinofilm wurde, der wiederum eine Ausgabe als „Buch zum Film“ auslöste, welche sich nun von diesem Kinoruhm nährt. Allerdings ist wohl so etwas, seit es sogar „Der Zauberberg“ bis zum Buch zum Film bringen konnte, mitlerweile gängiger Marketing-Ton. Die mit englischer Zurückhaltung und warmer Ironie erzählte Geschichte war – zumal bei einem, wie die englische Presse nicht frei von kolonialer Hoffart betonte, „Japaner“ – von solch sozialkritischer Eleganz aus dem ironischen Geiste des britischen Humanismus, daß sich davon konnte vielerlei Mensch aufs süßeste angesprochen fühlen. Gewissermaßen wurden die traurig-melancholischen Lebenslügen des Mr. Stevens zum tea und ihre indirekte Enthüllung zu den biscuits gereicht.
Nicht so, überhaupt nicht, in Kazuo Ishiguros neuem Roman „Die Ungetrösteten“, 1995 bei Faber & Faber in London und nun in der deutschen Übersetzung von Isabell Lorenz bei Rowohlt in Reinbek erschienen. Hier sind von allem Anfang an Stimmung und Ästhetik härter, moderner – nein, radikal. Das hat die englischsprachige Kritik großenteils wenn nicht gerügt, so doch bedauert. Zumindest hat sie’s befremdlich gefunden. Bloß soll es befremdlich auch sein.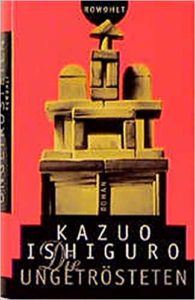
Nämlich sei er, erzählt Ishiguros Held Mr. Ryder, bei seiner Ankunft im Hotel nicht willkommen geheißen worden. Besonders dem Taxifahrer sei das peinlich gewesen. – Moment mal: – dem Taxifahrer?, möcht’ ich jetzt fragen. Doch liest man anfangs über sowas hinweg. Auch irritiert den Leser noch nicht, daß sich der Taxifahrer auf die Suche nach einem Hotelangestellten begibt. Woraufhin jemand an der Rezeption erscheint, Mr. Ryder zu begrüßen. Da kann sich der Taxifahrer zu seinen Pneus und unsere kurze Irritation kann sich ins Verschwinden zurückverfügen. Außerdem überschwemmt der Rezeptionsmensch einen nun mit derart distanzlosen Beteuerungen und Neuigkeiten, daß die Zeit nicht ist, sich darüber zu wundern, mit diesem Menschen so bekannt und überhaupt mit den städtischen Vorgänge intim zu sein. Kaum sinnt man jetzt dem hinterher, belegt uns schon – indessen er unsere Koffer trägt – ein älterer Hoteldiener mit Suadenfeuer und steht nicht einmal an, uns zu einem Kaffee im trauten Kreise seiner Kollegen einzuladen. Ehe wir von nun wieder diesem Schock geheilt sind, fällt uns ein, und zwar des langen und breiten, daß Gustav, der Hoteldiener, sich ständig Sorgen um Tochter und Enkel mache.
Da stoppt man in der Lektüre: Was?! Woher weiß denn unser Held alledies? Gustav ist ihm doch erst vor fünf Minuten zugeteilt worden!
Der Widerspruch stört unsere Identifikation mit dem Erzähler ziemlich. Darüber hilft auch die perfide Ich-Form nicht hinweg, in der Ishiguro das alles dahinplätschern läßt. So realismusflüssig rinnt sein Stil, daß man anfangs noch denkt, man habe einen Naturalisten bei einem groben Fehler ertappt. Und ahnt nicht, daß sich, während wir noch die Köpfe schütteln, um unsren Hals eine Schlinge legt. Die zieht sich zu und dreht uns schon auf in Ishiguros Spirale erzähllogischer Ungeheuerlichkeiten. Nämlich bittet wenige Seiten später der Hoteldiener den Gast, doch einmal mit seiner, Gustavs, Tochter zu sprechen, sie sitze immer im Ungarischen Café, und da jener ja sowieso in die Altstadt schlendern wolle… Mr. Ryder, anders als wir, merkt den Widersinn nicht. Zwar erkennt er Sophie, die Tochter des Hoteldieners, im Café nicht gleich, sie dafür aber ihn: Sie ruft ihn herbei und erzählt, sie habe das Haus gefunden, nach welchem sie, Sophie, und er, Mr. Ryder, so lange gesucht hätten… Mr. Ryder’s Antwort darauf? „Ah ja. Schön.“ Denn Tatsache sei, daß mir Sophies Gesicht (…) langsam aber sicher immer vertrauter wurde, bis ich schließlich überzeugt war, mich an frühere Gespräche über den Kauf eines solchen Hauses (…) erinnern zu können.
Nicht nur dies. Selbst der Grund seines Aufenthaltes wird Mr. Ryder erst nun klar, er ergibt sich erst. Ganz genau so bilden sich jeweils Beziehungen zu den Romanpersonen, fußen gleichwohl auf jahrealten Gemeinsamkeiten. – Es irrt, wer diesen Widerspruch durch die Annahme aufzulösen vermeint, Ishiguro erzähle die Geschichte einer Verdrängung. Bewahre! Zwar haben die Personen durchaus psychologisch fundierte Motive, aber die erscheinen als Spontanmutationen; Geschichte selbst stammt aus dem Nichts.
Auch wird ganz allmählich erst klar, worum es in dieser Stadt überhaupt geht: Die Bürger haben das Vertrauen in ihr musikalisches Zentrum, repräsentiert durch einen Herrn Christoff, verloren und wollen den nunmehr durch einen Herrn Brodsky ersetzen, wobei es ihnen gar nicht so sehr darauf ankommt, ob stimmt, was Brodsky oder Christoff vertreten, sondern daß sie es glauben. Der Pianist Ryder soll sie in ihrer Entscheidung bestärken. Sie sollten wissen, daß Mr. Brodsky schon recht lange bei uns lebt, und in all den Jahren hat nie jemand gehört, daß er über Musik gesprochen, geschweige denn Musik gemacht hätte. (…) Um ganz ehrlich zu sein, bis vor kurzem haben alle hier Mr. Brodsky nur zur Kenntnis genommen, wenn er sich sinnlos betrunken hatte und dann schreiend durch die Stadt schwankte. Was eine Bürgerinitiative der Besseren Stände nicht davor schützt, ihn für einen genialen Dirigenten halten zu wollen, der er dann – wenn auch nur für zwei sinfonische Sätze – tatsächlich wird.
Konstituiert ist dieses Buch ganz offensichtlich surreal, nämlich vermittels einer Psycho-Logik, die sich aus Traumbildern und künstlerischen Vor-Bildern speist, seien es solche von Dalí oder Buñuel – es gibt eine enge Verwandtschaft mit dessen obskurem Objekt der Begierde -; sei es, daß einen die Hoteldiener-Typologie mitunter an Kafka denken läßt. Völlig verrückt sind die in diesem Buch geschilderten Räume. Bald entdeckten wir, daß Sophie in eine winzige Seitengasse eingebogen war, deren Öffnung (…) kaum mehr als ein Mauerriß zu sein schien. Die Gasse fiel so steil ab und sah so eng aus, daß es kaum möglich schien hindurchzugelangen (…). Derweil Mr. Ryder die Tochter des Hoteldieners dahindurch verfolgt, begegnet ihm selbstverständlich ein Jugendfreund, mit dem er ebenso selbstverständlich plaudert, bis ihn die Gasse auf eine dunkle, verlassene Straße hinausführt. Es wehte ein kräftiger Wind, und die Stadt schien weit weg zu sein. (…) Die Straße war eine ganze Weile steil abgefallen, doch jetzt wurde sie eben, und wir befanden uns an einem Ort, der nach einem verlassenen Bauernhof aussah. Überall um uns herum im Mondlicht erhoben sich die dunklen Umrisse von Scheunen und Nebengebäuden.(…) Irgendwo in der Ferne fing ein Hund an zu bellen und hörte dann auf. Ein ähnlicher Weg ist einzuschlagen, will Mr. Ryder an einem ihm neuerdings wichtigen Empfang teilnehmen. Die enge Altstadt wird zum Acker, den fährt man Ewigkeiten mit dem Auto entlang, erreicht einen Turm, darin findet die Geselligkeit statt; aber als Mr. Ryder zurück ins Hotel will, muß er nur einen seitlich geführten Korridor nehmen, schon steht er wieder in der Empfangshalle. Rückwege sind geradezu prinzipiell von Hinwegen verschieden, tatsächlich ist diese Mauer, wenn ich es einfach so sagen darf, wirklich typisch für diese Stadt. Überall werden einem völlig absurde Hindernisse in den Weg gelegt. Imgrunde sind Ishiguros Räume Funktionen von Zeit und allee Wege irreversibel. Die Spielorte gleichen Stätten von Gemütszuständen: seelischen Projektionen von Raum. Deshalb können disparateste Gelände gänzlich umstandslos ineinandergleiten. Etwa wenn eine Szene im Kino unversehends – das heißt über ein paar Slapstick-Loopings hinweg – in die Genre-Skizze einer Pokerrunde überführt wird, derweil auf der Leinwand eine Mischung aus Kubriks 2001 und Hoffrings Futureworld läuft, einer berühmten low-budget-Produktion, in die Ishiguro zu allem noch einen Clint-Eastwood-Streifen montiert: (…) wir näherten uns der berühmten Szene, in der Yul Brunner den Raum betritt und Eastwoods Schnelligkeit mit der Waffe auf die Probe stellt, indem er vor ihm in die Hände klatscht. Dies ist nicht nur ein locker eingestreuter Scherz für Cineasten, sondern ironische Anspielung auf die den ganzen Roman strukturierende Poetik und in der Tat von „Was vom Tage übrigblieb“ ästhetische Dezennien entfernt. Imgrunde sind selbst die „gehobeneren“ Anspielungen, etwa an Kafka, kolportiert.
Dem entsprechen die Geschichten der Romanfiguren sehr genau. Alle leben sie absurd-verzweifelt, und gerade, wenn sie einander die Wünsche und Hoffnungen hintertreiben, ist das im Banalen verloren. Niemals lehnt sich hier jemand auf. Hatte Josef K. noch versucht, sich zu verteidigen oder doch wenigstens seinen Prozeß voranzutreiben, so spielt Mr. Ryder alles geradezu mechanistisch mit. Ungereimtheiten vergißt er im Moment, da sie ihm auffallen. Noch der schlimmste Wahnwitz wird ins Selbstverständliche zurechtinterpretiert. Die Figuren des Romans sind reine Gegenwart; brauchen sie Motive, so erfindet die sich flugs. Es ist wirklich merkwürdig, Mr. Ryder, aber es geht jedesmal so. Kaum hat der Tag begonnen, kommt diese andere Sache, diese Kraft, und übernimmt. Und was auch immer ich tue, alles zwischen uns geht (…) nicht in die Richtung, die ich wollte.
Ishiguros scheut durchaus nicht den Kitsch. Aber immer wieder bricht er ihn, beispielhaft in der bis zur Leserrührung hochgetriebenen Liebes- und Lebensgeschichte von Miss Collins und Mr. Brodsky. Das denunziert nicht, sondern führt zu extremen Innenspannungen. Ich nehme es ihr nicht übel, daß sie mich verlassen hat. (…) Aber was ich ihr übelnehme, ist, daß sie nicht Besseres daraus gemacht hat. (…) Ich habe es erreicht, daß sie mich haßt, können Sie sich vorstellen, was mich das gekostet hat? Ich habe ihr ihre Freiheit zurückgegeben, und was fängt sie damit an?<(…) Sie hat sie nicht einmal ergriffen, die Chance, die ich ihr gegeben habe. Der hier Klage führt, kann so wenig wie Mr. Ryder wissen, daß keine Figur in diesem Erzählkosmos die Chance hat, sich nach Willkür zu verhalten. Die Ästhetik dieses Buches ist wegen ihrer Konsequenz für jede Person ein Verhängnis in geradezu klassischer Manier. Das funktioniert oft über eine perfide Form von literarischer Gemütlosigkeit: Als Mr. Brodsky allem Anschein nach ein Bein abgenommen wird (nachts, auf der Straße, ohne Betäubung und vermittels einer Säge), kann der darob entsetzte Mr. Ryder gleichwohl telefonieren und sich bei Sophie über den psychischen Druck beklagen, den ihm das anstehende Wiedersehen mit seinen Eltern macht. Ishiguro benutzt, um tragische Verwicklungen zu formen, Verleugnungsbewegungen als ästhetische Mittel.
Typisch ist auch die Beziehung Gustavs zu seiner Tochter. Einst hatte der Hoteldiener, um bei einer Arbeit nicht gestört zu werden, auf Fragen seiner damals noch kleinen Tochter einfach geschwiegen. Sophie ist mir dauernd hinterhergelaufen, fragte dieses, bot an, mir jenes zu bringen, wollte mir helfen. Ich habe (…) die ganze Zeit kein Wort gesagt (…), es war wirklich nicht einfach, ich habe mein kleines Mädchen mehr als alles auf der Welt geliebt, aber ich habe mir gesagt, ich müsse stark sein. So daß das Kind seinerseits zu schweigen anfängt. Da habe ich mir gesagt, wenn sie sich so benehmen will, dann wird sie schon sehen, wohin das führt. (…) Ich nehme an, von da an ist es einfach so weitergegangen. Und also haben Tochter und Vater bis heute, Jahrzehnte später, kein Wort mehr aneinander gerichtet. Zwar sehnen beide herbei, das endlich wieder zu tun, aber sie finden aus ihrem Ritual nicht mehr heraus.
Die infame Kunst Ishiguros besteht darin, daß gerade die haarsträubendsten Grotesken eben nicht grotesk, sondern fiebrig-böse und deshalb realistisch wirken. Und daß selbst bei abgebrühten Lesern ein Bedürfnis nach happy-ends aufkommt, nimmt dem so kalkulierten Text seine Abstraktheit. Die kurzen Dialoge zwischen Mutter und Kind dienen dem ebenso wie die großen Klagereden Mr. Brodskys oder des Hotelchefs Hoffman. Also warum sagst du nicht Hallo zu Mr. Ryder?“ – Boris schaute mich einen Moment lang an und sagte dann mürrisch: „Hallo.“ (…)- „Bitte, ich möchte nicht Anlaß für irgendwelchen Ärger sein“, sagte ich. „(…) Mich würde es übrigens auch interessieren, etwas über dieses Flugzeug zu hören.“ – „Das ist kein Flugzeug“, sagte Boris gequält. „Das ist eine Fähre für den Raumflug.
Gerade solche scheinbar banalen wie naturalistischen Details geben dem Roman Geruch und bewahren ihn davor, als Parabel gelesen zu werden. Denn die Parabel ist der Tod jedes Buches. Gerade die Fantastische Literatur lebt davon, daß sie konkret aufgefaßt werden muß. In „Die Ungetrösteten“ ist das um so mehr notwendig, als Ishiguros Sprache – jedenfalls in der deutschen Übersetzung – an sich nichts Magisches, ja nicht einmal Aura hat. In „Was vom Tage übrigblieb“ war das anders, war aber auch, wegen des melancholischen Sujets, viel leichter zu erreichen. Der neue Text darf nicht ironisch-liebevoll sein. Er braucht harsche, undistanziert-knappe, ich möchte fast sagen: „positivistische“ Sätze. Selbst Witze erlaubt sich Ishiguro nur selten, etwa anläßlich des Nachrufs auf Brodskys Hund: Ihr Bruno ist (…) innig geliebt worden von denen unter uns, die ihn in der Stadt seinen Geschäften haben nachgehen sehen. Das ist hübsch, aber der Autor läßt uns nicht in humorige Entspannung flüchten, sondern treibt uns durch seine böse, merkwürdig schiefe Geschichte weiter und weiter. Erst gegen Ende des Buches wird die Grammatik komplexer. Dann glüht auch die bis hierher eher nüchterne Sprache aus der Anderen Seite herüber, die eigentlich eine Innere ist. Denn in uns spielt sich ab, wovon Kazuo Ishiguro berichtet. Und weil dem so ist, ist auch, daß Mr. Ryder aus Anlaß eines in einer Straßenbahn servierten Kalten Buffets diesen eigentümlichen Umstand wie andres tatsächlich beklemmendes Geschehen kurzerhand vergißt, etwas, das uns zutiefst beunruhigen sollte. Unruhe indessen ist für alle ein Genuß, die Wagnisse lieben.
ANH, September 1996
Frankfurt am Main
Kazuo Ishiguro
Die Ungetrösteten
Roman
738 Seiten, gebunden
Rowohlt Verlag Reinbek b. Hamburg
>>>> Bestellen
