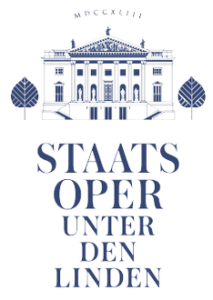[NACHTRAG, Dezember 2023
 Geschrieben für Faustkultur,
Geschrieben für Faustkultur,
dort im Februar 2020 erschienen,
dort unterdessen leider nicht mehr
online.]
|
Hier wurde in der Tat aus Liebe, ja Hingabe |
Während die Marschallin (Carmilla Nylund) am Arme Faninals (Roman Trekel) abgeht, läßt sie bekanntlich ihr Taschentuch fallen, das ihr – in Hofmannsthals Libretto „Ein kleiner Neger“, hier aber „Mohammed“ genannt – Dienerbub sucht, und er, ich zitiere, „hebt es auf, trippelt hinaus“. Wobei der Schlußvorhang fällt. Nur ist es bei Heller kein Bub, sondern, in marokkanischer Livree, ein dunkelhäutiger Jüngling etwa gleichen Alters wie Octavian (Michèle Loisier), der Marschallin im ersten Aufzug siebzehnjährigem noch-Geliebten. Mal abgesehen davon, daß derartiges heutzutage bereits unter „Mißbrauch“ liefe, gibt sich hier wunderschön Geschlechtslockung wieder: Der junge Mann hebt das Taschentuch auf und riecht ergriffen daran. Zuvor indes hatte Octavian selbst es aufheben wollen, und es ist ausgerechnet an dem bis dahin noch Mädchen Sophie, ihn daran zu hindern. Unversehens erhebt sie, die jünger noch als er ist, ihren eigenen Anspruch auf ihn und macht ihn gelten. So glaubhaft emanzipiert steht ihr Wille, auch Geschlechtswille, da! Dabei wäre es, folgen wir der Deutung, Octavians letzte Möglichkeit gewesen, zurück zur Marschallin zu kehren. Er müßte ihr nur das Taschentuch bringen. – Hinwiederum Hellers Wägung in dem hinreißend gestalteten Programm-, nein, nicht -heft, sondern -buch, es kehrte der – von ihr „Bub“ genannte – Junge ohnedies zu ihr zurück, sobald seine schwärmerische Erhitzung für Sophie verflogen sei, halte ich für bizarr – allein schon ihres Stolzes wegen.
Hinter dem dunkelhäutigen Jüngling aber, die Nase noch im Taschentuch, sehen wir den Kosmos in Form eines sich in Spiralen ins Schwarze Loch der Ewigkeit zusammenziehenden Sternenhimmels.
Doch erstmal zur Musik.
Nie zuvor habe ich des dritten Aufzugs Vorspiel derart prachtvoll, raffiniert, spöttisch, auftrumpfender, kecker und zugleich so durchsichtig dargebracht erlebt wie hier, konnte nur die Luft anhalten. Es tat ihm ausgesprochen gut, daß es nicht bebühnenbildert wurde. Solch musikalischen Zug brachte die Staatskapelle aber bereits seit spätestens dem zweiten Aufzug zu Gehör: enorme Farbenpracht bei gleichzeitig einem nicht tatsächlichen, aber so empfundenen Crescendo, Steigerung um Steigerung. Noch die feinste instrumentale Ziselierung wurde Klang. Nur im ersten Akt hatte ich den Eindruck, es werde bisweilen ein wenig geschleppt (typische Anweisung Gustav Mahlers auf zahllosen Partiturseiten: nicht schleppen!). Dadurch schien mir auch die Dramaturgie der Personenführung hin und wieder, wie man bei Pianisten sagt, auf den Tasten zu kleben. Einige Bekannte, mit denen ich sprach, teilten meinen Eindruck, obwohl er, wie ich nun weiß — falsch ist. Das Tempo war völlig in Ordnung. Die empfundene Länge mag auch damit zusammenhängen, daß die unvertraute Langfassung aufgeführt wird. Schon der erste Akt dauert 1h 22min. Nur kann es damit allein kaum zusammenhängen, daß, so prächtig Frau Nylund immer auch sang und wie präsent sie dabei war, etwa die berühmte Zeitarie nicht jene Ergriffenheit erzeugte, wie es selbst zweitklassigen Inszenierungen beinah durchweg gelingt. Und diese hier gehört, die Sänger und Musiker sowieso inklusive, in den allervordersten Rang. Ich weiß also nicht, woran es lag – bislang nicht; ich werde mir die Inszenierung ganz gewiß noch zweidreimal anschauen und vielleicht dann klarer sehen. Aber ich war nach dem ersten Aufzug auch wohl meiner Erwartungen wegen fast ein bißchen enttäuscht, meines durchaus Entgegenfieberns halber, mit dem ich die Lindenoper betrat.
Wie auch immer, die Sache wollte erst nicht recht in die Gänge. Schon empfand ich Schwächen der Personenführung, etwa wenn sich zum Lever die gesamte Bittsteller- und Unterhaltungsbagage bei der Marschallin einfindet, aber es bleiben nicht immer, was doch die inszenatorische Lust macht, alle auf der Bühne, sondern verschwinden teils, wenn musikalisch nicht gebraucht, und kehren zum neuen Einsatz zurück. Dabei wissen gute Regisseurinnen und Regisseure, gerade sie szenisch prima zu beschäftigen, auch wenn jemand grad nicht „dran“ ist. Wiederum musikalisch geht es hier manchmal nur um ein kaum merkbares Anziehen des Tempos. Achtelsekunden können darüber entscheiden, ob ein szenischer Einsatz gelingt – hier etwa, als der Lerchenauer Ochs (Günther Groisböck), während die Marschallin frisiert wird und ihr ein Belcantosänger vorsingt, diesem durch einen harten Schlag mit Brüllruf das ergreifende Finale versaut (von Strauss, der Belcanto überschätzt fand, verhöhnend so geschrieben). Zudem problematisch war schon der erste Einsatz sowohl Octavians als auch Frau v. Werdenbergs. Mag es zu jenem noch passen, der ja „feurig“ singen soll und also ruhig etwas überdrängen darf – der „Wiener Königskobra“ (Heller) steht es nicht. Allerdings verlor sich bei beiden das Tremolo schnell, in Frau Nylunds großer Stimme fast sogar ganz. (Bei Hildegard Behrens trat es nach ihrer berühmten Salome von 1977 auf, die sie unter Karajan entgegen des Rates Elisabeth Schwarzkopfs zu früh gesungen hatte, wenn auch bislang uneingeholt: das Opfer einer großen Stimme auf der Opferbank der Kunst.) Das Problem ist nur, daß es Stücke gibt, in denen frau wie man vom ersten Ton an makellos sein muß, sonst zerstört es alles Folgende, und es braucht eine Pause, etwa die zum nächsten Akt, um den Schaden auszuwetzen. – Ich weiß, daß meine Forderung nicht menschlich ist, nur ist das eine soziale, nicht aber Kategorie der Kunst. Die ist, was Politik nicht sein darf: unerbittlich.
Und dann das Schlußbild von Akt I! Was um alles in der Welt hat Heller oder seine Berater geritten, die Marschallin da ein Bild, das Octavian von ihr gezeichnet, oder dieses Jünglings selbst, in immer kleinere Schnitzel zerreißen und die sich auf die Füße rieseln zu lassen? Plakativer – aber auch, was die Fürstin anbelangt dümmer – konnte es nicht kommen. Haltung, siehe unten, hat man auch vor sich selbst.
Ich schimpfe, ja. Dennoch ist die Inszenierung groß, sogar sehr groß – und das nicht nur des beeindruckendsten, sowohl stimmlich wie sängerisch, Ochs von Lerchenau, den ich jemals sah und hörte.
Bebildert ist Akt I mit dem zur vorletzten Jahrhundertwende in Wien en voguen „Japonismus“: „Kaum einer, der nicht glaubte, in Japan verloren Geglaubtes zu erkennen“ (Heller im Programmbuch). Freilich geht das über die bekannten Ausstattungen dieses Aktes nicht wirklich hinaus, erinnert sogar an Götz Friedrichs hinreißende – über Jahrzehnte so gut wie unveränderte gespielt –, leider längst abgesetzte Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin. (Zur letzten Vorstellung, Karen Armstrongs Abschied, fielen die Bühnenbildstücke längst auseinander.) Bei Hausner und Heller ist es tatsächlich nur Bild. Man erfreut sich seiner, aber ein wirkliches Surplus zum nach wie vor wirksamen Entwurf Alfred Rollers, von 1911, kann es aus möglicherweise prinzipiellen Gründen nicht gewinnen.
Das wird mit dem zweiten Aufzug komplett anders, auch wenn Faninals „Stadtpalais“ eher an einen Museums-, ja, -tempel erinnert, der aber deutlich zeigt, wes‘ Kind der Fin de Siècle war: unter der aufgeschönten Oberfläche militärisch-brutal bis in die Organe. Da ist es nicht nur eine hinreißende Idee, sondern auch als Umsetzung grandios, >>>> Klimts riesiges Beethovenfries zum Dekorationsstück zu machen. Vor, d.h. unter ihm sind alle Menschen wirklich klein. Den Raum ausfüllen kann tatsächlich nur der auch kunstbanausige Ochs, dessen mit Gier gepaarte übergriffige Geilheit im sterilen Protzensemble des faninalschen Hauses auf vertrackte Weise für die Menschlichkeit steht – und zwar auch dann, wenn Sophie dieses Mannes anmachender Grobheit wegen von Octavian verteidigt werden muß. Daß der Vater in seiner Aufsteigerwut nichts merken will, ist da nur Indiz. Auch die erstrebte Aristokratie heiratet(e) ja nach Machtkalkül und nicht nach Neigung, schon gar einer „romantischen“. Hier kommt Heller Hofmannsthals Intentionen sehr viel näher, als es den allermeisten Regisseurinnen und Regisseuren sonst gelang; selbst Götz Friedrich und Otto Schenk vermochten es nach meinem Dafürhalten nicht. Der Dichter selbst wollte seine als Ochse benamste Figur als „halb Fuchs halb Schwein” verstanden wissen, und nicht von ungefähr, bei all ihrer Verachtung, erinnert ihn die Marschallin am Ende, als sie von ihm verlangt, sich bei dem offenbaren Qui pro quo „halt gar nichts zu denken.“ Sie drückt es im indirekten Imperativ aus: „Mach‘ Er bonne mine au mauvais jeu: So bleibt Er quasi doch noch eine Standsperson.“ Bei Wolf v. Niebelschütz nennt es der nach Talleyrand und de Godoy geformte Graf Godoitis, noch im Untergang, Noblesse“, genau die mit der Marschallin berühmten Worten „mit leichtem Herz und leichten Händen halten und nehmen, halten und lassen“ innigst verwandt ist. Der gichtgeplagte Minister Godoitis erklärt sich distanziert wie folgt: „… ich bin quelque chose de grand auch dem Schicksal gegenüber singulier, solitaire bis in die Knochen und wünsche, mich stilvoll abzuheben.“ Mit Günther Groissböck steht nun der erste mir begegnete Ochs auf der Bühne, der bei all seinen Furchtbarkeiten das Zeug hat, dies auch zu tun, weil auf der anderen Seite gerade dadurch die Gemeinheit seiner Anmaßungen nur umso deutlicher, ja unerträglich zutage tritt. Allein, dies hinbekommen zu haben, hebt Hellers Inszenierung weit über viele andere hinaus, die diesen, sagen wir, Wienervorstadts-Weinstein oft noch als witzig durchgehen lassen.
Der dritte Akt wartet schon gleich mit einem Einfall auf, der sowohl Hofmannsthals und Straussens Zeit entspricht als auch extrem bühnenwirksam ist und mit dem Japonismus des ersten Aufzugs korrespondiert: Die sog höheren Stände Wiens schätzten es, sich Palmenhäuser anzulegen, in denen sie auch dinierten Da fragte Heller nun mit Recht – übrigens gegen Hofmannsthal, der nüchtern von einem „Gasthaus“ schreibt – was für ein Kammerzoferl an einem Beisl so besonders sei, daß sie sich dahin einladen lasse. Tatsächlich mietet Ochs ein solches Palmenhaus als Ort des Tète-á-tètes, und hier nun kann  Hellers Fantasie losgelassen in die Zügel schießen, die sonst eher straff zu halten sind. Es ist eine für ihn autobiographische, sagen wir, Hommage, daß er den nunmehrigen Ort des Geschehens mit der → Folklore seines gegenwärtigen Lebensmittelpunkts, Marokko, ausstatten läßt – vom hineinerrichteten Zelt, das das Bett verbirgt, bis zu den typischen Deckeln über den aufgetragenen Speisen. Außerdem kann da der von Octavian inszenierte Ochs-Eschreckungs-Spuk vermittels jagender Schattenrisse von Ratten gespenstern; sogar eine riesige Spinne hängt rechts herunter, und dem Zirkus wird mit geisterbahnähnlichen Erscheinungen die Referenz erwiesen. Dazu expressiv ausbrechend die Musik. Das ist zwar totales Kintopp, aber als Groteske derart passend, weil es eine (hin)reißend gespannte Seilbrücke an das, ja, Erscheinen der Marschallin knüpft. Auch daß Heller die Idee kam, die angeheuerten Frätzchen ihre „Papa“-Rufe proben zu lassen, was ebenfalls nicht im Libretto steht, so daß diese Rufe in die Musik einfach, quasi wie O-Töne, hineinplärren und ihr so eine zusätzliche, nicht komponierte Farbe verleihen, ist von schlagender Klangevidenz. Spätestens nach Frau v. Werdenbergs Auftritt kann nun nichts mehr schiefgehen. Und am Ende – beim Terzett sowieso (es beginnt bereits mit „Ich weiß auch nix“ … die Marschallin! … „nix“!) – spüren wir alle, daß, wie es Hofmannsthal in seinem „Ungeschriebenen Nachwort“ von 1911 formulierte, der Musik „die Trauer der Marschallin ebenso süßer Wohllaut (ist) wie Sophiens kindliche Freude, sie kennt nur ein Ziel: die Eintracht des Lebendigen sich ergießen zu lassen, allen Seelen zur Freude.“
Hellers Fantasie losgelassen in die Zügel schießen, die sonst eher straff zu halten sind. Es ist eine für ihn autobiographische, sagen wir, Hommage, daß er den nunmehrigen Ort des Geschehens mit der → Folklore seines gegenwärtigen Lebensmittelpunkts, Marokko, ausstatten läßt – vom hineinerrichteten Zelt, das das Bett verbirgt, bis zu den typischen Deckeln über den aufgetragenen Speisen. Außerdem kann da der von Octavian inszenierte Ochs-Eschreckungs-Spuk vermittels jagender Schattenrisse von Ratten gespenstern; sogar eine riesige Spinne hängt rechts herunter, und dem Zirkus wird mit geisterbahnähnlichen Erscheinungen die Referenz erwiesen. Dazu expressiv ausbrechend die Musik. Das ist zwar totales Kintopp, aber als Groteske derart passend, weil es eine (hin)reißend gespannte Seilbrücke an das, ja, Erscheinen der Marschallin knüpft. Auch daß Heller die Idee kam, die angeheuerten Frätzchen ihre „Papa“-Rufe proben zu lassen, was ebenfalls nicht im Libretto steht, so daß diese Rufe in die Musik einfach, quasi wie O-Töne, hineinplärren und ihr so eine zusätzliche, nicht komponierte Farbe verleihen, ist von schlagender Klangevidenz. Spätestens nach Frau v. Werdenbergs Auftritt kann nun nichts mehr schiefgehen. Und am Ende – beim Terzett sowieso (es beginnt bereits mit „Ich weiß auch nix“ … die Marschallin! … „nix“!) – spüren wir alle, daß, wie es Hofmannsthal in seinem „Ungeschriebenen Nachwort“ von 1911 formulierte, der Musik „die Trauer der Marschallin ebenso süßer Wohllaut (ist) wie Sophiens kindliche Freude, sie kennt nur ein Ziel: die Eintracht des Lebendigen sich ergießen zu lassen, allen Seelen zur Freude.“
Nun jà, allen leider nicht. Es ist mir schleierhaft, wieso, nachdem sämtlichen Sängerinnen, Sängern, Musikerinnen und Musikern sowie dem Dirigenten in sturmflutartigen Orkanböen des Applauses geradezu gehuldigt wurde, über André Heller, als er mit seinem Team die Bühne betrat, ein nicht ablassender Tsunami unsisoner Buhs hereinbrach. Es ist mir nicht nur schleierhaft, sondern, nachdem ich es einer nahen Freundin am Telefon erzählt, fand sie das einzig richtige Wort: ekelhaft. Das soll aber nicht als letztes stehen bleiben. Sondern ein schlichtes Danke an Heller, Mehta, Hausner, Schilly, Arbesser sowie alle weiteren, die ihre Leidenschaft und Lebenszeit für diese Inszenierung gaben.
ANH, Februar 2020
Berlin

***