Und ebenfalls NZZ, >>>> dort:
Senizid
[Arbeitswohnung, 7.08 Uhr]
Und wenn er noch so viel → Unmut ausgelöst hat, die Vorstellung, es vollziehe sich derzeit ein wie nur selten spürbarer, weil unmittelbar in unser alltägliches Erleben hineinreichender selbstregulativer Prozeß, bleibt → beharrlich in mir, ob dieser uns nun schmeckt oder nicht. 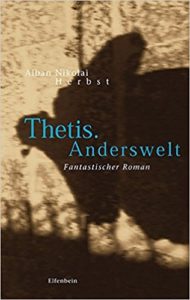 Er erinnert mich allzu sehr an das, was ich in THETIS die Große Geologische Revision genannt habe, seinerzeit mit Blick auf die schon Ende des vorigen Jahrhunderts mehr als nur „leicht“ sichtbaren Anzeichen. Ich denke weiter und weiter darüber nach … — nein, es denkt sich nach. Und das hat nichts damit zu tun, ob man es – angeblich – gutheißt. Wer wohl täte das? Wobei der Vorgang bei allem Grauen insofern etwas „Gerechtes“ hat, als der Virus unter den gefährdeten alten Menschen keine Unterschiede macht, nicht nach Vermögen (wenngleich reiche Leute deutlich mehr Möglichkeiten haben, sich ihre Quarantäne aushaltbar zu gestalten), nicht nach Geist und Bildung, nicht nach Geschlecht, nicht einmal nach Macht. Die moralischen Ausrufe hiergegen — „altersdiskriminierend“ — wirken so hilflos, wie sie es sind. Weiterhin → NZZ:
Er erinnert mich allzu sehr an das, was ich in THETIS die Große Geologische Revision genannt habe, seinerzeit mit Blick auf die schon Ende des vorigen Jahrhunderts mehr als nur „leicht“ sichtbaren Anzeichen. Ich denke weiter und weiter darüber nach … — nein, es denkt sich nach. Und das hat nichts damit zu tun, ob man es – angeblich – gutheißt. Wer wohl täte das? Wobei der Vorgang bei allem Grauen insofern etwas „Gerechtes“ hat, als der Virus unter den gefährdeten alten Menschen keine Unterschiede macht, nicht nach Vermögen (wenngleich reiche Leute deutlich mehr Möglichkeiten haben, sich ihre Quarantäne aushaltbar zu gestalten), nicht nach Geist und Bildung, nicht nach Geschlecht, nicht einmal nach Macht. Die moralischen Ausrufe hiergegen — „altersdiskriminierend“ — wirken so hilflos, wie sie es sind. Weiterhin → NZZ:
Die heutigen «Alten» haben unser Land im vergangenen Jahrhundert zu dem gemacht, was es ist. Sie zu schützen, ist für die meisten Menschen die Hauptmotivation dafür, zur Eindämmung des Virus möglichst viel beizutragen.
Daß hier im Hintergrund ein letztlich rein materielles Denken steht, sei erschauernd dahingestellt, auch wenn so etwas Kapitalismusfremdes wie „sorgende Liebe“ nicht einmal Erwähnung findet. Es ist doch mehr sie, was uns Menschen umtreibt, besorgt macht und in Nöte bringt. Insoweit es unsere bedrohte eigene Ökonomie ist, die einer und eines jeden Einzelnen, bzw. der Familien, haben die alten Menschen damit nichts mehr zu tun, jedenfalls in aller Regel. Daß es an uns selbst ist, angesichts einer sich wahrscheinlicherweise über Monate erstreckenden flächendeckenden Quarantäne neue Wirtschaftsformen zu entwickeln — und die, die längst schon im Raum standen, aber aus arbeitspolitischen Rücksichtnahmen und nicht zuletzt sentimentaler Beharrung wegen verhindert oder „konservativ“ hinausgezögert wurden —, ist nur allzu klar. Ich erinnere mich noch gut, mit welchen tatsächlich Vorwürfen ich es zu tun bekam, als ich in den Achtzigern bei einem großen deutschen Verlag statt eines Typoskripts eine Diskette abzuliefern wagte: Ich wurde quasi hinausgeworfen. Und nur wenig später, als ich die ersten poetologischen, auch praktischen Überlegungen anstellte, was die damals noch kommende mediale Revolution für die Literatur nicht nur bedeuten würde, sondern müsse, nannte mich ausgerechnet die von mir derart geschätzte NZZ einen Kulturverräter. Es war eine Stimmung, in der man über lange Zeit im Internet den Dolchstoß für die Buchkultur sah. Und von meinen Überlegungen zum → Literarischen Weblog als Dichtung will „man“ bis heute noch nichts  wissen; es stehen für die wenigen, aber machtvollen Leute im „klassischen“ Literaturbetrieb zuviel Pfründe auf dem Spiel. Möglich, daß auch dies sich nun auswäscht — wenngleich ich befürchte, daß der Igel immer schon allhier sein wird, da können wir Hasen so flitzen, wie wir nur wollen. Doch ein, → so Xo dort, „no future“ sehe ich nicht, im Gegenteil. Ich sehe Evolution, jetzt sogar vielleicht Mutation. Die Welt geht weiter, auch wenn ich selbst es vielleicht nicht mehr erleben werde. Und mehr noch: Ich will, daß sie weitergeht, wünsche es aus tiefstem Herzen, kann nur die schon mehrfach zitierte Stelle aus der „Sterbe-Elegie“, der neunten Bamberger, wiederholen:
wissen; es stehen für die wenigen, aber machtvollen Leute im „klassischen“ Literaturbetrieb zuviel Pfründe auf dem Spiel. Möglich, daß auch dies sich nun auswäscht — wenngleich ich befürchte, daß der Igel immer schon allhier sein wird, da können wir Hasen so flitzen, wie wir nur wollen. Doch ein, → so Xo dort, „no future“ sehe ich nicht, im Gegenteil. Ich sehe Evolution, jetzt sogar vielleicht Mutation. Die Welt geht weiter, auch wenn ich selbst es vielleicht nicht mehr erleben werde. Und mehr noch: Ich will, daß sie weitergeht, wünsche es aus tiefstem Herzen, kann nur die schon mehrfach zitierte Stelle aus der „Sterbe-Elegie“, der neunten Bamberger, wiederholen:
um zu spüren, sie fließt noch, die Regnitz, vor meinem Fenster, und fließt in den Augen der Kinder, der deinen, mein Sohn, die deiner
künftigen Frau, künftiger Frauen, ja weiß man es?, sind – und den späteren Mainen zu, späterem Rhein, denen viel spätere Rosen, die merklos erfrieren, nicht nachsehen in ihre späteren Meere. Den Zeitstrahl zu fühlen, worinnen wir stehen und dem wir zwar selbst nur Fragment sind, doch eines, das atmet und mittat. Das bleibt wie der Leibstoff, Körper gewesener, bleibt meines Leichnams.
ANH, Das bleibende Thier, 99/100
Ja, ich denke viel an den Tod. Es sind in meinem Umkreis an Covid-19 jetzt Menschen tatsächlich gestorben. Aber ich denke an ihn als an etwas, das ich gegebenenfalls lieber selbst herbeiführen würde, da ich → langsam ertrinken nicht will, schon gar nicht hilflos fremdbestimmt dahinvegetieren. Nur wie soll ich’s tun, und wann könnte ich es noch, in welcher Phase der Krankheit? Wenn ich im Krankenhaus lande, ganz bestimmt nicht. Ich will aber auch niemanden schädigen, nicht bei einem Zugführer ein lebenslanges Trauma auslösen, ebenso wenig wie bei Kindern, die mich hinabgestürzt, überall Blut und Splitter, auf einem Gehsteig oder Hinterhof finden. Von einigen zugänglichen Medikamenten weiß ich, aber entweder sind sie unsicher oder aber verursachen einen mindest ebenso qualvollen Tod wie der Virus. Hätt ich doch nur darauf geachtet, genügend mir nahe Ärztinnen und Ärzte als Freunde zu haben! — Darüber, in der Tat, denke ich subkutan ständig nach. Aber auch hier gilt (ebenfalls die neunte Elegie):
Wir nicht allein, auch das Tier beißt den Feind weg. Doch weiß es, wann Zeit ist. Dann legt‘s sich und blößt seine Kehle. Besser, ihm nachtun. Das Wakizashi ergreifen, das dir der Tod reicht, bevor man es zuläßt, was ihn und das Leben entwürdigte, das du so liebtest. So, Sohn, vernarrt bin ich ins Leben, ich ginge freiwillig eher, als daß ich’s beklagte.
Das bleibende Thier, 97/98
Nein, ich nehme nichts zurück, bleibe von Herz, Geist und Geschlecht auf der Seite der irdischen Welt. Und versuch es auszudrücken. Wobei ich gleichzeitig dafür sorge, meine Arbeiten möglichst umfassend zugänglich zu machen, in Der Dschungel, die ich aus meinen Dateiarchiven zur Zeit mehr und mehr fülle — das hat durchaus was von Nachlaß. Sehen Sie es, Freundin, so: Jeder fühlende Mensch möchte, daß es seinen Kindern gut geht, über den eigenen Tod weit hinaus. Ich wünsche mir das für meinen Sohn, wünsche es mir für meine Zwillinge, wünsche es aber auch meinen Schriften, weil ich auch sie als meine Kinder ebenso empfinde wie erlebe. Das ist nicht egozentrisch, denn sie sind ebenfalls, in ihrer Sphäre, nämlich der Fantasie und des Geists, zeugungsfähige Geschöpfe. Manche Bücher, manche künstlerischen Erfindungen, haben ganze Generationen verändert. Ohne Mozart hätt’s nicht einmal die Beatles gegeben. Von Bachs Einfluß völlig zu schweigen.
Ich in mir dessen bewußt und handle. Ich handle deshalb, weil Pessimismus mir fremd ist; meine bisweiligen Depressionen sind da nebensächlich: Sie sind egozentrisch, letztlich nichts als die Auswirkung narzisstischer Kränkungen. Die Bücher dagegen stehen für sich. Das ist ja das Grandiose, daß sie sich von uns, ihren Urheberinnen und Urhebern, (fast) ebenso ablösen wie unsre Kinder sich von ihren Eltern, uns. Genau das ist Zukunft. Wir selber, und später dann sie, gehen dahin.
Was danach kommt? „Ich bin unheimlich neugierig“, habe, heißt es, Ernst Bloch auf seinem Sterbelager gesagt.
Mein Pathos, jaja. Wobei die tägliche Realität eine seltsam zerfließende ist. Mehr noch (als wegen des meiner Arbeit eigenen Charakters sowieso) laufen die Tage ineinander.Neulich wußte ich nicht mehr, ob Donnerstag oder Freitag. Ich mußte im Kalender nachsehn. Und obwohl ich es gewohnt bin, mir meine Arbeitsabläufe diszipliniert selbst zu definieren, nach genauen Zeitabläufen zu schreiben, zu essen, zu lesen, abends einen Film zu sehen usw., werden die Ränder verschwimmend unscharf. (Meine bisweiligen, ich sag mal, quasi-physiologischen Ausflüge in die Pornowelt laß ich mal „außen vor“, wiewohl sie wichtig sind, um nicht nur die erotische Contenance zu wahren, sondern auch, um ein notgedrungnes Asketentum zu vermeiden, das sich ungut auf den Geist auswirken würde).
Dazu die ständig kurzen Überlegungen, muß ich eigentlich heute hinaus? Dann recherchiere ich wieder die neuen Coronavorgänge (muß gleich mal gucken, was die gestern getroffenen Ausgangsregelungen präzise bedeuten), antworte auf Kommentare bei mir und auf anderen Sites, telefoniere, bzw. skype/facetime täglich mehrfach mit den Freundinnen und Freunden, besonders auch in Italien, spüre bei vielen eine unterschwellig steigende Furcht. Ein Freund erzählt, er kaufe nur noch mit Schutzhandschuhen ein, ein anderer hat sich tatsächlich Atemmasken besorgt. Und draußen singen die Vögel, daß es ans Herz geht, und die Pflanzen werden an ihren sprießenden Knospen verrückt. Es ist erneut kalt geworden, ja, aber — hell! Diese göttliche Sonne! Die Fassade des langen Hinterhauses, das ich von meinen Fenstern aus sehe, strahlen nur so vor Gelb! Dazu zwei Zuschriften, die ich erhielt. 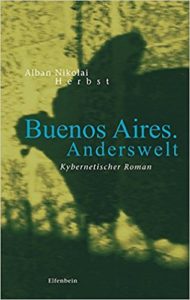 Die eine von einer Leserin, die schon mehrfach bei amazon Rezensionen eingestellt hat und → nun dort den zweiten ANDERSWELT-Band bespricht. Kann sich ein Romancier etwas Besseres wünschen? Aber auch zu meinem → Vortrag aus dem Hyperion kam eine Mail (ich möchte diskret bleiben und sag drum nicht, von wem):
Die eine von einer Leserin, die schon mehrfach bei amazon Rezensionen eingestellt hat und → nun dort den zweiten ANDERSWELT-Band bespricht. Kann sich ein Romancier etwas Besseres wünschen? Aber auch zu meinem → Vortrag aus dem Hyperion kam eine Mail (ich möchte diskret bleiben und sag drum nicht, von wem):
Fast haben wir Deine Stimme nicht erkannt, so sehr ist sie da zur heute möglichen Hölderlin-Stimme geworden.
Und in der Tat hat mir die Aufnahme eine irre Lust gemacht, den Hyperion tatsächlich selbst ganz vorzutragen — genau dieses „heute mögliche“ … ja!, zu beweisen. Die Zeit haben wir jetzt, die, nun jà, Isolation läßt sich füllen … ist zu füllen. Dagegen fallen Notwendigkeiten – wie etwa, daß ich diesen Jobcentermüll endlich weiter regeln muß, geradezu weg. (Ich hätte dringend einen Brief zu schreiben und darin, um einen Bescheid ändern zu lassen, eingehend zu argumentieren. Nun kommt’s mir vor wie kinkerlitz.) Alles ist ein bißchen wie vor dem Winter die Ernte einzuholen und gut für den Winter zu lagern. Die Dschungel.Anderswelt ist mir, so gesehen, Scheuer und Silo zugleich, zusammen mit der dinglichen Arbeitswohnung ist sie ein Gehöft.
Bewußtsein der eigenen Endlichkeit. Abschiede damit verbunden. Wie Andreas Steffens  schreibt: Der Horizont der noch verbleibenden eigenen Zeit rückt uns näher, fast stehn wir vor einer Wand schon daran. Was bleibt zu tun, um abzuschließen, nämlich — gut? Mehrfach, bemerke ich, schaute ich in den paar letzten Tagen intensiv zurück, erinnerte mich an grandiose Geschehen, beglückende, sinnenberauschende Erleben. zum Beispiel was Do und ich mit Nutella alles angestellt haben. Hatte ich vorher völlig vergessen. Und dann, als wir im Lager von Olifants saßen. Viele Jahre später, mit लक्ष्मी, auf der breiten Fensterbank des Havalis in Udaipur, wie, drauf beieinanderliegend, wir nach Krokodilen schauten, über den See, der unten an die Hauswand schwappte. Oder die Serengeti meiner Löwin. Und wie ich Circe ins Taxi setzte, nachts; wie ich mit einer Fee handinhand-halb eine andre Nacht durch Park und strömenden Regen schritt. Wie mein Sohn in meinen Händen zur Welt kam. Ich staune diese Hände an. Wie die Ärztin nach der Zwillingsgeburt die Doppelplazenta ebenso staunend und frappierend liebevoll aufstrich, auf zu mir sah und frage: „Darf ich sie haben? Ich möchte sie meinen Studenten zeigen.“
schreibt: Der Horizont der noch verbleibenden eigenen Zeit rückt uns näher, fast stehn wir vor einer Wand schon daran. Was bleibt zu tun, um abzuschließen, nämlich — gut? Mehrfach, bemerke ich, schaute ich in den paar letzten Tagen intensiv zurück, erinnerte mich an grandiose Geschehen, beglückende, sinnenberauschende Erleben. zum Beispiel was Do und ich mit Nutella alles angestellt haben. Hatte ich vorher völlig vergessen. Und dann, als wir im Lager von Olifants saßen. Viele Jahre später, mit लक्ष्मी, auf der breiten Fensterbank des Havalis in Udaipur, wie, drauf beieinanderliegend, wir nach Krokodilen schauten, über den See, der unten an die Hauswand schwappte. Oder die Serengeti meiner Löwin. Und wie ich Circe ins Taxi setzte, nachts; wie ich mit einer Fee handinhand-halb eine andre Nacht durch Park und strömenden Regen schritt. Wie mein Sohn in meinen Händen zur Welt kam. Ich staune diese Hände an. Wie die Ärztin nach der Zwillingsgeburt die Doppelplazenta ebenso staunend und frappierend liebevoll aufstrich, auf zu mir sah und frage: „Darf ich sie haben? Ich möchte sie meinen Studenten zeigen.“
Wunder, Freundin, über Wunder. Mein Leben war reich.
So fühl ich Tag um Tag, auch wenn es sicherlich etwas anderes wäre, lebte ich in einer Partnerschaft oder sonstwie mit jemandem andres zusammen. Zum Beispiel, daß ich bis gestern vier Tage lang nicht mehr geduscht hatte. Morgens rein in die Arbeitsklamotten, an den Schreibtisch, bis spät in den Abends durchgemacht. Man muß sich ja grad nicht mehr zeigen, darf sich nicht zeigen. Schon sproß enorm der Bart, ich mußte an Tolstoj denken, sah mich dann im Spiegel an, erschrak, stutzte ihn auf Dreitageslänge. Das Antlitz ist dann einfach klarer, markanter. Und bloß die Kleidung endlich wechseln! Was Helles! — Den Anzug rausgesucht, dann unter die Dusche. Auch die Achselhöhlen, die Hoden rasieren. Es kommt nicht darauf an, ob jemand mich sieht, sondern auf eine innere Haltung, der wir Form auch außen geben. Wille zur Klarheit. Und zwar gerade, wenn man allein ist. Ich denke an Lawrence of Arabia, der sich mitten in der Wüste, obwohl da eben keinerlei Wasser, draußen vorm Zelt zum Unverständnis vieler rasierte.  Wie man das Wasser so verschwenden könne? Soweit ich mich erinnere, antwortete Peter O’Toole mit einem einzigen Wort: „Kultur.“ Meine Güte, seine irrsinnig strahlenden Augen!
Wie man das Wasser so verschwenden könne? Soweit ich mich erinnere, antwortete Peter O’Toole mit einem einzigen Wort: „Kultur.“ Meine Güte, seine irrsinnig strahlenden Augen!
Das in jedem Fall bewahren. Was immer auch kommt.

Ihr, um 11.59 Uhr,
ANH
der gerne auch hier noch einmal → darauf hinweist.
P.S.:
Selbstverständlich bin ich nicht allein, alles andere als einsam. Wir kommunizieren ständig. Die Göttin gebe bloß, daß uns das Netz nicht ausfällt. Aber es ist anders, ob wir uns treffen könnten, leiblich, oder nicht können. „Die erste Ferngesellschaft“, → Peter Weibel, ja. Wir werden avatar einander. Der nächste Schritt der → anthropologischen Kehre, den nunmehr Corona erzwingt.
***
[14.30 Uhr:]
Da ich meine Cigarillos brauchte, die Gelegenheit genutzt, fast anderthalb Stunden → à la Nietzsche spazieren zu gehen: Keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung — erst diagonal durch die nach den Beschlüssen von gestern doch erstaunlich belebten Straßen, wobei allerdings die meisten Menschen tatsächlich nur zu zweit flanierten oder mit ihren Hunden Gassi gingen. Nur vor LIDL pulkte sich’s, weil immer nur zehn Personen auf einmal Einlaß finden; so stand’s draußen anplakatiert.
Vorm Aufbruch die autophil höchst zärtliche Idee, vielleicht noch einmal meinen alten russischen Biberpelzmantel zu tragen, der angemessen in diesem, nun jà, Winter wirklich nur zwei Mal gewesen. Und ich hatte recht, es ist ziemlich scharfkalt draußen, unter gleichzeitig ganz enormen Sonnenfluten, durch die ich quasi tauchte. So sehr ist Frühling eben doch und von welch milder, die Augen labender Schönheit alles! Es geht bei den Krokussen los , schäumt in den Forsythien, perlt grün als sich entfaltende Knospen auf.
, schäumt in den Forsythien, perlt grün als sich entfaltende Knospen auf.
Da mir nach Okra zumute war, für den Abend, ich dafür einen Asia-Laden finden mußte (was mir nicht gelang, der nächste mir bekannte ist ganz anderswo), schritt ich, nachdem quer durch den Kollwitzkiez spaziert, vom Tabaccaio an die Prenzlauer Allee hoch, dann rechts in die Fröbelstraße, um schräg zum Tählmannpark weiterzugehen 
 und nach dem kleinen Teich, fast einem Weiher nur, zu schauen, der → von Anwohnern versorgt wird, gegen einigen Widerstand des Gartenamts. Schrieb ich nicht schon mal von ihm?
und nach dem kleinen Teich, fast einem Weiher nur, zu schauen, der → von Anwohnern versorgt wird, gegen einigen Widerstand des Gartenamts. Schrieb ich nicht schon mal von ihm?
Es hat sich hier eine fast ganz für sich existierende Flora und Fauna entwickelt; sogar freie Schildkröten gibt es im Wasser, die drin auch überwintern. Und was ich sah, ich sog es ein!
Diese Farben, das unversehens hörbare, früher nur nachts nicht vom nahen Verkehrslärm wegkrawallte Rauschen eines kleines Wehres, zwei Elstern elsterten lustvoll herum und ließen sich nicht stören, als ich näherkam, anstelle liebevoll diskret einen anderen Weg mir zu suchen. Ich sah zu ihnen hinauf, sie sahen zu mir herunter. Schon gurrten sie, jedenfalls schnäbelten weiter. Ich kann Ihnen, Freundin, kaum sagen, welch ein Glück ich da empfand.
Es ist auch nicht ganz ohne Witz, daß ich, der so auf die kybernetische Welt setzt, zugleich auf der anderen, der natürlichen Seite empfinde, und mit ihr. Bezeichnend, daß ich schließlich den kleinen Umweg zu dem ziemlich verrotteten Pfad nahm, der direkt an der SBahn entlangführt. Ich wollte mir nämlich zwei Zweige schneiden, um etwas von diesem Frühling in die Arbeitswohnung mitzunehmen, und dies eben dort tun, wo kein Passant sie vermißt — auch nicht etwa blühende Zweige; nein, es genügt mir das sprießende Grün. So stehn sie nun denn auch hier und über-, na gut, „-wölben“ nicht grad den Schreibtisch, aber strecken sich doch über ihm aus.

Verstehen Sie, daß ich Dankbarkeit empfinde? Und meinen Eindruck, die Gefährdung schärfe meine Sinne und mache sie weiter?
Schließlich noch frischen Koriander besorgt; ich bereite mir heute ein Dal.

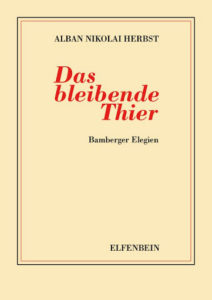
Wunderbarer Text.