[Arbeitswohnung, 5.55 Uhr
Noch fastSchwärze draußen, der Amselhahn singt ins sich hebende Dämmern.]
Erster Latte macchiato, erster Morgencigarillo.
Weil ich einsam bin, Plácido. Einsam
wie alle Geschichtenerzähler.
Fließt das Blut, fließt das Geld.
Gogolin, Regenfotograf 261, 312
Da habe ich mich ganz „schön“ ins Aus geschossen mit meinen ersten drei wiederTrainingstagen. Ich weiß, Freundin, „man“ soll nach langer Sportpause langsam beginnen, aber täte ich’s, begänne ich niemals. Ich brauche das Gefühl, etwas zu erreichen, auch wenn es momentan wehtut, habe es immer so gehalten, seit ich mich sportlich be(s)tätigte, also seit ich etwa dreißig war. Davor habe ich körperliche Ertüchtigung, vom Vögeln abgesehen, immer gemieden, sie als Jugendlicher sogar gehaßt. Auch das brachte in der Schule stets Probleme. Am schlimmsten fand ich Mannschaftssportarten.
Dann fing ich zu laufen an, fing mit dem Krafttraining an, aber für mich. Es war, und ist es wohl noch, ein Weg, mir Erfolge zu sichern, die alleine ich steuern konnte und kann, ohne von dem „guten Willen“ anderer abhängig zu sein, etwas, das sich rein faktisch herstellte, bei dem also kein Gemauschel eine Rolle spielte, kein, sagen wir, Beliebtheitsfaktor, sondern das pure Ergebnis. Du schaffst die dreizehn Kilometer oder schaffst sie nicht, du stemmst diese einhundert Kilo oder eben nicht; daran gibt es nichts zu interpretieren.
Vor fünf Jahren nahm ich auf diese Weise zwölf Kilo in sechs Wochen ab; der Erfolg hielt lange an, dann, vor zwei Jahren, wurde ich nachlässig.
Mein wirklich starkes Problem, das ich mit Dickheit habe, gründet darin, daß ich sie für einen Ausdruck eben solcher Nachlässigkeit halte, es sei denn, jemand leidet unter einer entsprechend genetischen, bzw. physiologischen Disposition. Also Krankheit steht auf einem anderen Blatt. Aber besonders gesunde Männer müssen nicht dick sein, ihr Stoffwechsel erlaubt ihnen – erlaubt uns, den Männern -, sehr viel schneller als Frauen, unnötiges Gewicht wieder loszuwerden; bei mir geht es, harte Disziplin vorausgesetzt, sogar rasant. Konnt‘ ich ja gestern schon sehen.
Dennoch, ich hatt‘ es übertrieben, lag gestern nach dem Dauerschwimmen mit „exklusivem“ Muskelkater völlig erschöpft darnieder, mittags – so erschöpft, daß ich nicht mal einschlafen konnte, aber auch fürs Arbeiten nicht mehr sonderlich geeignet war. Ich dämmerte nur. Und abends ging ich um zehn zu Bett.
Heute früh ist der Muskelkater vorüber, erstaunlich selbst für mich. Auch der Kreislauf hat sich normalisiert.
Es gibt auch für Sport ein Körpergedächtnis, tatsächlich, ich hab’s nachgelesen. Hat jemand jahrzehntelang trainiert, dann eine längere Pause gemacht und fängt wieder an, protestiert der Körper erstmal: Wie, er soll seine Komfortzone verlassen?! Na dem zeig ich’s! Und gibt ihm zitternden Kreislauf und Anfälle von Übelkeit, und gibt ihm diesen Muskelkater. Wolln doch mal sehn, wer stärker ist. – Ist es der Wille, schwenkt der Körper ziemlich schnell um und begreift: Ah, Kondition ist angesagt, na gut, wenn der Typ es so will. Was soll ich mich selbst quälen? Und er, der Körper, beginnt mit dem neuerlichen Aufbau – was dann b e i d e n zustatten kommt, ihm selbst und auch dem Willen, und beide schließlich stärkt. Interessanter „Begleit“effekt: Auch das körpereigene Immunsystem wird hochgepeitscht.
Dennoch werde ich heute einen Tag pausieren: Rekonvaleszenz. Dies nun aus Klugheit, gegen mein Temperament. Ich kann auch die Zeit gut brauchen… für die andere… ja, Arbeit, eben. Denken Sie daran, daß der Arbeitsbegriff für mich positiv konnotiert ist, ebenso wie der der Leistung. „Um meiner selbst willen“ – eines Selbst, das sich nicht, um mit Saint-Exupéry zu sprechen, gegen etwas austauscht, sich also an und in etwas von ihm Getrennten nicht objektiviert – war für mich noch nie eine Kategorie, auch und schon gar nicht der Liebe.
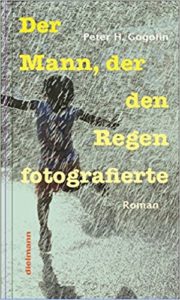
Also der Regenfotograf. Peter H. Gogolins neuer Roman.
Ich habe ihn vorgestern zuende gelesen. Und nun, tatsächlich, kam er ins Rennen. Geahnt habe ich es schon vor einer Woche und so auch geschrieben: „Da wird das Buch plötzlich groß.“
Es b l e i b t groß. Gogolin hat sich gefunden.
Seit Stunden kniet sie nun dort, wo sie vor Tagen schon
die Szene wurde 180 Seiten vorher erzählt, ich hab sie zitiert
einen kleinen Altar für Olinda
ihre verschwundene kleine Tochter
eingerichtet hat, und stellt immer einen neuen Kranz brennender Kerzen um die süßen Lutscher und das Püppchen auf. Die Flammen sind so heiß, dass das blakende Wachs der verbrannten, rußigen, von Furchen durchzogenen Hügel um das Kreuz herabfließt und ihre auf dem steinigen Boden längst blutig gescheuerten Knie einschließt, wie eine Flut heißer milchiger Tränen.
Regenfotograf 293
Hier nun zeigt sich, wie genau Gogolin konstruiert hat, daß er Leitmotive ausgesprochen geschickt durch den gesamten Roman webt, die ihn zugleich vorantreiben; ich fand – aus den genannten stilistischen Gründen – nur nicht gleich in sie hinein; eine gewisse, um es so zu sagen, Indirektheit der Erzählung versagte es mir, eine stilistische Haltung, die mich aus ihr sogar anfangs hinauswarf.
Solche Stellen gibt es zwar auch jetzt noch immer mal wieder:
Alvaro beginnt innerlich zu zittern. Er weiß jetzt, dass er Juan einfach hätte liegenlassen sollen (…)
Regenfotograf 331
anstelle von: „Alvaro beginnt innerlich zu zittern. Er hätte Juan einfach liegenlassen sollen“ – aber nun treibt die Erzählung derart voran, daß man darüber fast wegliest (daß ich darüber weglese – ebenso wie über „Jetzt sieht Alvaro, dass da ein kleiner Metalltisch steht (…) statt „Ein kleiner Metalltisch steht da“). Und Gogolin, vor allem, durchstößt diese auktorialen Stelzungen immer wieder:
Sie hatte den Fahrstuhl unten in der Empfangshalle gerade verlassen, als sie sich fragte, warum zuerst eine Frau angerufen hatte. Und weshalb hatte sie versucht, Englisch zu sprechen? Beide Fragen zusammen ergaben eine Idee, die sie sofort wieder in den Fahrstuhl steigen und zurück auf ihr Zimmer fahren ließ.
337
Hier wird, indem eben nicht sofort erklärt wird, eine Spannung erzeugt, die überdies aufgrund einer sprachlichen Konstruktion („Idee“) zur Aktion führt. Das ist wirklich toll, hier zeigt sich der Romancier, der Gogolin tatsächlich ist. Er hat den offenbar nur erst freischreiben müssen.
Die eigentlich großen Stellen sind aber noch ganz andere. Tatsächlich erzählt Gogolin den Obdachlosen Beléms einen Mythos, den er sie selber gründen läßt – einen, der die Abwesenheit Gottes erst als quasi eine Flucht erzählt,
Gott hat Afrika spätestens verlassen, als die Burentrecks mit ihren Ochsenkarren über das Veld zogen und die Buschmänner ausrotteten, als seien (wären) sie irgendein Ungeziefer (gewesen). Die ersten Engländer, die afrikanischen Boden betraten, hat er schon nicht mehr gesehen. Als die Belgier den Kongo auszubeuten begannen, da war er bereits Lichtjahre entfernt. Und glaube mir, als das wilhelminische Deutschland seine Kolonien absteckte und an den Herero und Nama den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts beging, da war Gott längst weit hinter den Nebeln des Orion verschwunden.
318/319
Aber dann gerät Gott selbst in Ketten:
Das kann nicht sein, er ist immer bei uns, wagt Plácido einzuwerfen, weil wir alle seine Kinder sind.
Vielleicht hast du recht, sagt José (…). Er hört nur nichts. (…) Gott hört uns nicht, weil er keine Ohren mehr hat, denn man hat sie ihm abgeschnitten, so wie man all den abertausenden von Kindern im Kongo die Ohren abgeschnitten hat, wenn sie nicht genug Kautschuk gesammelt haben. Und selbst, wenn er auf anderem Wege erfahren würde, was seinen Kindern geschieht, so vermöchte er es nicht zu ändern, denn er kann nichts tun. Gott kann nichts tun, weil man ihm die Hände abgeschnitten hat, verstehst du, Plácido? Man hat ihm die Hände abgeschlagen wie all den schwarzen Männern und Frauen, die sich nicht den weißen Befehlen gefügt haben. Und selbst wenn Gott zu uns laufen wollte, um uns zu retten, so könnte er es nicht, weil seine Füße in Ketten gelegt sind und ihm die weißen Sklaventreiber mit der Machete die Achillessehnen durchtrennt haben.
319
An solchen Stellen wird der Regenfotograf zu einem Menschheitsgesang, Klagegesang, und er, Gogolin, ist bitter genug, die Schuld nicht einseitig zu sehen, sondern es waren die schwarzen Stammesführer a u c h, die ihr Volk verkauften. Beklagt und angeklagt wird deshalb die Condition humaine:
Denn auf Blut war das Land gebaut, über das unsere prächtigen afrikanischen Könige herrschten. Weit fiel ihr Blick über die gebeugten Rücken der Untertanen, war doch ihr Thron errichtet auf abgeschlagenen Köpfen. Menschenköpfen, damit kein Zweifel ihre Allmacht trübe. Unsere Schädel horteten sie, gleich geizigen Greisen, die das Leben ihrer Kinder stehlen, den Tod von sich fern zu halten. (…) Da war es Erlösung, nur als Sklave verkauft und auf die Schiffe getrieben zu werden (…).
309/310
Und hören Sie den T o n, den jetzt eben nicht mehr Gogolin selbst, sondern den seine Figur anschlägt- ein phantasmagorisches Wesen, das Plácido in sich trägt, das ihn nicht mehr verläßt:
Unter dem Baobabbaum, der unsere Tränen trank, Jahr für Jahr, wenn die Schiffe der weißen Händler draußen vor der Küste ankerten. Mit Schießpulver zahlten sie, mit Kanonen, Muschelgeld und Gold, Tabak und Branntwein, Barren aus Blei und Gewehren. Gewehre und immer wieder Gewehre, damit der König fern ins Land Soldaten schicken konnte, die Dörfer zu umstellen und fortzutreiben, als Sklaven, die Bevölkerung.
310
Es ist so einfach n i c h t, wie Multikulti es sich wünscht. In den ethnischen Schlachtorgien der Gegenwart sehen wir dies voll Entsetzen noch und gerade heute. Insofern ist Gogolins Roman in bestem und furchtbarstem Sinn modern.
Wir glaubten alle, dass wir Afrika wiedersehen würden, doch auch das war eine Lüge. (…) Kehrten wir zurück, um die Wahrheit zu erzählen, fortjagen würde man uns. Die Lebenden nämlich, die wollen die Wahrheit nicht wissen, sie verschließen ihre Ohren, um nicht zu hören, dass es die Herren der Paläste waren, unsere eigenen grausamen Herrscher, die Millionen ihrer Kinder schlachteten und verkauften.
311
Er, der Roman, zeigt anhand der darniederliegenden, wirklich elend darbenden Bevölkerung Beléms aber noch etwas anderes, etwas, das uns selbst unterdessen eingeholt hat und mindestens über das nächste Jahrhundert nicht nur beschäftigen, sondern umtreiben wird: Unsere Vorstellung von Demokratie ist luxuriös und so gesehen, möglicherweise, ausgesprochen bedingt. Pankaj Mishra hat gestern in einem der NZZ gegebenen Interview deutlich gemacht, weshalb sich unsere politischen Vorstellungen auf ehemalige Kolonialländer nicht einfach übertragen, sozusagen exportieren lassen: Der Kolonialismus ist für die westliche Welt eine für andere Staaten, bzw. Völkerschaften nicht mehr wiederholbare Voraussetzung gewesen; allein der massive „Input“ von gewaltsam eroberten Rohstoffen (siehe den „Kautschuk“ im Gogolinzitat) ist jenen faktisch versagt. Eine demokratische „Befreiung“ hat aber wirtschaftliche Prosperität zur Voraussetzung. Insofern fußt die Möglichkeit unserer Menschenrechts- und eben auch wirtschaftlichen Ordnung, ebenso wie unsere Freiheit, auf den Greueln des Kolonialismus nach wie vor, egal, wie sehr wir uns von ihnen längst distanziert haben: Ihre Ergebnisse verzehren wir weiter.
Doch dies nur beiseite gesprochen.
Die religiösen Kontexte sind im Regenfotografen von Anfang an thematisiert. Doch ist den ersten 200 Seiten des Buches noch allzu deutlich die Recherche des Autors anzumerken, kippt sie in den folgenden in Sinnlichkeit um, poetische Gegenwärtig- ja Unmittelbarkeit:
Alles, was wirklich ist, hat mit einem Traum begonnen. Aber wenn man nur wartet, dass die Träume von allein Realität werden, dann verblassen sie wie alte Fotos, die zu lange in der Sonne gelegen haben.
320
Die eigenwillige Synthese, die die aus Afrika mitgebrachten Religionen, bzw. religiösen Vorstellungen und Riten, mit dem katholischen Christentum, namentlich der (von Demeter sich herleitenden) Marienverehrung, eingegangen sind, eine nicht zu entlösende Verschmelzung, läßt die Not der Romanpersonen geradezu mit den Händen fassen, hineingeätzt die mit ihr verbundene Ausweglosigkeit. Bisweilen ist das herzzerreißend rührend, etwa wenn der werdende Mörder bei der Muttergottes nicht nur schon Verzeihen erbittet, sondern sogar ihre gewissermaßen Mithilfe. Jede Diebin, jeder Dieb läßt sich sein kleines Verbrechen quasi segnen, besten, tiefsten Glaubens. Unsere Vorstellungen von Gut und Böse dreht Gogolin durch die Mangel, oder den Shredderer, der tatsächlichen Verhältnisse.
Flüsternd betet er: Heilige Mutter Gottes, ich werde etwas tun, für das ich Dich nicht um Deinen Segen bitten kann. Er überlegt, ob es eine Sünde ist, wenn er die Mutter des Herrn um Beistand bittet. Dann betet er weiter: Halte trotzdem Deine schützende Hand über mich und gewähre mir Deine Vergebung. (…)
Lutum fecit ex sputo Dominus,
et linivit oculos meos;
et abii, et lavi, et vidi, et dredidi Deo.
(…) Gib mir die Kraft zu tun, was ich tun muß, dann werde ich beim Círio Deinen Wagen ziehen, Heilige Herrin von Nazareth. Mit der einen Hand, die er mir gelassen, werde ich es tun.
359/360
Derweil liegt der entführte Hendrik Cramer noch immer im Verlies und wird zum ersten Mal in seinem Leben mit tatsächlich Existenz konfrontiert; ob er überleben wird, ist alles andere als ausgemacht, daß er sein Überleben ausgerechnet dem Gebeugtesten, Plácido nämlich, und dessen kleinem Innengott verdanken wird – sowie der Diebin Estelle, die ihr Kind an das Wasser verlor -, ist eine der moralischen Versprechen dieses Buches; realistisch gesehen handelt es sich um eine Utopie:
Und dann war Plácido ihm entgegengetreten, als sei (wäre) er ein ganz anderer Mensch geworden, hatte auf die ausgestreckten nackten Beine von Cramer gezeigt, die aus der Tasche auf die Steinstufen hingen, und gesagt: „Der Herr hat dir deinen Freund zurückgebracht. Nimm ihn, der Herr belohnt jede Gabe nicht nur doppelt, sondern tausendfach.“ Und während er sagte: „Das ist für deine Spucke in meine Hand, Gringo“, hatte er in die Jackentasche gelangt und ihm einen schmutzigen, verkrusteten Fetzen gegeben; es war Cramers fehlendes Ohr gewesen, das Wim vor Schreck fallen ließ. Dann war er davongegangen, als habe (hätte) er sich über Nacht in einen Königssohn verwandelt, der eben einem Diener einen Befehl erteilt hat.
368
Um die Szene geradezu filmisch zu schließen, VORHANG EINS:
Ohne einen Blick zurück war er die Straße hinunter zur Baía geschritten, als ginge er inmitten eines großen Gefolges und nicht mutterseelenallein zwischen dem ständig dichter werdenden Verkehr, der trotz der frühen Stunde bereits wieder von der Rua Gaspar Viana und der Marechal Hermes auf die Avenida Vargas einbog.
So gesehen, hat Peter H. Gogolin der Stadt Belém do Pará, in die sonst niemand will, einen Gesang geschrieben, der er, quasi als Appendix, noch den Gründungsmythos nachstellt – auch dies ein Leitmotiv, das sich erst hier erklärt, auf den Seiten 390/391, der zugleich noch die Namen Plácidos und seines kleinen Innengottes aus dem Ursprung dieser Stadt ins Heutige erhebt:
Weißt du, sagt José neben ihm, das Land der Verzweiflung oder die Heilige Jungfrau von Nazareth sind nur Geschichten, die die Menschen sich erzählen. Im Land der Verzweiflung gibt es genauso viel Leid oder wenig Leid, wie die Menschen es denken. Und die Jungfrau kann weder segnen noch jemanden fressen. Aber ihre Geschichte ist schon sehr alt, und als der Teil der Geschichte begann, der hier in Belém spielt, da fand ein Mann, der wie du und ich hieß, eine kleine Marienstatue. Plácido José fand am Flussufer die Heilige Jungfrau und begann sie anzubeten, dort wo heute die Basilika steht und die Millionen es ihm nun schon so lange nachmachen. Doch selbst, ob es Plácido José vor dreihundert Jahren gegeben hat, wissen wir nicht mit Sicherheit. Vielleicht ist auch er schon ein Teil der Geschichte, den man erzählt, weil es immer einen Ursprung braucht, einen Beginn, ohne den unsere Geschichten keinen Anfang hätten, sodass jeder mit Schrecken entdecken müsste, dass er inmitten der großen, schwarzen Leere der Zeit lebt, mutterseelenallein, und nichts eine Bedeutung hat.
390/391
Meine Güte, Freundin! Was bin ich froh, trotz meiner anfänglichen Einwände weitergelesen zu haben! Die Stadt Belém werde ich nun niemals vergessen und niemals mehr aber auch manche Sätze
Vor vielen Jahren schon hatte sie begriffen, dass Liebe etwas ist, für das man sich entscheiden muss
271 (Kursivierung von mir),
sowie manche, manche Passagen:
Als er auf die Bushaltestelle zuging, sah er, wie ein kleiner Junge zwei Hunde aufeinander hetzte. Die Tiere verbissen sich ineinander und begannen, sich zu jagen, bis sie wie ein sich drehender, staubiger Knäuel waren, ein kläffendes Knäuel aus Dreck und verfilztem Fell, dem die Leute weiträumig auswichen, obwohl sie darüber lachten.
Warum hat die Natur, dachte Alvaro, als er an ihnen vorbei war, die Tiere so dumm gemacht? Warum begreifen sie nicht, wer ihr wirklicher Feind ist?
283
Wie, Freundin, sollten sie denn, wenn nicht mal wir Menschen es tun?
Ihr
ANH, 9.29 Uhr
VORHANG ZWEI:
Nichts ist zu Ende.
Regenfotograf, 392
NACHTRAG
TO THE UNHAPPY CROWD
Aragon, Blanche
