[Arbeitswohnung, 8.10 Uhr] Um zehn Interview für den ORF im Studio des Deutschlandradios Berlin, also „ordentliche“ Tour mit dem Rad bis Hans-Rosenthal-Platz, knapp zehn Kilometer hin, knapp zehne zurück. Gesprochen werden soll über Wirklichkeitskonstruktionen, also auch über die Balance zwischen Fake und Lüge und darüber, wie Digitalisiersprozesse sie, die Wirklichkeit, veränderten. Vermittelt hat mir dieses Gespräch meine Lektorin, Elvira M Gross, die im Herbst 2017 einen Vortrag zu Paul Watzlawicks Wirklichkeitskonzept(en) gehalten hat.
[10 Uhr:]

Sehr schönes, ruhiges mehr Gespräch als Interview. Die Redakteurin, Margarethe Engelhardt-Krajanek, ausgesprochen vorbereitet; sie bezog sich direkt auf einen Text in Der Dschungel, war nicht nur über Meere informiert, sondern auch Verbeen war ihr bekannt, also daß ich ihn vor ein paar Jahren als quasi „mein“ KriegDerWeltenOrsonWelles in die Welt gesetzt hatte, nur freilich als eine, ich sag mal, jean paulsche Humoreske, auf die – wohl eben deshalb – um so dumpfer der komplette Grobsinn deutscher Correctnässer fiel.
Sowie ich weiß, wann die Sendung ausgestrahlt werden wird, geb ich hier Bescheid.
Nun zu gestern abend aber, zu nämlich „kookmono„ im ausland:
 Auch wenn Daniela Seels, der Verlegerin von KOOKbooks, selbst auch nur Vornahme, „neue, performative Formate für literarische Texte“ zu schaffen, ein wenig allzu sehr sehr großtönt – besonders, wenn wir uns die Kunstgeschichte der Fünfziger bis Siebziger Jahre anschauen, bzw. -hören -, bleibt das ausland einer der interessantesten Berliner Aufführungsorte für nicht nur experimentelle Literatur und Musik. Es zeichnet Experimente ja eben aus, daß sie schiefgehen können, und nicht wenige Werke einer später einmal für groß geltenden Kunst sind aus dem Humus des Bastelns entstanden; auch dieses b r a u c h t seinen Ort. Plötzlich bricht dann tatsächliche Größe über das Publikum, ergießt sich auf und/oder erblüht vor uns, läßt uns erschüttert zurück oder „nur“ sinnend, lange, lange sinnend.
Auch wenn Daniela Seels, der Verlegerin von KOOKbooks, selbst auch nur Vornahme, „neue, performative Formate für literarische Texte“ zu schaffen, ein wenig allzu sehr sehr großtönt – besonders, wenn wir uns die Kunstgeschichte der Fünfziger bis Siebziger Jahre anschauen, bzw. -hören -, bleibt das ausland einer der interessantesten Berliner Aufführungsorte für nicht nur experimentelle Literatur und Musik. Es zeichnet Experimente ja eben aus, daß sie schiefgehen können, und nicht wenige Werke einer später einmal für groß geltenden Kunst sind aus dem Humus des Bastelns entstanden; auch dieses b r a u c h t seinen Ort. Plötzlich bricht dann tatsächliche Größe über das Publikum, ergießt sich auf und/oder erblüht vor uns, läßt uns erschüttert zurück oder „nur“ sinnend, lange, lange sinnend.
Dabei wollte ich schon gehen, ein neuerliches Mal enttäuscht. Was ich dem Ort nicht übel nehme, siehe oben, Sternstunden des Experimentes sind rar. Jedenfalls ödeten mich die ersten beiden „Performances“ an, die zweite mehr als die erste, die immerhin noch versuchte, mit statuarischer, quasi-japanischer Künstlichkeit eine mir allerdings wenig nachvollziehbare Trennung zwischen zu Sprechendem und Sprechender zu schaffen (als wäre es der Künstlerin um Signifikat und Signifikant gegangen), hier zwischen Text und Autorin, wobei „Text“ der leider richtige Begriff ist. Es ist ein Problem, oft aber eben grad Absicht der „Perfomances“, daß sie wacklige Zeilen vermittels Getue und Technik quasi nobilitieren. Jedenfalls versuchen sie es, machen entertainend das Publikum für manchen Unfug geöffnet, über das es sonst den Kopf schütteln oder das es langweilen würde. Imgrunde funktionieren solche Aufführungen wie unentwegte Kalauerei; schließlich klatschen sich alle die Hände auf ihre Schenkel, weil sie sich freuen, was zu grölen zu haben, die einen wie die anderen fett.
Wie auch immer, bei Stück eins ward zumindest die Absicht gespürt, ich war zwar verstimmt, aber milde. Und fand doch das Spiel mit Bluetooth-Lautsprechern insofern interessant, als mir tatsächlich Möglichkeiten darin zu schlummern schienen – aus Gründen leicht sich gegeneinander verschiebender Klangeffekte: Da über Funk gekoppelte Geräte in den seltensten Fällen wirklich synchronisiert sind, ergeben sich sprachliche Versetzungen, mit denen sich spontankompositorisch fast ebenso arbeiten läßt, wie wenn man die Effekte elektronisch erzeugt. Nur macht das natürlich die wie auch immer aufgemotzten Texte nicht besser – zu spüren, nein, zu e r l e i d e n besonders beim zweiten Stück des Abends, das quasi angetrieben von einer Geschlechterverunsicherung war, die sich, schon auf das perfideste chic geworden, aufs Gleis der von den Cleannässern längst eingeläuteten Replikantisierung gelegt hat und dort weinerlich wartet, endlösungsgültig durchgestartet zu werden:
Der da kommt
kennt nicht den Rauch und die Mandel
weiß von den Pforten Andromedas nicht
hört nicht an Zweigen die Toten
nicht Neros Räusche, als er Prometheus dankte fürs Feuer
und kaute mit an der Leber
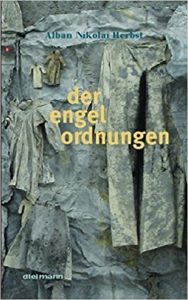 hat clean auf die Klinke die Hand
hat clean auf die Klinke die Hand
unverdammt liegen und drückt sie
zur Zukunft hinunter
Hell ist sein Aug
Hell ist sein Haut
Hell ist sein leerer Gedanke
So tritt er ein
analphabet von den Alephs entbunden
Daß der Performer dabei die in der Tat mangelnde Qualität seines momentan „performten“ Textes auf eine Weise thematisierte, die sie, diese geradezu erschütternde Unqualität, eben dadurch aufzuheben vermeinte, machte die Sache nicht besser, eher noch zäher, und jammeriger sowieso. Freilich reagierte das Publikum mit bisweiligen Lachern, also mit – nur so kann ich sie mir erklären – Reaktionsbildung. In dieser Szene sind ja alle irgendwie befreundet, zumindest verbandelt. Da will man einander schützen, und frau. Ansonsten hätte jede und jeder wegfließen müssen vor Mitleid mit dieser sich in ihrer Selbsttraurigkeit outrierenden, nun jà, ich sag es besser nicht.
Also ich wollte schon gehen.
Das wäre freilich aufgefallen. Der Raum war sehr voll, ich hätte mich durchquetschen müssen. Und zumindest den Veranstaltern bin ich bekannt.
Ich bin froh, daß nicht schon Pause war. Nur deshalb also blieb ich.
 Und wurde mehr als belohnt.
Und wurde mehr als belohnt.
Senthuran Varatharajahs, Hieu Hoangs, Trang Tan Thus und wohl auch „Valmira Surrois“ UND WIR WERDEN UNS DAS HALBIERTE AUGE ZERSTÖRT HABEN AM GRUND DER BILDER ist eine quasi liturgische, den Lamentationes nahe Meditation über Verlust und ein Leben, dem dieser Verlust eingeschrieben ist und bleibt, wobei sich das Leben hier als Sprache und nur Sprache auszudrücken versucht und der Verlust sehr wohl vor allem den Tod meint, vor dem die Autor:inn:en flohen. Jetzt tragen sie nicht nur den Verlust der ehemaligen Heimat, nein, sie tragen an ihrer Zerstörung m i t. Die Elterngeneration wirft genau das den Kindern vor, die sich einzufügen lernten und denen die neue Sprache Sprache, die alte aber Vergangenheit wurde: „Ihr laßt unsere Sprache sterben.“ So daß auf eine perfide Weise die Schuld der Mörder zu einer Mitschuld nachgeborener Opfer wird. Hier in der Tat kann die Trauerrede nicht mehr die der und des Einzelnen sein, hier ist sie immer allgemein, ist überindividuell. Genau dies bedarf des Performativen, hier kam es gestern abend endlich zu sich.
Das erste war, ich verlasse mich auf den Klang, auf die Sprache sowohl als Botschaft als auch als Klang; also reduziere ich die Sinneseindrücke, die von ihm ablenken könnten. Somit: Es wird quasi dunkel. Dadurch fällt auch die Zuordnung des gesprochenen Wortes zur/m Sprechenden weg, denn dieser Klang wechselt die Orte.
Dieses erreichen die Künstler, indem auch sie mit Bluetooth-Lautsprechern arbeiten, die von der Decke hängen, teils auch ins Schwingen versetzt werden, kreiseln, so daß die Klänge kreiseln; im quasi-Dunklen eine enorme Hörerfahrung; andererseits lassen sie die Töne aber auch sich wieder personalisieren, indem die Autor:inn:en dann tatsächlich ihre Texte vortragen, sichtbar. Dabei wird auf eine möglichst geringe Varianz der Dynamik geachtet; das Reizvolle ist hier eben – Monotonie, Wiederholung, also Ritual, Liturgie. In der anschließenden, eher müßigen Diskussionsrunde sprach denn Varatharajah auch von „Gottesdienst“.
Es blieb allerdings nicht beim gesprochenen Wort; die Autor:inn:en bezogen sich auf ein Musikstück Steve Reichs, das in mit dem Vortrag amalgamierenden Zitatwehen auch eingespielt wurde und den Moment der wie infiniten Wiederholung noch verstärkte, aber eben nicht nur das, sondern zugleich die Entindividualisierung spürbar machte: daß die erzählten Schicksale zwar solche je Einzelner sind (andernfalls sie nicht empfunden werden könnten), aber als die Tausender Einzelner umfassend Tragödie – und zwar furchtbar unabhängig von der jeweiligen Herkunft, bedeutungslos, ob jemandes Vorfahren Tamilen, Serben, Syrier, Ghanaer, Vietnamesen, Kurden, Afghanen sind oder waren oder ob Deutsche, Franzosen, Engländer. Was in diesem Stück gestaltet wurde (und seine Form, eben, entspricht der Kondition des Künstlers, dem Tod – auf dessen Feld der Mord selbstverständlich mitsteht -, zumindest symbolisch eine Grenze zu setzen), ist ungeheuerlich: „Der Tod“, so der Programmzettel, „ist – als Ereignis, in Form von Krieg und Völkermord – die Bedingung der Möglichkeit und Wirklichkeit ihres Sprechens“, nämlich dem dieser Autor:inn:en. Das ist wahr. Doch damit lebe jemand mal! Daß ihnen eigentlich gar nichts übrig bleibt, als diesen entsetzlichen Umstand künstlerisch zu fassen und sich also über ihn hinauszuheben, war der Performance von der ersten Sekunde an anzumerken und blieb bis zur letzten präsent. Na gut, auf die Nebelmaschine hätten sie verzichten können, die war Tamtam.
 Interessant allerdings – beklemmend interessant -, wie auf das Stück ein Klopfen, Pochen, nein H ä m m e r n an die Eingangstür von jemandem paßte, der oder die wohl noch Einlaß begehrte. Das ging einige Zeit lang, wurde immer heftiger. Viele von uns meinten gewiß, ich selbst tat es auf jeden Fall, der durchaus rhythmisch-böse Krawall sei einkomponiert – bis einer der Gastgeber nach vorne ging und in die immer noch laufende Aufführung sprach, es gehöre diese Störung nicht dazu, sei eben eine. Das nahm dem Eindruck aber nichts, der das Unheil gleichsam aus dem Vergangnen in eine Drohung der Gegenwart drehte: Das Völkermorden auf dem Balkan fand in Europa statt. Auch Dich wird, schien das Hämmern zu wollen, was hier beklagt wird, treffen. Warte nur. Balde. Und die Vögelein schweigen nicht nur. So daß nicht nur gefragt werden mußte, ob der Tod, ohne den die Autor:inn:en dieses Stückes nicht Deutsch sprechen, lesen und schreiben würden, genau deshalb durch sie hindurchspricht und also Teil ihres Deutsches Tod immer sein wird, – sondern ob er selbst nicht direkt vor der Tür steht, durch die er jederzeit hereinbrechen könnte.
Interessant allerdings – beklemmend interessant -, wie auf das Stück ein Klopfen, Pochen, nein H ä m m e r n an die Eingangstür von jemandem paßte, der oder die wohl noch Einlaß begehrte. Das ging einige Zeit lang, wurde immer heftiger. Viele von uns meinten gewiß, ich selbst tat es auf jeden Fall, der durchaus rhythmisch-böse Krawall sei einkomponiert – bis einer der Gastgeber nach vorne ging und in die immer noch laufende Aufführung sprach, es gehöre diese Störung nicht dazu, sei eben eine. Das nahm dem Eindruck aber nichts, der das Unheil gleichsam aus dem Vergangnen in eine Drohung der Gegenwart drehte: Das Völkermorden auf dem Balkan fand in Europa statt. Auch Dich wird, schien das Hämmern zu wollen, was hier beklagt wird, treffen. Warte nur. Balde. Und die Vögelein schweigen nicht nur. So daß nicht nur gefragt werden mußte, ob der Tod, ohne den die Autor:inn:en dieses Stückes nicht Deutsch sprechen, lesen und schreiben würden, genau deshalb durch sie hindurchspricht und also Teil ihres Deutsches Tod immer sein wird, – sondern ob er selbst nicht direkt vor der Tür steht, durch die er jederzeit hereinbrechen könnte.
Es war enorm beklemmend.
Man hätte hiernach nichts weiteres mehr aufführung dürfen.
Indessen: Pause.
Alle müssen wir raus, weil umgebaut werde soll.
Es dauert. Ich habe meinen Hut drinnen liegen lassen. Dumm. Nicht nachgedacht, nicht richtig gefühlt. Ich wär jetzt mit gutem Gefühl gegangen.
Also wieder rein. Immerhin kommt Sascha Broßmann, zwar wie immer zu spät, doch habe ich so später wen zum Sprechen. Bei der anschließenden, von der eigentlich klugen und gewandten Daniela Seel schrecklich ungeschickt geführten Diskussion ächzt er mehrmals gequält auf, aber hat ja auch die große Performance verpaßt, mußte sich statt dessen mit dem nun gefolgten Wasserglas Rike Scheffers begnügen, in deren Text er immerhin, anders als ich, „einige schöne Stellen“ fand, doch ihre Elektrogerätebastelei ging auch ihm auf den Keks. Sie klopft mit dem Wasserglas (nachdem sie es freilich geleert und sicherheitshalber noch ausgeschüttelt hat) zweimal aufs Mikro und loopt später den aufgenommenen Ton; so auch mal mit dem angeprosteten Glas, so auch mit im Mund spülgegurgeltem Wasser, Blubberblubb, auch aufgenommen, auch geloopt und so weiter und so Getue unendlich mehr. Plötzlich mittendrin der Kothau vorm politisch Correkten: daß eben im Wasser auch die Fliehenden ertränken, und EUROPA! tue dagegen nichts, OH EUROPA!, tatsächlich so gutmensch-demagogisch rief sie so aus, so vorgeschürzt und gesichert betroffen, so restlos ungefährdet, daß mir fast die Kotze hochkam. Welch selbstgefällige und aber auch dumme Banalität: Sie habe das Wasser-selbst sprechen lassen wollen, erklärte uns nachher Frau Scheffer. Dabei war das Wasser, außer in der dreiachtelgefüllten Karaffe, gar nicht da, und manchmal ein wenig im Glas, alles andere die pure elektronische Entfremdung: Ent-Wässerung allen Wassers. Denn das Wasser mußte ja ausgeschüttelt werden, bevor es mit dem Element der Nässefeindlichkeit in Berühung käme. Und wer aber, zwei Monate liegt das Ereignis zurück, an einem anderen für experimentelle Künste wichtigen Berliner Ort – der Seven Stars Gallery in Mitte – die Underground-Cellistin Ashia Bison Rouge erleben durfte, weiß, wie überdies ärmlich Frau Scheffers Unternehmungen an der Elektronik sind; statt sich an sowas zu versuchen, sollte sie erstmal unverkopftere Texte schreiben. Denn: „Nichts klingt mit geschlossenem Beckenboden.“
Ich hätte gehen sollen in der Pause. Das bleibt wahr. Daß ich inde das dritte Stück des Abends niemals mehr vergessen werde. Wenn sich von einer Veranstaltung so etwas sagen läßt, hat sie sich mehr als gelohnt, und dem ausland sei ebenso tief wie den KOOKbooks gedankt.
ANH, 27. 6. 9. 2018
18.46 Uhr | Berlin

wenn sechs sich mit neun treffen, wird das wetter schön
oder meinetwegen auch: when six means nine, the weather will be fine
when six turns nine without a comment, the weather turns to be a torment
@Bruno Lampe:
Ich habe den erst „still“ korrigierten Fehler nun sichtbar korrigiert:
6.So entzieht sich Ihre schöne Bauernregel nicht länger dem Verständnis.