Dem wahren Schriftsteller sollten alle Leser egal sein,
außer einem: dem der Zukunft, der seinerseits nur die
Widerspiegelung des Autors in der Zeit ist.
Die Gabe, S. 554
(Alle Zitate in der Übersetzung Annelore Engel-Braunschmidts)
Dieser ist der letzte Roman, den Nabokov auf Russisch schrieb, seine gewissermaßen Conclusio des russischen Emigrantenmilieus nach der Flucht vor Revolution und Diktatur und – wie deutlich auch immer er’s bestreitet – sein „Portrait of the Artist as a Young Man„. Wie dort das intellectual awakening of young Stephen Dedalus als a fictional alter ego of Joyce erzählt wird, so läßt sich im Grafen Fjodor Godunow-Tscherdynzew unschwer ein Selbstbild des jungen Nabokovs erkennen, wenn auch verstellt in den Details — was nun besonders spannend ist. Denn das spätere Verfahren, vor allem in der „gefakten“ Biografie seines allerletzten, jedenfalls als letztem abgeschlossenen Romans, → „Look at the Harlequins!“, nämlich tatsächliche Geschehen mit fiktiven so zu amalgamieren, daß Rückschlüssen auf seine reale Person, auf ihre Geschichte und ihre Vorlieben einerseits gar nicht entgangen werden kann, sie andererseits aber ein begründeter, moralisch gesprochen, „Mißbrauch“ sind und, poetologisch gesprochen, unsauber interpretiert, mithin ein illegitimes Deutungsverfahren. Gleichsam hält der Roman seinen Leserinnen und Lesern eine Tafel vors Gesicht, auf der „Das bin ich, war ich“ steht, lesen sie es aber laut davon ab, wird diese Tafel als Fälschung denunziert: Mit ihm selbst habe das Buch gar nichts zu tun.
Ich bin nicht und war niemals Fjodor Godunow-Tscherdynzew; mein Vater ist nicht der Erforscher Zentralasiens, der ich eines Tages noch werden könnte; ich habe niemals um Sina Merz geworben und mir nie Sorgen um den Dichter Kontschejew gemacht. Tatsächlich erkenne ich eher in Kontschejew, aber auch in einer anderen Nebenfigur, dem Romancier Wladimirow, einige Elemente meiner selbst, so wie ich um 1925 war,
Die Gabe, 599
schreibt er 1962 in seinem „Vorwort zur englischsprachigen Ausgabe“. Wobei der Roman selber verräterisch dagegensteht:
Als Gesprächspartner war Wladimorow einmalig reizlos. Man warf ihm vor, er sei spöttisch, anmaßend, kalt, unfähig, in freundschaftlichen Diskussionen aus sich herauszugehen – aber das sagte man auch von Kontschejew und von Fjodor selber (Hervorhebung von mir, ANH).
Die Gabe, S.522,
wobei die Beteuerungen oder, je nachdem, Warnungen der nabokovschen Einlassungen freilich selbst schon poetologischer Trick sind, vermittels dessen die Fiktion noch höher in die Realität gehoben, gleichsam mit ihr verschmolzen wird — womit er etwas vorausnimmt, das unterdessen unsere faktische, auch politische Realität ist. „Kunst nimmt Wissenschaft vorweg“ , hat Thomas Hettche einmal geschrieben; ich gehe weiter: „Kunst nimmt Wirklichkeit vorweg.“ Wir spüren das kommende Geschehen, nicht unbedingt bewußt, nein, doch einem Geruch gleich, dem wir folgen. Künstler nehmen → Markierungen wahr, am Fuß der nächsten Straßenlaterne, an einer Hecke, an einer Hauswand. Nicht von ungefähr finden sich alle Spuren unten. Zugleich ist Nabokovs Verfahren eines gegen Dinglichkeit und also festgeschriebene Dogmen: Sieh her, ich erzähle von mir, aber bin nicht, von dem ich erzähle. Was auch insofern stimmt, als die Realität einer Romanfigur eine andere als die einer Realperson sein muß, denn beide unterstehen völlig anderen Zeitabläufen, diese dem linearen der normalen Tagesgeschehen, jene der auslassend springenden der Konstruktion. Selbst bei dem autobiografisch-extremen → Knausgård erfahren wir von seiner Figur allenfalls Ausschnitte; Identität wird über die Fiktion der Aussparung zusammengehalten, als hätte das Ausgesparte auf eine Realperson ebenfalls keinen Einfluß. In Realzeit läßt sich nicht schreiben; es wäre auch nur, andernfalls, der scheiternde Versuch einer lebenslangen Verdoppelung. Statt dessen tuscht Nabokov auf ein Blatt aus der objektiv-subjektiven Erinnerung, was ihm im Gedächtnis, und legt ein zweites Blatt auf die noch feuchte Tinte, worauf nun das fiktive Gewebe getuscht wird: Genau dies ist der künstlerische Prozeß. In ihm fließen beider Tinten ineinander, durch das saugende Papier hindurch; schon läßt sich die vermeintliche Autobiografie vom künstlerisch Gemachten nicht mehr trennen, mag sie auch der „erste Beweger“ gewesen sein. So wird selbst ein gemeintes (etwa bewußt karikiertes) Urbild übers mögliche Erkennen hinaus zu g e m a c h t e m Bild, mithin einem Geschöpf der Kunst, das atmen alleine in i h r kann. Dies ist, was die moderne „neue“, tatsächlich aber regressive Moral nicht sieht – sie ist modisch, nicht modern – oder sehen nicht will, um verdinglicht (eineindeutig) festschreiben lassen und aus den Festschreibungen Gesetze pressen zu können, die jede Mehrdeutbarkeit aus Denken und Handeln verbannen. Der Mensch wird replikant, noch bevor die Technologie Replikanten tatsächlich zu erschaffen vermag.
Dies war zu Nabokovs Zeiten noch nicht Gegenstand der Sorge, der „autobiografische Interpretationsansatz“ sehr wohl. Indem ich die künstlerische Bewegung, ihren Schöpfungsprozeß, quasi deterministisch erkläre, nehme ich dem Kunstwerk das Wunder, das es, wenn gelungen, aber ist. Ich erkläre es sozusagen hinweg und wische den metaphysischen Halo aus. So verkommt es zur tauschbaren Ware – was vor allem die Ökonomie will: Sie wird zum ersten Beweger. Immer wieder hat sich Nabokov dagegen gestemmt, seine Nach- und Vorworte wimmeln von Versicherungen, er teile zwar manches mit dem und dem „Helden“, s e i der aber keineswegs. Allzu deutlich muß ihm gewesen sein, wie groß hier die Gefahr ist, die denn auch von liebenden Gefolgsleuten mit befeuert wird:
(…) indem er einen fiktiven Vertreter seiner selbst
nämlich Godunow-Tscherdynzew
über einen fiktionalen Vater schreiben ließ und dabei auch seine eigene Skrupel mit hineinprojizierte. ‚Nabokov hatte sehr stark das Gefühl‘, schreibt → Boyd, ‚daß er das Beste in sich selber von seinem Vater hatte. Um das Bewußtein für seine Herkunft auf den Begriff zu bringen, wollte er [seinem Helden] Fjodor es seinem Vater an entdeckerischem Mut gleichtun lassen, aber auf seinem eigenen Gebiet, der russischen Literatur.‘
Die Gabe, S. 604
So trägt es Dieter E. Zimmer in seinem „Nachwort des Herausgebers“ vor — auf die Vaterfigur werde ich dezidiert u n t e n eingehen — und bezieht sich auf das Kapitel 4 der Gabe, das ein eigener, nämlich der Roman Godunow-Tscherdynzews, des Protagonisten, ist, den Nabokov ihn schreiben und auch publizieren läßt (und der in Kapitel 5 mit den üblichen Hämen und Faxen eines nicht nur Exilanten-Literaturbetriebs „kritisiert“ wird:
— was sich sogleich die Realität an die leeren Schläuche ihrer Brust nahm.
Die Redaktion der Pariser Emigrantenzeitschrift Sowremennyje sapiski, in
der 1938 bereits drei Kapitel des Romans erschienen waren, lehnte „Das
Leben Tschernyschewskis“ kurzerhand ab, und der damals mittellose
Nabokov „stimmte der Auslassung“, erzählt Dieter E. Zimmer, zähne-
knirschend zu“. So konnte der unverstümmelte Roman erst 1952
in New York erscheinen.)
Ich habe schon → im vorigen Beitrag festgestellt, wie sehr sich dieses Kapitel 4 auch stilistisch von dem übrigen Roman unterscheidet, ein Meisterstück für sich, und aber eben das wirkliche Kernstück des gesamten Buches, ohne das es — und ohne zwei weitere quasi-Binnengeschichten, die allerdings nicht in sich gerundet sind, sondern mit der Rahmenerzählung amalgamieren — fast etwas Beliebiges bekäme, als wäre es eine Kette aus in ihrer Präzision allerdings frappierenden, hier bisweilen abermals an Bilder George Grosz´ gemahnenden Erinnerungen an das Berlin der vergangenen Zwanzigerjahre:
Graue Beine alter Männer, mit Wucherungen und geschwollenen Venen bedeckt; Plattfüße, braungelbe Hornhaut von Hühneraugen; rosige Schweinsbäuche; nasse, zitternde, bleiche Halbwüchsige mit rauhen Stimmen; die Kugeln der Brüste; dicke Hintern, schlaffe Oberschenkel; bläuliche Krampfadern; Gänsehaut; die pickligen Schulterblätter krummbeiniger Mädchen; die fetten Nacken und Gesäße muskulöser Rowdys; die hoffnungslose, gottlose Leere zufriedener Gesichter; Balgereien, Gelächter, Geplansche – all das fügte sich zusammen zu einer Apotheose jener berühmten deutschen Gutmütigkeit, die mit Leichtigkeit jeden Augenblick in rasendes Geschrei umschlagen kann.
Die Gabe, S. 547/548
Gegen die hierunter liegende, stallgeruchshaft-allgegenwärtige Drohung geht Godunow-Tscherdynzew, schon um diesen Dungmiasma loszuwerden, besser schwimmen, mit welch grandioser Volte Nabokov in einem einzigen Absatz die übel haftende Essenz seiner Wahrnehmung verschiebt und seinen Helden damit rettet:
Nachdem er eine intime kleine Bucht zwischen den Binsen ausgesucht hatte, stieg Fjodor ins Wasser. Eine warme Undurchsichtigkeit umfing ihn, Sonnenfunken tanzten vor seinen Augen. Er schwamm lange, eine halbe Stunde, fünf Stunden, vierundzwanzig, eine Woche, noch eine. Schließlich, am achtundzwanzigsten Juni gegen drei Uhr nachmittags, ging er am anderen Ufer an Land.
Die Gabe, ebda. (547/548)
Es gibt in dem Buch viele solcher Stellen, die einem momentlang den Atem nehmen, so, wie wir, wenn wir wirklich staunen, nur noch schweigen können:
Drinnen im Möbelwagen lag ein kleines braunes Klavier auf dem Rücken, so daß es nicht aufstehen konnte (S. 13) — auf dem kleineren Tisch zwischen den beiden Einzelbetten, die bei Nacht weinten (S. 57) — hinter ihm befand sich ein (…) Bürogebäude, an dem so weit oben im Himmel Renovierungsarbeiten vonstatten gingen, daß es aussah, als könnte der ausgefranste Riß in der grauen Wolkendecke gleich mit repariert werden (S. 103) — seine prachtvolle, aber gänzlich unfruchtbare Stirn (S. 113) — Wie schwarz es durch diese Gitter nach Blättern und Erde riecht (S. 125)— ein Stückchen in der Wäsche verblichenen Regenbogens (S. 131)— in Berlin gibt es kleine Sackgassen, in denen sich bei Einbruch der Dunkelheit die Seele aufzulösen scheint (S. 143)— mit Augen, die für die Literatur zu gutmütig waren (S. 152)— beim Lesen von Puschkin wächst das Fassungsvermögen der Lungen (S. 159)—
— die Sätze häufen sich, es werden mehr und mehr … drum laß ich manches aus und springe weiter nach hinten:
— Aber sogar Dostojewskij erinnert irgendwie immer an ein Zimmer, in dem tagsüber eine Lampe brennt (S. 513) — mit breiten herabhängenden Schultern und dem geringschätzigen Ausdruck des Beleidigten (S. 519) — der Pneumothorax der Nacht (S. 530) — die erstaunliche Poesie der Eisenbahnböschungen, ihre freie und mannigfaltige Natur (S. 534) — (die) unvollendeten weißen Mauern (…) hatten (…) den schwermütigen Anschein von Ruinen angenommen, genau wie das Wort „irgendwann“, das sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft dient (S. 536) — Der Philosoph zieht Moos den Rosen vor (S. 539) — wenn beim Heranziehen einer Wolke die Luft selber sich wie ein großes blaues Auge zu schließen und dann langsam wieder zu öffnen schien (S. 541) — Das Flugzeug war bläulich, wie ein Fisch im Wasser naß ist (S. 543) — während er eine kleine Spannerraupe beobachtete, die feststellte, wieviel Zoll zwischen den beiden Schriftstellern lagen (S. 551) —
Doch zurück zum Binnenroman des vierten Kapitels, eines Meisterstücks noch aus einem weiteren, für Nabokov selbst durchaus untypischem Grund: Anders als sein Autor geht Godunow-Tscherdynzew mit seinem Erzählobjekt, der für die seinerzeitigen Sozialrevolutionäre intellektuellen Ikone Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewskij, zwar – siehe → dort – höchst kritisch und mit dem uns unterdessen gewohnt-beißenden Spott um, mitunter aber auffällig zärtlich, ja nicht selten liebevoll, indem er, Godunow-Tscherdynzew, in seinem „Das Leben Tschernyschewskijs“ stets das Leiden und die bösen Mißgeschicke, aber auch die Hoffnungen dieses russischen Ritters von der traurigen Gestalt ganz so im Blick behält, wie insgesamt der
geniale russische Leser das Gute (erfaßte), das der talentlose Romancier vergebens auszudrücken versucht hatte.
Die Gabe. S. 451
Nabokov läßt seinen schreibenden Godunow-Tscherdynzew eine ungewohnte Distanz zum ihm selbst eigenen Groll einnehmen, so daß der jugendliche Autor um eine moralische Objektivität bemüht ist, die dem lebenslangen Schmerz des tatsächlichen, „realen“ Autors versagt bleiben mußte. Alleine dies, daß es gelingt, ist grandios und wohl nur durch Nabokovs Konzentration auf die künstlerische Form, die möglichst perfekte Formung einer Figur zu erklären, die so tatsächlich vom ihm selbst unterschieden ist. Doch erklären weshalb? Bisweilen sollten wir einfach nur bewundern
(und lächelnd auch Nabokovs Häme über „die“ Psychoanalyse unerwidert stehen lassen; allzu deutlich ist, daß er sich mit den Schriften Freuds tatsächlich nie wirklich auseinandergesetzt hat, geschweige mit denen seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger; der in den Fünfziger- und Sechzigerjahren deutliche Schulterschluß von Psychoanalyse und dem dem Vertriebenen völlig zurecht widerlichen Marxismus besonders
sowjetischer Prägung dürfte es ihm ebenso unmöglich gemacht haben wie später die banale US-amerikanische Mode, sich für jedes Bauchnabelsausen einen persönlichen Seelenklempner als → Übergangsobjekt zu halten).
Tschernyschewskijs tiefste Wunde freilich ist wirkliche Not, der Freitod seines Sohnes nämlich, der wiederum als eigene Episode gleich am Anfang der Gabe erzählt wird. Eigentlich ist bereits sie eine Novelle-für-sich in dem Buch, die Liebesgeschichte einer ménage à trois, durch die spürbar Puschkin atmet:
Am schmerzvollsten wirkte sich Jaschas Tod auf den Vater aus. Den ganzen Sommer mußte er in einem Sanatorium verbringen, und richtig gesund wurde er nie wieder.
Die Gabe, S. 83
Und h ö r e n Sie, Freundin, wie Nabokov das erklärt:
Die Scheidewand, die die Zimmertemperatur der Vernunft von der unendlich häßlichen, kalten, geisterhaften Welt trennte, in die Jascha übergewechselt war, fiel plötzlich zusammen, und sie wiederaufzubauen (,) erwies sich als unmöglich, so daß man die Öffnung behelfsmäßig verhängen und versuchen mußte, nicht auf die sich bewegenden Falten zu achten.
Die Gabe, ebda.
Wobei das Geschehen selbst auch etwas von Goethes Wahlverwandtschaften hat, doch nur der Sprache nach klassisch, im Tiefsten vielmehr romantisch ist. Jascha, Rudolf und Olja lieben einander, teils „nur“ seelisch, aber teils auch begehrend; sie nennen es eine „euklidische Freundschaft“, nur daß
das einbeschriebene Dreieck ein anderes Beziehungssystem (war), verwickelt und quälend (…). Es war das banale Dreieck der Tragödie, entstanden in einem idyllischen Kreis, und schon
(kommentiert Godunow-Tscherdynzew)
das bloße Vorhandensein solch eines verdächtig wohlgeordneten Gefüges, ganz zu schweigen von dem modischen Kontrapunkt seiner Entwicklung, hätte mir niemals gestattet, daraus einen Kurzgeschichte oder einen Roman zu machen.
Die Gabe, S. 72
Weshalb Nabokov selbst die Erzählung als Sinnieren seines Helden mitgestaltet, was typischerweise s o klingt:
Er (Rudolf) war gutmütig, wenn auch nicht gut, gesellig und trotzdem ein wenig scheu, impulsiv und gleichzeitig berechnend. Endgültig verliebte er sich in Olja nach einer Fahrradtour durch den Schwarzwald mit ihr und Jascha, einer Tour, die, wie er später bei der gerichtlichen Untersuchung aussagte, „uns allen dreien die Augen öffnete“; er verliebte sich auf dem untersten Niveau, primitiv und ungeduldig, erhielt jedoch von ihr eine energische Abfuhr, die noch dadurch verstärkt wurde, daß Olja, ein träges, habgieriges, verdrießliches Mädchen (…) ihrerseits „erkannte, daß sie von Jascha hingerissen war“, den das ebenso bedrückte wie seine Leidenschaft Rudolf und wie Rudolfs Leidenschaft sie selber, so daß die geometrische Abhängigkeit ihrer einbeschriebenen Gefühle vollständig war (…).
Die Gabe, S. 73/74
Achten Sie, Freundin, auf die mathematische Wortwahl, die in engem Zusammenhang zu den Lehren steht, die Godunow-Tscherdynzew von seinem naturwissenschaftlichen Vater empfangen,
voll der wunderbaren Musik der Wahrheit (…), weil sie nicht von einem unwissenden Dichter, sondern von einem genialen Naturforscher geschrieben wurden.
Die Gabe, S. 197/198
Mathematik habe, schreibt Nabokov, die gleiche Beziehung zur irdischen wie die Religion zur himmlischen Beschaffenheit des Menschen:
Die eine wie die andere sind lediglich Spielregeln.
Die Gabe, S. 503
Jedenfalls kommen die drei Liebenden überein, sich gemeinsam zu töten, da sich das schmerzvolle Dreieck anders nicht mehr auflösen läßt. Ein Revolver ist zur Hand,
wanderte jedoch lange Zeit unauffällig von einem zum andern, wie im Spiel (…) die Karte mit dem Schwarzen Peter.
Die Gabe, S. 76
Schließlich begibt man sich in den Grunewald – Nabokovs Berliner Lieblingsgebiet, dem er unter Abzug der darin, siehe oben, befindlichen Deutschen geradezu Verklärungen widmet; mit „der Elektrischen“ fahren sie hin, diese drei, und finden
mühelos ein geeignetes abgelegenes Fleckchen und kamen sofort zur Sache; besser gesagt, Jascha kam zur Sache: Mit dem Recht des Älteren (…) sagte er, werde er sich als erster erschießen (…); er warf seinen Regenmantel ab und stieg ohne einen Abschiedsgruß an die Freunde (…) mit ungeschickter Hast den schlüpfrigen, kiefernbestandenen Hang hinunter in eine Schlucht, deren Dickicht aus Zwergeichen und Brombeergesträuch ihn trotz der Durchsichtigkeit des April(s) vollkommen vor den anderen verbarg.
Die Gabe, S. 79/80
Weshalb dann nur er, Jascha, sich erschießt, lesen Sie bitte bei Nabokov direkt,
denn hier senkt sich Dämmerung über die Geschichte.
Die Gabe, S. 81
Sie beschäftigt Nabokovs Helden sehr und ist vielleicht sogar der geheime Anlaß für seinen späteren Plan, über Jaschas Vater zu schreiben, dem er, und seiner Frau, in den Salons der Emigranten immer wieder begegnet, die die Atmosphäre der Rahmenerzählung ausgesprochen prägen — und auch Ausflucht (Nabokov unangemessenerweise schreibe ich mal, aber nur in Klammern, den Terminus der Verschiebung hin), indem er „Das Leben Tschernyschewskijs“ verfaßt statt des eigentlich geplante Romans über seinen eigenen Vater, der dennoch einen enormen Anteil an der Gabe hat.
Wie soll ich die Wonnen meiner Spaziergänge mit Vater durch die Wälder, die Felder und die Torfmoore beschreiben oder den unablässigen sommerlichen Gedanken an ihn, wenn er fort war, den ewigen Traum, eine Entdeckung zu machen und mit ihm dieser Entdeckung entgegenzutreten; wie soll ich das Gefühl beschreiben, das ich hatte, als er mir all die Stellen zeigte, an denen er in seiner Kindheit dieses oder jenes gefangen hatte — den Balken einer halbverrotteten kleinen Brücke, wo er im Jahre 71 sein erstes Tagpfauenauge gefangen hatte, die abschüssige Straße zum Fluß hinunter, wo er weinend und betend zugleich auf die Knie gefallen war (?) (er hatte seinen Fang verpatzt, der Falter war auf immer davongeflogen!)
Die Gabe, S. 177/178
So verschmilzen die Tuschen, Godunow-Tscherdynzews und Nabokovs Vater:
Wie dem auch sei, ich bin überzeugt, daß unser Leben damals wirklich von einem Zauber erfüllt war, der anderen Familien unbekannt war. (…) Dem entleihe ich heute meine Flügel.
Die Gabe, S. 188/189
Daß er, Godunow-Tscherdynzew, von dem Vaterroman schließlich Abstand nimmt und sich Tschernyschewskij zuwendet, begründet er – „rationalisierend“ – wie folgt:
Siehst Du, ich habe erkannt, daß es unmöglich ist, die Bilder seiner Reisen zum Keimen zu bringen, ohne sie mit einer sekundären Poetisierung anzustecken, die mehr und mehr von jener wirklichen Poesie abweicht, mit der die lebendige Erfahrung aufnahmefähiger, kenntnisreicher und keuscher Naturforscher die eigenen Untersuchungen ausgestattet hat.
Die Gabe, 227
Wenn Zimmer oben von „Skrupeln“ sprach, hier ist das Beispiel schlagend. (Ich bin sehr gespannt darauf, ob und wie Nabokov sie in seinem Erinnerung, sprich auflösen wird, das ich noch nicht kenne – ein Buch, das ich erst ganz zuletzt lesen will, auch wenn es bereits vor Ada erschien.)
***
Abschließend noch eine Bemerkung quasi zur Zeit — der unseren, jetzigen nämlich. „Die Gabe“ ist auch aus anderem Grund interessant, der es aus der Literaturgeschichte gleichsam herauslöst und unmittelbar aktuell macht, und prekär. Es wird ja bereits – besonders mit dem aktuellen → „Fall Matzneff“ – darüber gestritten, ob nicht schon die  D a r s t e l l u n g pädophiler Gedanken, also auch ihre künstlerische Durchformung, strafbewehrt werden müsse. Damit würde ein Aspekt von Wirklichkeit qua Tabuisierung in die Verdrängung gezwungen; niemand dürfte mehr sagen, was ist, wenn es ist. Der ausgesprochene und geschriebene Gedanke als Staatsfeind der Moral. Davon wäre dann auch, und sicherlich im sofort folgenden praktischen Vollzug, Nabokov betroffen, der in einer Szene seinen Vermieter das Nymphenthema anklingen läßt, das später → Lolita bestimmen wird, aber von Nabokov selbst bereits zwei Jahre später, also 1939, schon einmal ausgeführt wird, und zwar in der Erzählung „Der Bezauberer“, auf die ich in meiner Betrachtung des zweiten Erzählbands eingehend zu sprechen kommen werde. Hier, bei dem Vermieter Schtschjogolew (dem unangenehmen Stiefvater Sina Merzens, in die sich Godunow-Tscherdynzew verliebt) hat das Motiv noch einen primitiven, häßlichen Ton:
D a r s t e l l u n g pädophiler Gedanken, also auch ihre künstlerische Durchformung, strafbewehrt werden müsse. Damit würde ein Aspekt von Wirklichkeit qua Tabuisierung in die Verdrängung gezwungen; niemand dürfte mehr sagen, was ist, wenn es ist. Der ausgesprochene und geschriebene Gedanke als Staatsfeind der Moral. Davon wäre dann auch, und sicherlich im sofort folgenden praktischen Vollzug, Nabokov betroffen, der in einer Szene seinen Vermieter das Nymphenthema anklingen läßt, das später → Lolita bestimmen wird, aber von Nabokov selbst bereits zwei Jahre später, also 1939, schon einmal ausgeführt wird, und zwar in der Erzählung „Der Bezauberer“, auf die ich in meiner Betrachtung des zweiten Erzählbands eingehend zu sprechen kommen werde. Hier, bei dem Vermieter Schtschjogolew (dem unangenehmen Stiefvater Sina Merzens, in die sich Godunow-Tscherdynzew verliebt) hat das Motiv noch einen primitiven, häßlichen Ton:
Stellen Sie sich vor: Ein alter Knabe – aber noch voll im Saft, feurig, und lechzt nach Glück – lernt eine Witwe kennen, und die hat eine Tochter, noch ganz und gar Mädchen – Sie wissen, was ich meine – noch keine Kurven, aber sie hat bereits eine Art zu gehen, die einen zum Wahnsinn treibt. Ein schmales kleines Ding, sehr zart, blaß, bläulich unter den Augen – und natürlich schenkt sie dem alten Bock keinen Blick. Was tun? Also, er besinnt sich nicht lange und heiratet kurz entschlossen die Witwe (des Mädchens Mutter, ANH). Schön. Sie richten sich zu dritt ein. Hier kann man endlos weitermachen – die Versuchung, die ewige Qual, das Jucken, die wahnwitzigen Hoffnungen,
Die Gabe, S. 303,
die sich in Lolita dann erfüllen. Die ganze Konstruktion des späteren, so berühmten Romans ist hier bereits geprägt, so daß schon „Die Gabe“ Nabokovs (unscharf ausgedrückt:) „pädophile“ Dynamik berührt, die jetzt – mit Matzneff im Strome #metoos – auch poetisch gebrandmarkt werden soll. Damit würde einmal mehr die nicht nur ungute, sondern tief verhängnisvolle, zugleich dekadente Körper-, mithin Sexualfeindlichkeit als gendercorrect festgeschrieben werden — , nämlich als ökonomisch-säkularisiertes Tabu, das die Gentechnologie immer wünschbarer und schließlich im Wortsinn notwendig macht: nicht mehr körperlich gezeugte Kinder, sondern vermittelte aus der Retorte, replikant wie replizierbar und also ohne Ambivalenzen. Der Satz vom Ausgeschlossenen Dritten als Mensch, und
Die Strategie der Inspiration und die Taktik des Geistes, das Fleisch der Poesie und das Phantom luzider Prosa
Die Gabe, S. 17
würden nichts mehr bedeuten. Es bliebe nur noch
Das peinliche Gefühl, mit dem für gewöhnlich unsere Nacktheit einhergeht,
Die Gabe, S. 543
weil sie
an das Bewußtsein unserer wehrlosen Weiße gebunden (ist), die schon lange jegliche Verbindung zu den Farben der Umwelt verloren hat und sich deshalb in künstlicher Disharmonie mit ihr befindet.
Die Gabe, ebda.
Wie hoffnungsvoll konnte sich d a s aber aufschwingen, n o c h:
Doch die Wirkung der Sonne gleicht diesen Mangel aus, stellt uns mit unserem Recht auf Nacktheit der Natur gleich, und der gebräunte Körper kennt keine Scham mehr. All das klingt nach Nudistenbroschüre – aber die eigene Wahrheit kann nichts dafür, wenn sie übereinstimmt mit der Wahrheit, die ein armer Kerl sich geliehen hat.
Die Gabe, ebda.
 Von dieser Wahrheit abgelöst, bleibt nur der „arme Kerl“ zurück. Allein und ohne Natur.
Von dieser Wahrheit abgelöst, bleibt nur der „arme Kerl“ zurück. Allein und ohne Natur.
>>>> Nabokov lesen 19
Nabokov lesen 17 <<<<

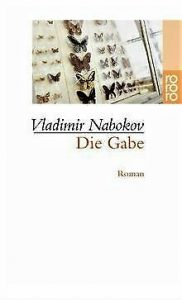
Sie sollten einen Posten in der literaturwissenschaftlichen Abteilung Germanistik einer Universität inne haben. Dafür, in Nabokovs Gabe diese Stellen bemerkt zu haben, für die Wortwahl: „die einem momentlang den Atem nehmen“.
Nachdem er eine intime kleine Bucht zwischen den Binsen ausgesucht hatte, stieg Fjodor ins Wasser. Eine warme Undurchsichtigkeit umfing ihn, Sonnenfunken tanzten vor seinen Augen. Er schwamm lange, eine halbe Stunde, fünf Stunden, vierundzwanzig, eine Woche, noch eine. Schließlich, am achtundzwanzigsten Juni gegen drei Uhr nachmittags, ging er am anderen Ufer an Land.
Die Gabe, ebda. (547/548)
Es gibt in dem Buch viele solcher Stellen, die einem momentlang den Atem nehmen, so, wie wir, wenn wir wirklich staunen, nur noch schweigen können:
Drinnen im Möbelwagen lag ein kleines braunes Klavier auf dem Rücken, so daß es nicht aufstehen konnte (S. 13) — auf dem kleineren Tisch zwischen den beiden Einzelbetten, die bei Nacht weinten (S. 57) — hinter ihm befand sich ein (…) Bürogebäude, an dem so weit oben im Himmel Renovierungsarbeiten vonstatten gingen, daß es aussah, als könnte der ausgefranste Riß in der grauen Wolkendecke gleich mit repariert werden (S. 103) — seine prachtvolle, aber gänzlich unfruchtbare Stirn (S. 113) — Wie schwarz es durch diese Gitter nach Blättern und Erde riecht (S. 125)— ein Stückchen in der Wäsche verblichenen Regenbogens (S. 131)— in Berlin gibt es kleine Sackgassen, in denen sich bei Einbruch der Dunkelheit die Seele aufzulösen scheint (S. 143)— mit Augen, die für die Literatur zu gutmütig waren (S. 152)— beim Lesen von Puschkin wächst das Fassungsvermögen der Lungen (S. 159)—
Danke für diese Stellen. Sie erinnern mich an Ihre Sizilische Reise (über den Vucciria Markt, S. 17): „…man findet einige Knochen von ihm in einer Seitengasse….Bevor die streunenden Hunde kommen, die Palermo in ständiger Suche nach Aas und Küchenresten und räudig aus Furcht vor Schlägen durchstreifen, zerhackt man ihn. Serviert tags darauf sein Fleisch auf dem Grill. Augen, Hoden und Glied läßt man den Hunden.“
Wer rechnet denn mit sowas? Wahnsinnig originell diese Stelle.
Wenn Ihre eigenen neu erschienenen Erzählungen doch einmal von einer guten Hand so kommentierend öffentlich begleitet würden, wie Sie’s derzeit für Nabokov tun! Ich bewundere Ihre Erzählungen mindestens ebensosehr, wie Sie Nabokov verehren.
Leider bin ich ein Leseluder geworden: Ich zieh‘ mich zurück, verschling‘ an Texten, was mir gefällt, schaufle rechts und links beiseite, was mir zu schwer, zu leicht oder sonst irgendwie misshaglich ist, freu‘ mich alleine und wein‘ auch allein, kurz, beim Lesen bin ich inzwischen egoistisch bis ins Mark und behalte meine Eindrücke im warmen Stall, statt sie raus in den harschen Wind zu treiben. Aber –
aber hallt nicht auch im widerhall ein tränchen, das sich wandelnd erfindet einen wasserfall? es stiebt so hin und her im harschen wind, im rauschen findet ohr sein kind.
Interessant, sogar etwas frappierend: Als ich eben, weil ich meinte, Ihr (lyrischer) Einwurf sei womöglich ein Zitat – ist es eines? -, führte mich Ecosia, meine Suchmaschine, >>>> auf diesen uralten Dschungeleintrag, der unversehens von äußerster Modernität zu sein scheint (ohne aber, daß sich das vemeintliche Zitat überhaupt darin findet).
nein, es ist kein zitat, es ist gestern so ad hoc entstanden.