[Arbeitswohnung, 7.15 Uhr]
Anders, oh Freundin, hatte ich gestern geplant, heute früh mein Journal zu beginnen. Bereits der Titel war nicht so formuliert wie jetzt. Sondern über die Wirren wollt‘ ich mich lustig machen, die mich mehr als nur zwei Tage lang mehr oder minder dauernd auf einen Bildschirm starren ließen, der ein Männchen zeigte, wie es langsam, langsam eine dunkle, doch hinter ihm sich ergrünende Zeile einem Ziele entgegen voranschritt, das mir bedeuten würde, nun ![]() „sei ich dran“:
„sei ich dran“:
Doch dann kam die Nacht, von der ich nicht weiß, was ich träumte vielleicht … — mir träumte, trifft es, fürchte ich, besser. Es ist wohl kein Zufall, daß ich mich gestern entschloß, von all den noch nicht in Der Dschungel erfaßten Essays ausgerechnet → diesen da jetzt einzustellen, in dem es – in poetisch weitem Sinn – um Entkörperlichung geht, die ich dort noch affirmierte, Neunzehnhundertsiebenundneunzig. Das „dort“ heißt „seinerzeit“.
Viele meiner Texte hatten sich in diese Richtung bewegt. Im WOLPERTINGER streben die 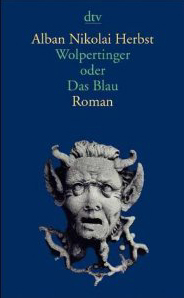 Geister in den Computer, um am Leben zu bleiben, Naturgeister, wohlgemerkt, und Elberich Lipom, einer ihrer politischen Führer, muß ganz am Ende beinah versagen, der er, wie seine Frau, so auf der Seite der Körper steht. Sie alle finden ihren schließlichen Platz auf etwas, das es heute und zu Beginn der ANDERSWELT-Bücher eigentlich schon gar nicht mehr gibt: auf einer kleinen Diskette, die nunmehr — der sozusagen running gag in Gestalt eines quadratisch-flachen Relikts einer technischen Vorzeit — die Trilogie von Hand zu Hand begleitet, bis schließlich ihr Inhalt in den Europäischen Zentralcomputer eingespeist wird, woraufhin, so sieht es aus, die Zivilisation gänzlich zusammenbricht und die Erde, Erda, sich aufs neue erhebt. In einer Lesart. Tatsächlich bleibt das Ende offen, ganz so wie noch heute für uns.
Geister in den Computer, um am Leben zu bleiben, Naturgeister, wohlgemerkt, und Elberich Lipom, einer ihrer politischen Führer, muß ganz am Ende beinah versagen, der er, wie seine Frau, so auf der Seite der Körper steht. Sie alle finden ihren schließlichen Platz auf etwas, das es heute und zu Beginn der ANDERSWELT-Bücher eigentlich schon gar nicht mehr gibt: auf einer kleinen Diskette, die nunmehr — der sozusagen running gag in Gestalt eines quadratisch-flachen Relikts einer technischen Vorzeit — die Trilogie von Hand zu Hand begleitet, bis schließlich ihr Inhalt in den Europäischen Zentralcomputer eingespeist wird, woraufhin, so sieht es aus, die Zivilisation gänzlich zusammenbricht und die Erde, Erda, sich aufs neue erhebt. In einer Lesart. Tatsächlich bleibt das Ende offen, ganz so wie noch heute für uns.
Vorgedacht, die Entwicklung, aber hatte ich schon. Weniger ich selbst als die Strukturen es taten, denen diese Bücher folgen: daß der Weg vom Körper weg ins Virtuelle längst beschritten. Ich sah es als quasi Evolution, als eine notwendige, wobei ich das „not“ schon immer betonte, Emanzipation vom körperlichen Gebrechen, womit indes zugleich das, ich möchte schreiben, Wunder des Körpers kaputtging, das uns als Schönheit und Lust geschenkt ist.
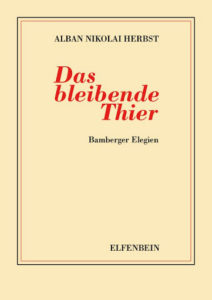 Spätestens mit den Bamberger Elegien drehte sich meine Perspektive.
Spätestens mit den Bamberger Elegien drehte sich meine Perspektive.  Das trauernde MEERE hat dies eingeleitet, der Verlust, → der das Geheimnis der Schönheit dieses Romans ist. Indes ich aber parallel, in den zwölf Jahren, → in denen ARGO entstand, dem Vorgedachten weiterfolgte: die Entkörperlichung, die Ungefugger fast calvinistisch bis zur schließlich kompletten Digitalisierung der Welt vorantreiben will und vorantreibt und die ihm und den Seinen auch beinah gelingt. Bis die Diskette dann wieder ins Spiel kommt, die eigentlich schon gar nicht mehr gelesen werden kann.
Das trauernde MEERE hat dies eingeleitet, der Verlust, → der das Geheimnis der Schönheit dieses Romans ist. Indes ich aber parallel, in den zwölf Jahren, → in denen ARGO entstand, dem Vorgedachten weiterfolgte: die Entkörperlichung, die Ungefugger fast calvinistisch bis zur schließlich kompletten Digitalisierung der Welt vorantreiben will und vorantreibt und die ihm und den Seinen auch beinah gelingt. Bis die Diskette dann wieder ins Spiel kommt, die eigentlich schon gar nicht mehr gelesen werden kann.
Was lief dem parallel, tatsächlich, in unserer realen Welt? Also neben den Kriegen, die auf 9/11 folgten? (Und worum wurden sie letztlich geführt?) Schon AIDS hatte mit der Unbedenklichkeit unserer körperlichen Vereinigungen Schluß gemacht; ich erinnere mich einer spöttischen Fiktion, in der ich die Krankheit hatte vom Vatikan in Auftrag geben lassen. Die „Moral“ stand plötzlich immer mehr im Fokus, gegen die sich zugleich einige Szenen formierten. Während das Nahost der arabischen Welt am feudalen, feudalistischen Mittelalter hängen blieb, sich daran krampfte und ins Jerusalem der Neuzeit, New York City als Stellvertreter der gesamten westlichen Industriewelt, seine meuchelnden Kreuzritter fast genauso schickte, wie es diese, als sie selbst noch feudal war, ein paar Jahrhunderte vorher nach dort getan hatte, virtualisierte sie sich immer mehr. Donna Harraways Diagnose, daß wir alle Cyborgs längst seien, stand wie ein Mahnmal im Raum, ungeheuer. Und Judith Butlers Thesen, die schließliche, zunehmende Dekonstruktion des Geschlechts — also der irdischen Biologie, die mehr und mehr unter ein moralisches Sollen gebeugt wurde und heute fast de facto schon wird.
Dagegen mein, ich nenn es mal so, poetisches Aufschrein. Umso bedrückter, je älter ich wurde. Dabei lag alles auf genau der Linie, die ich vorher durchdacht und poetisch mitgestaltet hatte. Aber das Gefühl des Verlusts wurde größer und größer.
Zum Beispiel meine Weigerung, Brötchen bei einem Bäcker zu kaufen, deren Angestellte sich Latexhandschuhe anziehn, bevor sie sie, die Semmeln, in eine Tüte tun. Wie oft habe ich solch eine Backstube dann verlassen, „tut mir leid, ich will, daß Sie meine Brötchen berühren!“ Die ständige Sorge, sich bei irgendwas zu infizieren. Der permanente Ruf nach Kondomen. Der Verdacht gegens Sekret, das doch englisch, secret, Geheimnis. Zwischen Körper und Körper, die für den Austausch geschaffen, ständige Grenzen. Und nun, mit Corona, der Mundschutz. Nicht einmal Lächeln mehr möglich.
Es muß erlaubt sein, dies in einer überblickenden Spekulation zu bedenken — zu interpretieren, heißt das; oder ihm, in meinem Metier, eine Geschichte zu erzählen, die nun, auf beklemmende Weise, ganz mit dem zusammengeht, was ich spätestens in den Neunzigern zu erzählen angefangen habe. Sie erzählt sich, diese Geschichte, furchtbar bruchlos weiter, ging über mich und meine poetische Entwicklung bedingungslos hinweg.
Das ist der Grund der Beklemmung, die ich bereits gestern empfand; aber noch schleichend nur stieg sie auf und war heute morgen beim Erwachen unabweisbar da. Indem ich die Augen aufschlug. Und den Titel änderte, kaum daß ich am Schreibtisch saß, dieses heutigen Arbeitsjournals.
Ich verstehe die Notwendigkeit, bin faktisch Drostens Meinung, daß, fortan einen Mundschutz zu tragen, auch ein Zeichen der Rücksichtnahme aufeinander ist, der Sorge füreinander, ob wir nun Symptome haben oder nicht. Aber gerade, daß ich’s verstehe, ja verstehen muß, ist ein Indiz der Unabwendbarkeit dessen, was ich abwenden unbedingt will. Die Entfernung von unsren Körpern, unsre physische Entfremdung, setzt sich fort. So gesehen, steht Corona — wie AIDS schon zuvor — Seite an Seite mit der Gender-Doktrin und diese neben der Gentechnologie zur schließlichen, einer in erster Linie „moralischen“, Replikantisierung des Menschen. Wir streben danach (werden danach gestrebt), ganz „sauber“, in Ungefuggers Worten: „rein“, und also technisch zu werden, so, wie umgekehrt die tatsächlich technischen (künstlichen) Geschöpfe der ANDERSWELT Mensch werden möchten. Deidameia, in BUENOS AIRES der Rebellinnen Anführerin, drückt es so aus:
Wir sind für Willkür, Hans Deters. Wir wollen Ekstase, nicht Ordnung. Dafür kämpfen wir, ja, auch mit Gewalt. Und meine Holomorphen… wenn sie sich wirklich autonomisieren wollen, müssen die Leidenschaft lernen. Das geht ihnen ausgesprochen gegen die Ontologie. Wer nur aus 1 und 0 besteht… (…) Nun aber vertreten wir das Menschenrecht auf Unmoral und bringen den Programmen das Tanzen bei.
Buenos Aires . Anderswelt, S. 223
Ja, es ist sinnvoll und nötig, den Mundschutz zu tragen, ist ein Zeichen der Rücksichtnahme, sogar der Solidarität, aber zugleich Symbol akzeptierter Entfremdung.
Aus einer weniger, ich schreibe mal, „geschichtsphantastischen“ Perspektive hat vor vier Tagen Phyllis Kiehl sehr persönlich und mit deutlich leichterer Hand als ich beschrieben, was soeben  geschieht. Fast tänzerisch → nennt sie uns Aerosolisten:
geschieht. Fast tänzerisch → nennt sie uns Aerosolisten:
***
Da mag nun auch ich etwas tanzen.
Bekanntlich hat das Berliner Land eine Soforthilfe II auch für Künstler ins Leben gerufen. Tatsächlich platzen uns allen die Aufträge weg. Lesungen können nicht mehr durchgeführt werden, wenn wir nüchtern gucken: auf ziemlich unabsehbare Zeit. Aber auch neue zu akquirieren, ist über die sowieso schon klammen Chancen hinaus fast unmöglich geworden, einfach, weil Veranstalter keine Verpflichtungen ins Ungewisse hinein auf sich nehmen wollen. Das ist verständlich, und immer mehr verschiebt sich ins Netz, in dem wir alle aber kaum je verdienen. Auch meine ständige Arbeit, für Die Dschungel, bringt nichts ein — oder nur selten, wenn etwa eine Leserin oder ein Leser mal einen Hunderter in einen Briefumschlag tut. Kommt vor, aber ist höchst rar. Nein, keine Bitte, schon gar keine Klage. Es geht mir um Dichtung und darum, das, woran ich aus der „alten“ Buchkultur glaube, in die Neue Zeit, die angebrochen ist, hinüberzuführen, vielleicht drin zu retten, nun jà, wenigstens ein bißchen was davon.
Ich empfinde es als poetische Verpflichtung. Die Teile müssen, wie in einer Collage Ror Wolfs, an den Nähten geradezu unsichtbar ins Gewebe eingefügt werden. Daran arbeite ich, seit es Die Dschungel gibt. Doch es hat mich, wie Sie, Freundin, wissen, immer wieder in ökonomische Engen gedrückt, zuletzt im vergangenen Dezember. Wovon ich grad lebe, ist weniger als wenig. Es läuft auch nur noch bis Mai. Da sollte wieder die erste große Veranstaltung sein, die etwas einbringt, und weitere würden folgen. Dessen konnt‘ ich schon sicher sein. Doch dann kam Corona.
Derzeit ist quasi alles, was geplant und schon abgemacht war, in Frage gestellt. So lag es nicht nur nahe, sondern war ein Gebot der Notwendigkeit, daß auch ich diese Soforthilfe beantragen würde.
Man konnte es tun seit vorigem Freitag, mittags um zwölf.
Ich probierte es erstmals da um halb eins. Es war auf die Site kein Hineinkommen. Ich probierte es unentwegt bis 15 Uhr. Dann erwischte ich eine, sagen wir, Lücke — und war drin. Aber: Vor mir hatten schon 117.361 Leute den Antrag gestellt, ich meinerseits bekam die Nr. 124.611 und möge nun bitte auf eine Email warten, die mir bescheiden würde, jetzt sei die Bahn für mich offen — für den Antrag, wohlgemerkt. Ich möge bitte, wenn diese Email eingehe (und ich solle drauf achten, daß sie im Spamordner landen könne), möglichst sofort den entsprechenden Link anklicken, um dann das nötige Verfahren zu durchlaufen. Meine Wartezeit betrage mehrere Stunden.
Ich habe Ihnen, Sie wissen’s, dazu → schon dort geschrieben.
Auf einem meiner Bildschirme blieb nun das Postfach immer geöffnet, und dauernd, dauernd starrte ich hin. Sehr spät abends, fast halb zehn, kam die Nachricht. Und ich brach alles andere ab, ging auf die Site.
Sie öffnete sich auch, und ich begann. Schwierig war nur schon, daß ich ankreuzen sollte, nicht bereits vor dem, ich glaube, 17. 3. in Liquiditätsschwierigkeiten gewesen zu sein. War ich aber. Nur daß es ja jetzt um was anderes ging, nämlich daß mir ab dem Mai alles zusammengebrochen. Wenn ich bis dann aber wartete, wären die von Land und Staat zur Verfügung gestellten Gelder längst aufgebraucht. — Was also tun?
Doch es gab noch ein anderes Problem. Ich hatte mich als Alban Nikolai Herbst angemeldet, wie ich es immer tu, unter welchem Namen auch mein Bankkonto läuft und eigentlich alles sonstige auch — die Steuerbescheide und die Nachrichten der KSK gehen immer an beide Namen —, jetzt aber sollte ich die Nr. meines Personalausweises eingeben, in den der Künstlername zwar eingetragen ist, aber weiß ich denn, ob das dann auch bei den Bearbeitern auftaucht? Nein, wußte ich nicht. Und entschied mich, den angegebenen Namen in den Ribbentrop zu ändern und ANH in das Feld für die Firmenbezeichnung einzusetzen … war eine Lösung, ja, und auch passend, weil „Firma“ schlichtweg „Name“ heißt und „firmare“ „unterschreiben“. Also auf ZURÜCK geklickt.
Und damit warf das Programm mich raus.
Komplett raus.
Es war auch kein Hineinkommen mehr. Statt dessen erhielt ich die Nachricht, ich sei ans Ende der Schlange zurückgeschickt worden und hätte nunmehr die Nummer 295.208. Ich möge auf die entsprechende Email warten und mich dann unverzüglich einloggen.
Ich nahm es, wenngleich verärgert, wie es war: komisch. Komisch verärgert.
Noch.
Denn zwar nutzte ich am nächsten Morgen das Kontaktformular der IBB, um den Vorfall zu schildern und vielleicht dann doch wieder vorgerückt zu werden. Aber obwohl ich zweimal alles ausfüllte und dann wegzusenden versuchte, wurde ich jeweils beschieden „Page not found“. Ich versuchte es abermals, diesmal beim für meinen Kiez zuständigen Sachbearbeiter. Doch auch da:

Gut es war Wochenende, mir taten die Mitarbeiter auch leid. Der Server sei unter dem Ansturm dort mehrmals zusammengebrochen, las ich am Sonntag.
Nun versuchte ich es gestern telefonisch, die Nummern waren angegeben, sind es noch. Nach dem Wählen einer jeden kommt das Freizeichen. Und kommt und kommt und kommt. Nicht mal ein Callcenter scheint es zu geben. Dabei hätte ich die Angelegenheit mit der Liquidität gerne ebenso geklärt wie mit meinen beiden Namen.
Keine Chance.
Dann, abermals fast nachts, die Email, ich sei nun fast dran.
Sofort hin!
Das Männchen noch ganz am Anfang der Strecke. Ich müsse mit „mehr als einer Stunde“ rechnen.
Es wurden über achtzehn Stunden. Das Männlein bewegte sich Schrittchen für Schrittchen, ich starrte es immer und immer neu an. Schließlich gab es das folgende Bild, da facetime ich grad mit Frau Kiehl:

„In zwanzig Minuten bin ich dran!“ rief ich aus. Und so war es schließlich auch. Wirklich. Das Verfahren lief sogar weitaus schneller als beim ersten Mal. Plötzlich gab es auch nicht mehr die Frage nach der vorherigen Liquidität. Seltsam. Auffallen tat’s mir aber erst, nachdem ich alles schon ausgefüllt und weggeschickt hatte. Wobei der letztanzuklickende Button WEGSENDEN UND DRUCKEN hieß. Das zweite geschah nicht, ärgerlicherweise, so daß ich keine Kontrolle habe, und ob erstres, kann ich jetzt nur glauben:

Unterdessen habe ich gelesen, es habe unter den Tausenden Anträgen bereits einige Betrugsversuche gegeben. Was mich zusätzlich unruhig macht. Falle ich selbst vielleicht darunter? Denn ich kann nicht, ohne die Sicherheit, diesen Zuschuß auch zu bekommen, dem Jobcenter adé sagen — was ich doch gar zu gern täte. Deshalb werde ich es folgendermaßen halten. Sollte das Geld der Soforthilfe eingehen, dann aber schon auch das Jobcentergeld, werde ich dieses umgehend zurücküberweisen und mitteilen, auf die laufende Hilfe derzeit nicht mehr angewiesen zu sein, und auch den Grund dafür nennen. 5000 Euro reichen mir für ungefähr vier, vielleicht auch fünf Monate, finanziell lebe ich durchaus genügsam. Danach werde ich weitersehen; mit ein bißchen Zuversicht werden ab September zumindest die Seminare wieder stattfinden können; dann steht auch die erste Hochzeit an, für die ich wieder einen Redeauftrag habe. Ob allerdings in Italien ..? Außerdem hat mir der Deutschlandfunk die Wiederholung eines meiner Hörstücke in vorsicht’ge Aussicht gestellt.
Dieses, Freundin, jedenfalls wollte ich Ihnen aus meiner, sagen wir, GradTagesPraxis erzählen und habe es nunmehr getan.
Ihr ANH
10.51 Uhr
P.S.:
Ich höre derzeit fast keine Musik, lausche nur immer, sowie sie drauß‘ singen, den Vögeln.

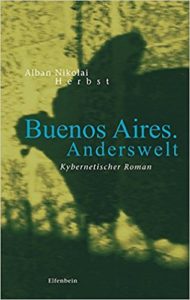
Bravo Alban ! Ich habe mitgefiebert. Das Soforthilfe Geld wird kommen. Ganz gewiss.
Na hoffentlich. Ist das aufregend! Ich denke, auf das Jobcentergeld müssen Sie nicht verzichten. Wie‘s weitergeht ist doch höchst ungewiss. Diese Torschlusspanikmache finde ich auch ganz schlimm. Die Angst, dass man, obwohl berechtigt, zu spät dran sein könnte. Wie beim Run aufs Klopapier ist das. Unwürdig. Und gleich sind auch die Betrüger zur Stelle. Perfekt war das so sehr Komplizierte in dieser kurzen Zeit wohl kaum zu lösen.