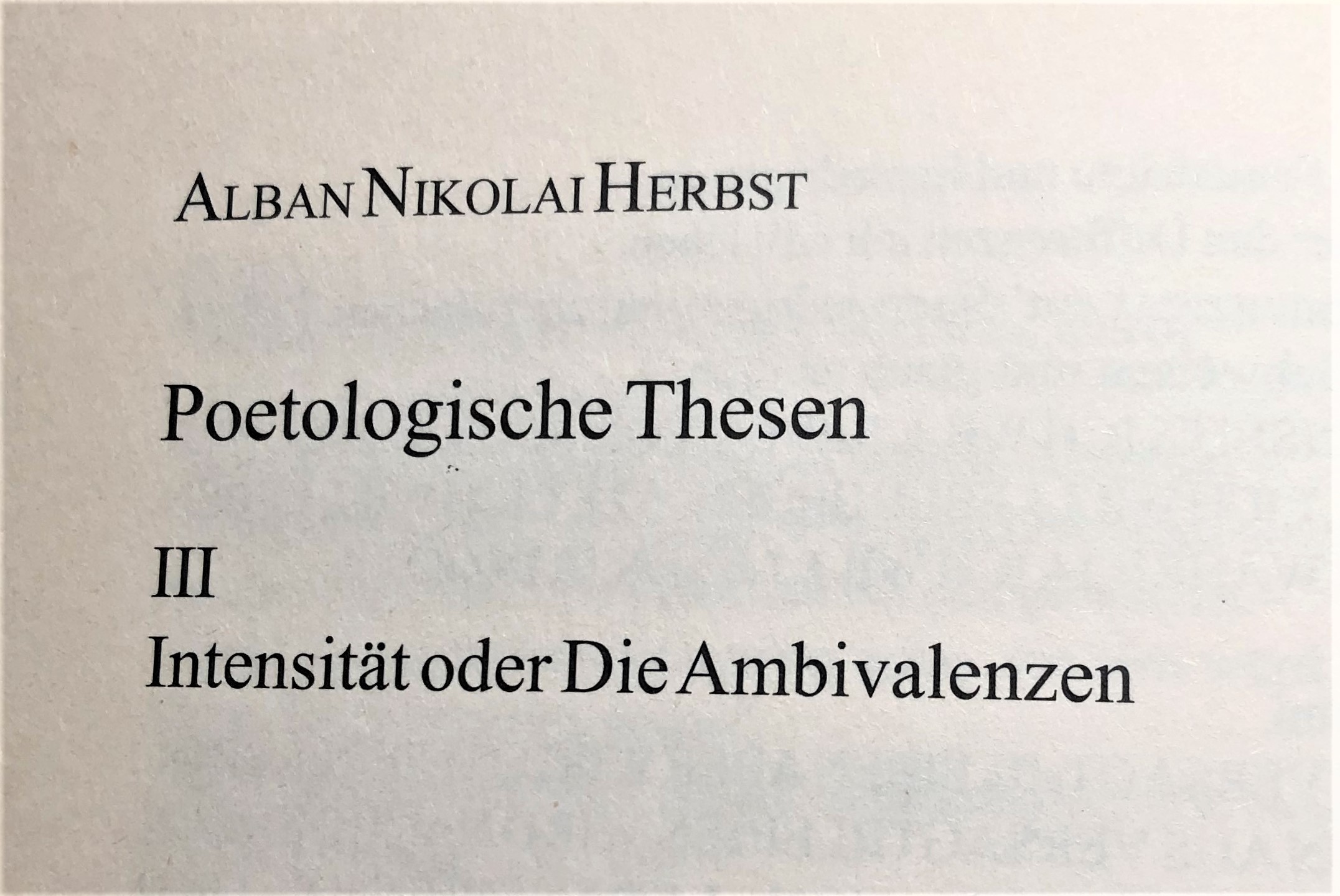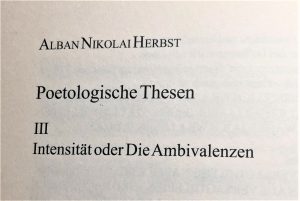
[Poetologische Thesen I ←
Poetologische Thesen II ←]
Es gibt einen Weg, schrieb ich, aber er sei mehrere. Einmal abgesehen davon, daß ich für die hochtechnisierte, demokratische Welt1 – ich sagte es schon2 – an die Leitfunktion der Dichtung nicht mehr glaube, auch und schon gar nicht an die realistischer Literaturen, haben jene Romane, auf die ich mich nunmehr beziehen möchte, sie ohnedies nie gehabt. Sie liefen immer parallel neben den kanonisierten Formen einher, gerieten bisweilen auch ins Blickfeld, waren zuweilen skandalös, manche blieben auch – als Legende – im Kulturgedächtnis hängen; insgesamt aber hatten sie außer aufeinander kaum signifikante Wirkung. Man könnte sagen, sie seien nicht „schulfähig“ gewesen, hätte nicht in den letzten zwanzig Jahren das postmoderne Denken, das sich vor allem durch Durchlässigkeit und Kombinationsfähigkeit auszeichnet, denen ein hochentwickeltes, bisweilen sogar klassizistisches Gefühl für Formgebung parallelgeht, die alten Grabenkämpfe ad acta gelegt. Wenn man nicht mehr darüber disputiert, wie viele Engel auf einer Messerspitze Platz finden, sondern den Engeln noch Teufel und einige Dämönchen, außerdem Wellensittiche und mathematische Formeln beigesellt, erledigt sich die einst grausam umstrittene Frage, obwohl niemals gelöst, auf das banalste von selbst. Nicht „Worüber du nicht sprechen kannst, davon mußt du schweigen“, ist die Devise, sondern gerade das Gegenteil. Das puristische Gebot, das Stummheit erzeugen mußte oder quälende Selbstbefragung – auf der einen Seite realistisch-regressive, auf der anderen elitär-experimentelle Literatur, der sich hochnotpeinliche oder (was ist eigentlich schlimmer?) peinliche Vergewisserungsakte beigesellten3 -, wurde unabhängig davon, ob das gerechtfertigt ist, zu Gunsten des Handwerks und der Fülle der Ideen obsolet. Oder Literatur schloß sogar die moralische Grundlage des Gebotes aus sich weg. Nicht weil es unrichtig gewesen wäre und wäre4, sondern weil es die Weiterentwicklung menschlichen Lebens hemmt, zu dem Kultur unabdingbar gehört. Bezeichnenderweise erreichten die von mir nun ins Feld zu führenden höchst vitalen Texte Nordeuropa aus romanischen, bzw. romanisch fundierten Ländern, namentlich Südamerikas – aus Gesellschaften also, die mit dem Hunger zu tun hatten und haben und denen die ziselierte Selbst- und Geschichtsqual, wie sie Deutsche umtrieb, als ein höchst dekadenter Luxus vorkommen muß, den einem bloß die gesetzliche Krankenversicherung erlaubt. Wer permanent vom Tod bedroht ist, entwickelt eine staunenmachende Neigung, das Leben zu feiern und feiert also den Überfluß. Man kann das bereits in Südeuropa beobachten – etwa am Beispiel der sizilischen Küche5. Parallel dazu richtete sich der intellektuelle – nicht der poetische – Fokus von den soverstanden „progressiven“ Gesellschafts- auf die vorgeblich „reaktionären“ Naturwissenschaften aus und reflektierte deren erkenntnistheoretische Implikationen. Das reichte bis in die Popularwissenschaft, etwa bei Fritjof Capra, und weckte im New Age esoterische Bedürfnisse, die im Wege einer „Selbstfinanzierungskiste“ gleich auch befriedigt, also marktbar wurden. Parallel dazu versprachlichte Semiotik die Welt, und zwar analog zur Physik, die, indem sie Wirklichkeit in Gleichungen beschreibt, Wirklichkeit auflöst (sie „abstrahiert“). „Ich ist ein Text“ wurde zum hin- und herfliegenden Wort. Strukturalismus – Poststrukturalismus – Postmoderne, von Foucault zu Derrida und anderen führt diese Reihe, selbst Habermas schloß sich da an. Die avanciertesten Schriftsteller der Welt komputierten sich mit dem aus Südamerika herüberwogenden Lebensimpuls zu einer literarischen Nachmoderne, die trotz der Bedeutung ihres Begriffs lediglich Vorläufer ist. Nur halt die deutschen Schriftsteller nicht, von Ausnahmen abgesehen.
Ich wähle das Wort „komputieren“, schon gar reflektiv, ganz bewußt, weil es die dritte Dynamik bezeichnet, die weniger phänomenologisch als ontologisch an der Entwicklung statthat und die scheinbare Verschiebung von romantischer Tiefe, bzw. politischer Intention auf die ästhetische Oberfläche verursacht. Kein Mensch muß heutzutage mehr Steuerzeichen eingeben, bzw. gar programmieren können, wenn er am Computer einen Text schreibt. Das war vor kaum 20 Jahren noch grundlegend anders. Und ich spreche von verhältnismäßig banalen Vorgängen, nicht etwa von der Bearbeitung einer Fotografie oder gar einer Tonspur, um schon gar nicht auf interaktive Spiele einzugehen, die oft Erkenntnismodelle sind und in den Wissenschaften auch so gehandhabt werden. Daß die Dichtung sich deren bedient, ist freilich neu; jedenfalls scheint das neu zu sein. In der Tat genügt unterdessen ein Oberflächenmenü, um Prozesse in Gang zu setzen und Ergebnisse zu erzielen, auf die früher Jahre verwendet worden wären. Das namentlich in Deutschland gegen die Postmoderne eingewandte Argument der „Oberflächlichkeit“ vergißt insofern, daß jenseits des Scheins immer komlizierteste Vorgänge walten, und zwar wie in der kybernetischen Technik, so auch in Literatur. Zugleich, und das ist für die Postmoderne überaus bezeichnend, findet das alte Wort aistetike zu seinem alten Sinn zurück. Es ist diese radikale Gleichzeitigkeit von Altem und Neuem, die die großen Bücher der Gegenwart, gemessen an ihrem „output“ sind es nicht viele, so aufregend macht.
Die Unbewußtheit, weit davon entfernt, uns mit Falltür und Strick irgendwo weiter vorn aufzulauern, umhüllt sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart von allen denkbaren Seiten, weil sie nicht ein Merkmal von Zeit selbst ist, sondern von organischem Verfall, der allen Dingen eignet, ob sie sich nun der Zeit bewußt sind oder nicht. Daß ich weiß, andere sterben, ist in diesem Fall irrelevant. Ich weiß auch, daß Sie und ich, wahrscheinlich, geboren wurden, aber das beweist nicht, daß wir die zeitliche Phase, die „Vergangenheit“ heißt, durchlaufen haben. Meine „Gegenwart“, meine kurze Bewußtseinsspanne, sagt mir, daß ich es tat, nicht der schweigende Donner der endlosen Unbewußtheit, der meiner Geburt vor zweiundfünfzig Jahren und 195 Tagen eigentümlich war.6
Die Postmoderne ist eben nicht regressiv wie der literarische Realismus, nicht elitär wie das poetische Experiment, und sie ist schon gar nicht reaktionär, wie die Realisten gerne wollen, sondern ungleichzeitig. Das verbindet sie ebenfalls mit Erscheinungsformen der Computertechnologie. Sie hat zu sich selbst zurückgefunden, ist „Schein“-Kunst. Deshalb ist sie auch nicht ahistorisch, sondern drängt in beide Richtungen, sie historisiert zugleich, wie sie mit futuristischen Szenarien und gleichzeitig banalen Alltagswirklichkeiten spielt, oft sogar im selben Buch. Das macht ihre – hier im Wortsinn – Spannkraft aus. Schon daß sie emanzipiert-demokratisches Bewußtsein mit der Vorstellung einer überpersönlichen Tragik7, wie wir sie aus der Antike kennen, zu verbinden versucht und bisweilen glänzend zu verbinden weiß8, verdeutlicht die Tragweite dieses poetischen Unternehmens.
In Wahrheit ist das nicht neu. Bereits Walter Benjamin – wenn auch aus anderen, interessanterweise religionsmythischen, also wiederum, weil er sie mit politischen koppelt, synkretistischen Gründen – hat das im „Ursprung des Deutschen Trauerspiels“ besonders in seinem Rekurs auf die Allegorie vorgedacht und im Fragment seiner „Pariser Passage“ poetisch-essayistische Gestalt finden lassen. Doch imgrunde atmet schon Cervantes diese Luft, schließlich Grimmelshausen, auch Kleists „Penthesilea“, dann bald Döblin, dessen „Berge, Meere und Giganten“ einem Homer oder Gaddis in keiner Zeile nachsteht. Einiges tut Heimito von Doderer hinzu, parallel theoretisiert Gottfried Benns Prosa, auch dies bereits postmoderner Impuls. Dazu Wolf v. Niebelschützens heitere Mythologie, die ein Fragment Hugo v. Hofmannsthals aufnahm, der seinerseits Ovid vor Augen gehabt hatte.
Dann erlischt die Reihe fast, jedenfalls im deutschsprachigen Raum. Die Katastrophe will Buße.
Erst Ende der Sechziger geht es wieder los, mit der sogenannten sexuellen, mit dem Versuch einer anderen Revolution. Aber auch mit 1959 bereits abermals Wolf v. Niebelschütz, nun seinen auf den Expressionismus zurückgreifenden „Kindern der Finsternis“. Doch insgesamt wirkten die einflußreichen („schulbildenden“) Bücher aus Frankreich und den USA. Zudem hatte längst Hollywood seinen Siegeszug angetreten, der ein moralischer, ideologischer, war und ist. Und dann, eben, kommen wie eine mächtige Flut die Südamerikaner. Was ein Buch wie „Hundert Jahre Einsamkeit“ für Europa, wenn auch erst jetzt, erzählerisch bedeutet, welchen poetologischen Vorbildcharakter es haben wird, ist noch kaum zu ermessen. Endlich wurde in der Dichtung wieder geträumt, ohne daß doch vom Realen abgesehen wurde, war sie auch noch so magisch fingiert. Eben dieses Magische, der Rekurs auf uralte Welterklärungsmuster, blies dem Buch das Feuer ein, von dem sich alle anstecken ließen: Leser, Kritiker, Theoretiker, ja sogar Massen solcher, in denen, eine Buchhandlung zu betreten, immer einen zahnarztpraxischen Abscheu erregt. Endlich hatte die Erzählung wieder Seele. Es hatte das allerdings auch viel exotisch-Eskapistisches. Beklemmend nämlich, wie verwurzelt der deutsche ideologische Vorbehalt blieb: Was den Südamerikanern erlaubt war – neben García Marquez vor allem Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges -, untersagte man den Deutschen weiterhin. Genoß die Kritik „Rayuela“ oder „Die Universalgeschichte der Niedertracht“, bzw., aus Osteuropa, des wenn auch faschistoiden Jugoslawen Miodrag Bulatovic’ „Die Daumenlosen“, so blieb etwa Gerd-Peter Eigners rundweg ebenbürtiger Roman „Brandig“ nahezu unbeachtet. Nahezu alles Deutsche, das aus der vorgeprägten „realistischen“ Bahn ausbrach oder sich nicht für Professoren als eindeutig „experimentell“ bemarkennamen ließ, wurde unnachgebig ignoriert9. Selbst Arno Schmidt hatte jahrzehntelang Schwierigkeiten und wäre vermutlich heute vergessen, wäre ihm nicht Jan Philip Reemtsma beigesprungen. Dennoch, die andere Linie, von der ich oben schrieb, existiert, die Bücher stehen in den Bibliotheken und finden oder werden finden zunehmend Beachtung, auch wenn sie dem Populismus zu ungemütlich sind.
Wie nahezu alle Bücher, auf die es ankommt, sind es Bücher über Zeit. Der Raum ist je beinahe marginal, ja ist Innenbild, das die Seele spiegelt. Zeit hingegen wird als Fremdes wahrgenommen, etwas, das die geliebten Innenbilder zersetzt. Dagegen wird der Raum, der Erzählraum, gestellt. Deshalb die Intensität des Moments10: Sie erlaubt uns, Zeit wie einen Raum zu dehnen11, etwa sehr geschickt, in folgender Metapher, die direkt aus realer Beobachtung gewonnen ist:
Die Kälte, der Schnee draußen, abends um 10 Uhr wurde das Wasser abgestellt, die Zeit bildete Stalaktiten.12
Auf solche und eben nicht auf intentional oder sprachexperimentell fundierte Bücher stütze ich meine kleine Poetologie, die das identifikatorische Lesen mit einem sich in den gewählten Themen spiegelnden Formbewußtsein verbinden will, das immer „auf der Höhe des Materials“13 ist.
Ich habe in den beiden Aufsätzen zuvor gezeigt, in welche Dilemmata die ästhetischen Grundhaltungen – die realistische, die experimentelle – führen, aber auch, daß beide je ein großes Stück Rezeptionswahrheit tragen. Auf keines soll verzichtet werden. Insofern jedoch die Grundhaltungen gegeneinander ausschließend sind, und zwar schon in ihrem Ansatz, der nicht mehr werkimmanent ist, sondern die Gattung „Dichtung“ als germanistischen Gegenstand meint, kann nur ein anderer Weg – ein „Dritter“ bzw. Vierter, Fünfter14 – gesucht werden: Der Widerspruch muß ins Werk selbst hineingesaugt, ja der Roman auf diesem Widerspruch gegründet werden. Auch das ist bereits in Benns analytischer Prosa als „Ambivalenz“ vorgedacht. Bei Nabokov, im späten „Ada oder Das Verlangen“, ist diese kühle Ambivalenz sinnlich, das heißt: Sie strahlt Wärme auf den Leser aus, weil sie nicht mehr wertet bzw. beschwört, sondern eine Liebe ebenso wie die Ambivalenzen erzählt, zum Beispiel anhand der Notwendigkeit eines Betruges, der aus der Liebe selbst stammt:
Ich liebe nur Dich, ich bin nur in Träumen von Dir glücklich, Du bist meine Freude und meine Welt, dies ist so gewiß und wirklich wie das Bewußtsein davon, daß man lebendig ist, aber… oh, ich klage Dich nicht an: – aber, Van, Du bist verantwortlich (oder das Fatum ist durch Dich verantwortlich, ce qui revient au même) dafür, etwas Wahnsinniges in mir losgelassen zu haben, als wir noch Kinder waren, ein physisches Verlangen, einen unstillbaren Juckreiz. Das Feuer, das Du anriebst, hinterließ sein Brandmal auf der empfindlichsten, lasterhaftesten und zartesten Stelle meines Körpers. Nun muß ich dafür zahlen, daß Du die rote Reizung zu stark raspeltest, zu früh, so wie verkohltes Holz fürs Brennen zahlen muß. Wenn ich ohne Deine Liebkosungen bleibe, verliere ich völlig die Kontrolle über meine Nerven, nichts existiert mehr als die Ekstase der Reibung, die anhaltende Wirkung Deines Stichs. Ich klage Dich nicht an, aber dies ist der Grund, warum ich Verlangen habe und dem Ansturm fremden Fleisches nicht widerstehen kann; das ist es, warum unsere gemeinsame Vergangenheit Wellen grenzenlosen Betrugs ausstrahlt.15
Nun handelt es sich hier um ein ausgesprochenes Alterswerk und die ihm innewohnenden, poetisch interessanten Widersprüche sind übers Alter verklärt: „Ada oder Das Verlangen“ schließt das erzählerische Werk Nabokovs ab, auch im Wortsinn, weshalb es für junge, voranstrebende Literatur nicht ganz leicht ist, praktische Schlüsse daraus zu ziehen.16 Anders liegt der Fall bei Pynchons berühmter Novelle „Die Versteigerung von Nr. 49“, worin Oedipa (!)17 Maas auf eine allgemeine, ja globale Verschwörung stößt, die im Pony-Expreß ihren Anfang genommen und sich bis in die Gegenwart erhalten zu haben scheint. Das Widersprüchliche, Ambivalente, wird hier zwischen Buch- und Leserrealität hergestellt, denn die pynchon’sche Recherche macht ständig einen dokumentarischen Eindruck; man kann durchaus mehr als nur den Verdacht hegen, „irgend etwas sei schon dran“. Das gleiche gilt für Ecos „Das Foucaultsche Pendel“18, auch für manches bei Borges; ich selbst habe etwas Ähnliches mit meiner Nachschrift zu den Arndt-Novellen19 oder verschiedentlich in den oft zugleich halb theoretischen, halb erzählerischen Deters-Fiktionen unternommen20, ja sie sogar erst vermittels meines zweiten Anderswelt-Buches21 und dann mithilfe eines realen Türschilds, schließlich in einer Reihe von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln realisiert. Derselben Fährte ist viel früher Pessoa gefolgt. Es handelt sich um Umschreibungen von Realität, die aber der „wirklichen“ Realität zumindest anfangs derart ähnlich sehen, daß beide Lebensbereiche, der objektive Alltag und die subjektive Wahrnehmung, miteinander verwechselt werden. Es wird poetologisch uninteressant, ob etwas dokumentarisch (privat) ist oder nicht, denn der „objektive“ Alltag erhält ebenso Fiktionsrang wie die „eigene“ Geschichte und das „Erdachte“. Genau das ist intendiert und sozusagen das Gegenteil von Konsum.
Wenn ich heutzutage, in dem trüben Alter, in dem ich mich befinde, Rückschau halte, so errege ich mich weniger über meine Erinnerungen als über das, was mir davon entgleitet. Wenn das innere Auge unser Leben zu projizieren sucht, so ist das ähnlich wie mit den Träumen, an die wir uns zu erinnern glauben und die wir dann doch nicht genau wiederzugeben vermögen. Ein noch verschwimmendes Bild, man möchte sehen, was dahinter ist, oder davor, doch das gelingt einem nicht. Man wendet sich wieder der Silhouette seiner selbst zu, so als schielte man auf seine Nase, auf seine Schultern: von dem jungen Mann, der ich war, bleibt nur eine vage Vorstellung, nur eine Ahnung dessen, was zweifellos aus ihm werden wird. Ich lese mein Leben noch einmal wie einen Roman22, der mir gefallen hätte oder auch nicht, kurz, der seinerzeit einen gewissen Eindruck auf mich gemacht hätte. Ich überblättere Seiten und suche nach der Stelle, von der ich erwarte, daß sie mich an der Kehle packt.23
Was hier die Erinnerung nicht (mehr?) leistet oder gerade doch leistet, nämlich als Erfindung, wird in der von mir favorisierten Literatur zu einem grundlegenden Ansatz.24 Sehr früh schon habe ich dafür den geheimdiensttheoretischen Begriff der Desinformation reklamiert25. Der Leser selbst – wie der Autor – wird nun zum Protagonisten der erzählten Geschichte:
Aber wer spricht hier eigentlich? Wer ist das, der permanent „Ich“ sagt? – Ich? – Vielleicht sprechen ja Sie mich an? Wer denkt sich die Geschichten aus, wessen Näherungen sind es? Tragen nicht eventuell gerade Sie sie mir an..? Ja, ja, Sie meine ich, die oder der Sie sich bis hierher durchgewurstelt haben. Benutzen vielleicht Sie mich? – Die Geschichte vom Handschuh zum Beispiel, auch so ein Schnipsel, kennen Sie die? Gut, ich erzähle auch dieses Fragment noch, aber ich weiß wirklich nicht, wie lange das durchzuhalten ist. – Eines Tages, also, sagen wir: morgen… gut, gut: Morgen also fand ich Ihren Handschuh in meiner Wohnung, in meiner alten Bremer Wohnung, durchaus nicht in Frankfurt, fand also Ihren Handschuh auf dem Boden neben der Kommode, die auf dem Flur unterm Spiegel steht und von Claudia geliehen ist. – Sie glauben mir nicht? Warum hätte ich Ihren Handschuh dort nicht finden sollen? Sie fragen, was wir denn miteinander zu schaffen gehabt hätten? Ich kennte Sie nicht? Es sei unwahrscheinlich, Sie wüßten das? Na ja, meinetwegen. – Aber sehen Sie: Offenbar wünschen Sie sich, von mir etwas als glaubhaft dargestellt zu bekommen. (…) Sie wollen sich austauschen, Ihre Ehe, Ihre Freunde austauschen gegen meine Fiktionen, die aber auf eine Weise glaubhaft sein sollen, die sie gerade zum von Ihnen Dargestellten macht. Ich meine: als wäre es von Ihnen dargestellt. Sie wünschen sich, an einem Gedankenspiel teilzunehmen, dessen eigentlichen Charakter – daß es nämlich immer nur Ihr eigenes Gedankenspiel ist – ich Ihnen zu vernebeln habe aufgrund meines… nun, sagen wir: poetischen Spieltriebs.26
Einen „realisierten“ – zumindest leichthin realisierbaren – Reflex hierauf findet sich heutzutage in der Dynamik nahezu jedes Chats: „raum“gewordene Literatur. Einerseits gewährleistet sie die Identifikation des Lesers, wie ihm andererseits – weil die Form avantgardistisch ist – die Manipulation, der er sich aussetzt, jederzeit bewußt bleiben kann. Dadurch wird der Widerspruch, den die beiden poetischen Grundhaltungen – Realismus ./. Experiment, Populäres ./. Elitäres usw. – rein äußerlich austragen, in die Innenwelt des Lesers projeziert, und er wird, sofern er seine Lektüre nicht abbricht, zu einer sehr eigenen Haltung finden müssen. Gelingt ihm das, wird er den Text genießen, und zwar auch dann, wenn er kunsttheoretisch nicht vorgebildet ist. Darauf genau kommt es an.27
Ein wenig davon haben übrigens sämtliche Bücher, die sich scheinpersönlich an ihren Leser adressieren; auch das klassische „Lieber Leser, glaube mir“ hat schon Teil an dem Verfahren, erst recht gilt das für alle Romane, die diese Vertrautheit über ein „Sie“ zu unterlaufen scheinen.28 In Wahrheit potenzieren sie es gerade dadurch.
Wenn ich in eine Erzählung eine Person einführe, die einen bekannten Namen trägt, so, um die Zweifel zu zerstreuen, die Sie über denjenigen haben können. Zum Beispiel, um Sie von der albernen oder gar nicht so albernen Idee abzubringen, daß es sich dabei um mich handele. Im vorliegenden Fall habe ich offensichtlich eine ganz sichere Person gewählt, die Sie zu kennen glaubten, die Sie sich von einigen noch lebenden Zeitgenossen als real bestätigen lassen konnten – oder zumindest, daß sie zwischen den beiden Kriegen gelebt hat. Immer dieselbe Fiktion. Das Irreale mit dem Maß der Realität messen, die Grenzen der Vorstellung verwischen, damit man sich unschuldig auf jenem Gebiet verliert, wo man von der Sicht zum Denken, von der Schlaflosigkeit zum Traum, vom Zeitdokument zur Fabel, von der Erinnerung zur Lüge gelangt. Und so weiter. So leitet man das Leben, sein Leben, das heißt das zu Vergessende, in ein neues Bezugssystem hinüber, einen Roman, wenn Sie wollen (…).29
Damit das funktioniert und nicht bloß konstruiert wirkt, ist die Identifikation des Lesers so wichtig, also dasjenige psychisch/psychologisch Wirksame, das ich im ersten Teil dieses Aufsatzes ein wenig denunziativ das Menschliche nannte. Interessanterweise ist ja Aragon durch die Schule des sozialistischen Realismus’ gegangen, ja hat sie doktrinär hypostasiert, bevor er sich – nach Elsa Triolets Tod – auf seine ästhetische Herkunft besann und sie in den drei letzten Büchern mit der „wirklichen Welt“ nicht nur versöhnte, sondern den surrealstischen Ansatz um den realistischen bereicherte. Ästhetisch widersprüchlicher geht es kaum. Dennoch – oder gerade deshalb – erreicht er erst hier die „wirkliche Welt“, denen die sozialistischen Bücher „dienen“ wollten.
Auch „Blanche oder Das Vergessen“ ist übrigens ein Alterswerk und deshalb so milde wie „Ada oder Das Verlangen“. Doch die gesamte, das folgende Jahrzehnt prägende Linguistik, schulterschlüssig mit dem Strukturalismus, ist hier bereits allein über eines der Motti ausformuliert.30 Ich ist ein Text. Papierne Theorie? Nein. Für das nötige Feuer sorgt Aragons höchst abendländische Metaphernkunst. Und das Leid, das er in ihr verklärt.
Wenn diese bedrückende Süße der Nacht nicht der Duft des Junis wäre, sondern Java, der wilde Duft Javas, unser beider Leben, die Mitschuld der Finsternis, die Nähe der Panther, diese Liebesschlacht, in der die Weigerung, die Angst vor der Lust der Anfang ist, mein Mädchen, mein Kind, meine Wunderbare… Blanche, wo bist du? Bist du aufgestanden? Was ist denn… Du antwortest ja nicht. Sie muß auf dem Balkon sein oder…31
Nun kann, ich sagte es schon, Verklärung ganz sicher nicht das Movens junger Literaturen sein; sie wären andernfalls altklug. Man muß die Verklärung vom einflußnehmenden Werk subtrahieren, um damit arbeiten zu können. Dann aber fehlt der angerufenen Dichtung die Seele. Freilich fehlte sie sowieso, weil sich Schmerz so wenig übertragen läßt wie Lust; man muß das aus sich selber nehmen, den eigenen Leidenschaften, eigenen Obsessionen und Erfahrungen. Deshalb meine Forderung nach Intensität. Intensität ist freilich radikal, sie kann sich nicht auf Normen stützen, muß immer ins Neue, Ungesicherte, – muß graben. „Künstlerisch tätig sein, bedeutet zu graben, Vampire auszugraben. Kunst ist Archäologie“, schrieb ich einmal.
Es geht hierbei nicht nur um Leid, sondern auch die gelesene Lust, sofern sie wahrgenommen wird, ist immer eine eigene, eine, die sich auf erlebte Lust zurückbindet; eben das macht sie zur Allegorie. In erster Linie ist und bleibt der Dichter selbst sein Material; logischerweise sind es auch seine Gefährten und Zeitgenossen. Der „Trick“ besteht darin, daß das für „den Leser“ ganz das Gleiche ist, und zwar unabhängig von biografischer Differenz oder biografischer Analogie. Hier ist Wahrhaftigkeit nötig, die im künstlerischen Prozeß – der auch bloß aus Formulierung bestehen kann – in das scheinbar theoretische Konzept gefiltert, ja darauf losgelassen und mit dem imaginierten LeserIch vermittelt, d.h. poetisiert wird32. Die „Wahrheit“ alleine bringt Kitsch, bestenfalls Pädagogik: Realismus halt. Erst die Arbeit, ja der Kampf beider (oder mehrerer) Materialarten führt zur Kunst. Musikalisch argumentiert, nützt es mir wenig, einen Einfall (eine Melodie etwa) zu haben; schreibe ich alleine sie nieder, kommt bestenfalls ein Kinderlied heraus. Ich kann es zwar akkordisch aufmotzen, aber das wird dann immer nur Pop. Statt dessen muß ich den Einfall (in Literatur das wirkliche oder imaginierte Erlebnis) durch die Kompositionstechnik sagen wir der Sonatenform, einer Passacaglia usw. schicken, d.h. motivische Arbeit leisten. Das garantiert zwar, daß Kunst ensteht33, immer noch nicht, kommt ihr aber – voraussichtlich – näher. Vermittels der Form der Gestaltung verwandeln sich selbst autobiografisch detaillierteste „Berichte“ in Dichtung. Denn die allegorisierte Lebensgeschichte ist nicht länger die Lebensgeschichte.
Ich habe in den früheren Teilen dieses Aufsatzes zu zeigen versucht, daß die experimentelle Kunst dazu tendiert, ihr Material aufzulösen, d.h. zu entsinnlichen, während die realistische es qua Einfühlung letztlich festsetzt und ihm keine Entwicklung gestattet, also weder der Form nach noch vermittels ihres gestalteten Inhalts. Das avancierte Experiment wird deshalb gegen den Leser hermetisch, läßt ihn nicht mehr in sich herein, und der Realismus, der ihn hereinläßt, entmündigt ihn und macht ihn zum Element einer kalkulierbaren Zielgruppe, also letztlich zu einem jeder Kunst äußerlichen, marktwirtschaftlichen Produktionsgegenstand. Die von mir favorisierte Poetik – dieser dritte, vierte, fünfte Weg – will beides vermeiden und bedient sich dafür flirrender, ungefährer Formen, die sehr viel Raum für Mutmaßungen, Gefühle, Verschwörungstheorien, ja esoterische Konditionen lassen, für die aber als solche nie Partei genommen wird, sondern die der Dichter mit völlig allgemeinen, bisweilen sogar banalen Ansichten kombiniert, teils mit Geschichten, die unwidersprochen in jedem „Verständigungstext“ stehen könnten, teils mit solchen, die konservativerweise nur im Bereich der Unterhaltungsliteratur vorstellbar sind. Dokumentarisches, subjektive Gefühls- und Vorstellungswelt sowie Fantastik verschränken sich nahezu unlösbar ineinander. Indem sie gleichzeitig dem formalen Variationsspiel moderner Ästhetiken ausgeliefert werden, zu denen unterdessen sicherlich die Kybernetik, aber auch die erkenntnistheoretischen Wissenschaften gehören, kommt man zu dem an sich paradoxen Ergebnis eines Reißverschlusses, der sich aus drei Zahnlitzen – oder sogar mehreren – zusammengezogen hat. Für den an zwei solche Litzen gewöhnten Leser ist das ein wenig unbehaglich, hat aber zugleich einen enormen Witz, der Ernsthaftigkeit dennoch nicht ausschließt. Ich sage gerne „Spiel“ dazu. Zumal ist der Leser – wenn es denn gutging – durch den von ihm selbst hergestellten Identifikationsprozeß, zu dem ihn der Autor freilich verführte, derart tief in den Romanfiguren anwesend, daß er ein solches Buch nur widerwillig aus der Hand legen wird. All dies setzt selbstverständlich die Bereitschaft sich einzulassen voraus. Dem Kunstwillen entspricht ein Rezeptionswille. Wer, weil irgendwie gewarnt, sich vorher, nach Stichprobenart sichernd, durch die Seiten schmökerte, kann durchaus auf dieselben Probleme stoßen, die er mit experimenteller Literatur hat, auch wenn der Roman an sich wie eine konventionelle Erzählung wirkt. Ob solches „Herumlesen“ das Leserinteresse befördert oder nicht, scheint mir eine reine Frage des Zufalls zu sein34.
Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, möchte ich kurz den Anfang eines der großen Erzählentwürfe der letzten Jahre nacherzählen, nämlich Ishiguros „Die Ungetrösteten“, nun sicher kein Alterswerk. Hier ist an die Stelle raumzeitlicher Verklärung die Fantastik getreten35. Das kann auch gar nicht anders sein, da sich in diesem intensiven Ansatz Zeit nicht als „abgeschlossen“ darstellen läßt, und zwar auch nicht die „Erzählzeit“. Hierin liegt übrigens zugleich die Ambivalenz: Jedes Buch ist endlich36. Das läßt sich wiederum nur allegorisch unterlaufen.
Also.
Ishiguros „Held“ Mr. Ryder, ein „weltberühmter Pianist“, wird bei seiner Ankunft im Hotel nicht willkommen geheißen. Das ist besonders dem Taxifahrer peinlich.37 Also begibt er – der Taxifahrer! – sich auf die Suche nach einem Hotelangestellten. Kaum ist er weg, tritt jemand hinter den Tresen der Rezeption, der Mr. Ryder nun angemessen begrüßt. Da kann der Taxifahrer sich zu seinen Pneus und unsere kurze Irritation ins Verschwinden zurückverfügen. Außerdem überschwemmt einen der Rezeptionsmensch umgehend mit derart distanzlosen Beteuerungen und Neuigkeiten, daß die Zeit nicht ist, sich darüber zu wundern, mit diesem Menschen und den städtischen Vorgängen so intim bekannt zu sein. Kaum sinnt man aber jetzt dem hinterher, belegt uns schon – derweil er unsere Koffer trägt – ein älterer Hoteldiener mit Suadenfeuer und steht nicht einmal an, uns zu einem Kaffee im trauten Kreise seiner Kollegen einzuladen. Ohne von nun wieder diesem Schock geheilt zu werden, fällt uns ein, und zwar des langen und breiten, daß Gustav, der Hoteldiener, sich ständig Sorgen um Tochter und Enkel mache. —- Da nun, endgültig, stoppt man in der Lektüre: Was?! Woher weiß denn unser Held alledies? Gustav ist ihm doch erst vor fünf Minuten zugeteilt worden..?!
Der Widerspruch stört unsere Identifikation mit dem Erzähler durchaus. Darüber hilft auch die perfide Ich-Form nicht hinweg, in der Ishiguro das alles dahinplätschern läßt. So realismusflüssig rinnt sein Stil, daß man anfangs noch denkt, man habe einen Naturalisten bei einem groben Fehler ertappt. Und ahnt nicht, daß sich, während wir noch die Köpfe schütteln, um unsren Hals eine Schlinge legt. Die zieht sich zu und dreht uns schon auf in Ishiguros Spirale erzähllogischer Ungeheuerlichkeiten. Nämlich bittet wenige Seiten später der Hoteldiener den Gast, doch einmal mit seiner, Gustavs, Tochter zu sprechen, sie sitze immer im Ungarischen Café, und da jener ja sowieso in die Altstadt schlendern wolle… Mr. Ryder, anders als wir, merkt den Widersinn nicht. Zwar erkennt er Sophie, die Tochter des Hoteldieners, im Café nicht gleich, sie dafür aber ihn: Sie ruft ihn herbei und erzählt, sie habe das Haus gefunden, nach welchem sie, Sophie, und er, Mr. Ryder, so lange gesucht hätten… Mr. Ryder’s Antwort darauf? „Ah ja. Schön.“ Denn Tatsache sei,
daß mir Sophies Gesicht (…) langsam aber sicher immer vertrauter wurde, bis ich schließlich überzeugt war, mich an frühere Gespräche über den Kauf eines solchen Hauses (…) erinnern zu können.
Hier nun wird genau mit der Identifikation gespielt, die dem Leser eines realistischen Romanes so wichtig ist, weil sie ihm den Zugang in ein Buch ohne innere Widerstände erlaubt; dieser Zugang wird bei Ishiguro geradezu verdächtig bereitwillig aufgesperrt. Es ist dann rein die Handlungskonstruktion, die den Leser eben der Verwirrung aussetzt, mit welcher er sich zunehmend auch in seinem täglichen Leben konfrontiert fühlt. Das realistische Prinzip selbst hebelt sich aus und wird seines täuschenden Charakters überführt, und zwar in weitaus „schlimmerem“ Maß, als jeder auf den ersten Blick avantgardistische Ansatz das könnte. Schließlich verbiegen sich bei Ishiguro sogar die Räume: Seine Ortsvorstellungen nachzuvollziehen, kommt dem Erlebnis nicht-euklidischer Räume gleich. Dazu braucht es noch nicht einmal – wie etwa bei Kafka oder in Rilkes Malte-Roman – signalhafter Symbole (rückwärtsgehende Uhr etc.), sondern das Verfahren entwickelt sich, erschreckend logisch, vollkommen immanent. Es braucht nicht einmal mehr der Beteuerungen von Normalität.38 Ähnlich – auch da über Räume organisiert, denen sich erst später Zeiten hinzufügen39 – bin ich in den beiden bisher erschienenen ANDERSWELT-Büchern vorgangen, an die sich obendrein ganz andere Texte lehnen, die getrennt vom Hauptstrang laufen und je für sich genommen lesbar sind, ja selbst noch viel früher publizierte Bücher werden nachträglich eingefügt, indem sie gleichsam Schnittstellen zugeschrieben bekommen, die sich freilich nur von später her lesen lassen.40 Dem entspricht eine Auflösung fester, normierter Hierarchien, auch solcher innerhalb des eigenen Ichs. Es kommt dann zu dem Paradox eines identifzierenden Lesens, das die Grundlage der Identifikation gerade auflöst und in dem landet, was ich den Ungefähren Raum nenne. Dieser zeichnet sich durch ein Höchstmaß möglicher plausibler Erzählungen aus, die einander durchaus widersprechen, jede für sich aber „wahr“ sein können, und zwar intensiv41 wahr; sie könnten aber auch sämtlichst „lügen“: Unter anderem macht eben dieser Widerspruch eine jede von ihnen plausibel; die Struktur ist polymorph42 (was zugleich das Unbehagen wie den Reiz dieses „realistischen Experimentierens“ ausmacht) und damit der Gegenwart hochgradig angemessen. „Polymorphe Allegorie“, ja, das wäre ein Begriff, mit dem sich diese vorläufige Ästhetik abschließen läßt, – vorübergehend, nein: zeitweilig, ganz wie es Ungefähren Räumen entspricht. Und bedenken Sie bitte, daß mir nicht an normativen Ausschlüssen gelegen ist. Das, was ich Intensität oder Fantastik nenne, steht neben den anderen Ansätzen da und ist auf sie bezogen; was sterben muß, stirbt eh. Da braucht keiner nachzutreten.
______________________________________________________________________
1 Beide Adjektiva sind unabdingbar aufeinander bezogen, weshalb sich der sogenannte fundamentale, kriegerische Islam bilderstürmend betätigen muß; es bleibt ihm gar keine andere Wahl, denn die Demokratie löst Gott ebenso auf (macht ihn „wähl-„ und „abwählbar“) wie die jedermann zugängliche Kulturindustrie mit ihren von jedermann bedien-, bzw. konsumierbaren Oberflächentechnologien. Nur deshalb ist der fundamentale Islam intolerant. Ein „aufgeklärter“ Islam wird auf Dauer dasselbe
Ergebnis zeitigen, das dem aufgeklärten Christentum widerfuhr: Bigottes Sektierertum wie in den USA
und/oder eine allgemeine Säkularisierung, die aus Göttlichem griffige, produzierbare Fetische,
Popstars etwa, macht. So gesehen kämpfen die Mullahs derzeit um ihr ideelles Überleben und auch
um das der muslimischen Kultur. Wessen Existenz aber bedroht ist, der kann es sich nicht leisten,
in seinen Verteidigungsmitteln zimperlich zu sein.
2 Poetologische Thesen → I und → II
3 „Verständigungstexte“ hieß in den späten Siebzigern/frühen Achtzigern ein Serial bei Suhrkamp.
4 Das ist es nämlich nicht. Aber es hat poetisch keinen Sinn, „wahr“ zu sein, „wahr“ zu handeln.
5 Eine typische Analogie übrigens, aus der ein postmoderner Poet sofort Fabeln ableiten würde.
6 Vladimir Nabokov, Ada oder Das Verlangen,
dtsch. von Uwe Friesel und Marianne Thestappen, Rowohlt: Reinbek 1974
7 Um es weniger dramatisch zu sagen: daß sich Schicksalsmuster allegorisch in den Protagonisten eines Romans wiederholen, ob die es wollen und wissen oder nicht. Analoges gilt für den realen Leser; das u.a. soll ihm durch ein Buch empfindbar gemacht werden.
8 Ganz deutlich in Thomas Pynchons Roman “Die Enden der Parabel”, der mit der Allegorisierung eines herumstreunenden Protagonisten zum Jojo beginnt.
9 Jörg Drews hat hierzu äußerst unschön beigetragen.
10 “Küsse/Bisse, das reimt sich” : Kleist meint hier ein zusammenfallendes zeitliches Moment!
11 “Die siehst, mein Sohn/Zum Raum wird hier die Zeit” ist nicht von ungefähr eines der meistverwendeten Motti und Zitate im postmodernen Denken. Wir wissen: Parzifal übergibt sich wenig später, so übel wird Menschen, wenn sich ihre Paradigmen pervertieren. Wenn neue Kunst beginnt.
12 Louis Aragon, Blanche oder Das Vergessen, dtsch. von Eva und Gerhard Schewe, Volk und Welt: Berlin 1972
13 Adorno
14 ANH, → Das Flirren im Sprachraum, Schreibheft Nr. 56: „Ich lehne die Terminologie eines Dritten ab, weil sie sich auf Dreieinigkeit und den im Eineindeutigen wurzelnden Monotheismus bezieht, den ich für die Funktionalisierung von Welt verantwortlich mache.“
15 Vladimir Nabokov, Ada oder Das Verlangen, a.a.O.
16 Alterswerke lassen sich als Werke betrachten, die auf das Leben das Autors als auf einen Raum rückblicken lassen; das Leben ist bereits als abgeschlossenes imaginiert. („Die Welt als Stille und Vorstellung.“ Ebenfalls Aragon, a.a.O.)
17 Achtung: Allegorie!
18 siehe ANH, → Das realistische Dilemma, Fußnote 37
19 ANH, Der Arndt.Komplex, Reinbek 1997
20 z.B. ANH, Entelechie oder Hans Deters gesteht seinen Überdruß,
in: Sprache im Technischen Zeitalter, Herbst 1997
21 ANH, Buenos Aires. Anderswelt, Berlin 2001
22 Den zu erzählen gegenwärtig das Risiko trüge, juristisch belangt zu werden, da die Personen eines solchen Romanes sich „wiedererkennen“ und also das Buch verbieten zu lassen versucht sein könnten, obwohl sie aus den in dieser Passage erklärten Gründen Romanfiguren sind. Diese Volte zeigt, wie lebendig, ja wehrhaft sie werden können, auch und gerade dann, wenn Literatur eigentlich schon seit 20 Jahren keine moralische oder erkenntnistheoretische, geschweige gesellschaftliche Instanz mehr ist. Sic!
23 Louis Aragon, Blanche oder Das Vergessen, a.a.O.
24 Er ist nicht so ganz ohne Verwandtschaft zu Kants Gedankenmodell der „Kausalität aus Freiheit“, die ihm Grundlage nahezu jedes Experiments zu sein scheint. Hier berühren sich intensive und experimentelle Literatur, indes die realistische imgrunde immer nur „abschreibt“ und darum restlos tautologisch bleibt, – mit einem anderen, böseren, Wort: affirmativ.
25 Den ich meinerseits von Watzlawick habe.
26 ANH, → Die Verwirrung des Gemüts, List: München 1983
27 Freilich muß klarsein, daß Kunst Bildung voraussetzt, und zwar dann, wenn sie gegenwärtige ist. Denn als solche fordert sie dem Rezipienten zumindest die Arbeit ab, sich von eingefahrenen und liebgewonnenen Sichtweisen zu lösen. Was er aber nur dann tun kann, wenn er genügend Kenntnisse hat, sich gegen mögliche Gefahren zu wappnen. Erst, hat die Zeit ein Kunstwerk „gesetzt“, kann es ohne Bildung auskommen – wird dann aber oft und sehr schnell Staffage, wie man bei den Hunderttausenden Miró-Drucken sehen kann. Das gilt übrigens für Literatur nicht ganz so deftig; freilich nur deshalb, weil Vokabulare veralten und allein das vermeintlich Gestrige den Stachel spitzhält.
28 Dem analog handelt wiederum Physik, vornehmlich im Bereich subatomerer Experimente, weil der Experimentator da Teil des Ergebnisses, also der „Erkenntnis“, ist. Die nachmoderne Avantgarde konzentriert sich nicht mehr rein aufs Material, sondern auf die Wechselwirkungen von Material, Leser und Autor; deshalb kann sie gar nicht „rein“ sein, d.h. ihr ist auch Distanz nicht mehr erlaubt.
29 Louis Aragon, a.a.O.
30 Etwa Arsène Darmesteter: „(…) überall setzt der Wandel voraus, daß der Geist den einen Ausdruck vergißt und nur noch den zweiten behält. – Diese Art zu vergessen ist von den Grammatikern als Katachrese, das heißt Mißbrauch, bezeichnet worden.“ Die Mißbräuchlichkeit, die das Dokumentarische zur Fiktion macht, wird hier poetologische Basis, d.h. ein rhetorischer Begriff konstituiert nun die Gestaltung der Romanwirklichkeit.
31 Louis Aragon, a.a.O.
32 Übrigens ist an dieser Imagination gar nichts “Schlimmes”, denn umgekehrt imaginiert der Leser ja eben auch den Autor. Es ist wechselseitig der gleiche Prozeß wie die durch den Text und den Geist des Lesers hergestellte Imagination einer Romanfigur.
33 Solche “Garantien” gibt es ohnedies nicht. Gustav Mahler hat sehr zu recht einmal bemerkt, wer sich auf Kunst einlasse, riskiere sein Scheitern, ja er werde nie wissen, ob ihm Kunst gelungen sei. Wahrscheinlich wird es auch die Nachwelt nicht wissen, sondern es immer nur glauben oder nicht glauben, da es objektive Kriterien für Kunst nicht gibt. Das belegt, daß verschiedene Zeiten verschieden auf die hinterlassenen Kunstwerke blicken und auf die jeweils gegenwärtigen sowieso. Etwas, das wir heute für Kunst halten, kann morgen bereits ins Banale weggesunken sein, und etwas, das einst für „wirr“ und „unförmig“ galt (etwa für Goethe die barocke Architektur), heute fundamental den Kunstbegriff definieren.
34 Cortázar ist dieses Problem wohlgemut-verspielt in seinem Roman „Rayuela“ angegangen, der den Leser das Buch sowohl konservativ wie „herumspringend“ aufnehmen läßt, nämlich aufgrund kleiner Handlungsanweisungen am Ende eines jeden Kapitels. Der Leser liest mit „Rayuela“ mindestens zwei Romane, obwohl der Text selbst fixiert ist. Julio Cortázar, Rayuela, Frankfurt am Main, Zweite Auflage 1983
35 Wahrscheinlich kann Intensität, die sich (noch) nicht abfinden mag, gar nicht anders als fantastisch sein; viele Erzählungen der Südamerikaner gingen deshalb diesen Weg und eben nicht aus „Beliebigkeit“. Hier ist wohl auch der Grund des magischen Realismus’ zu suchen. Wenn ich mich mit der germanistisch geforderten „Distanz“ nicht abfinden mag, weil sie immer uneigentlich ist und Uneigentlichkeit nicht intensiv sein kann, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den „Realismus“ zu verlassen. Deshalb mein „Spiel“ mit der Science Fiction in den ANDERSWELT-Büchern. Deshalb die Mythenwelten im WOLPERTINGER. Also gerade nicht aus „Beliebigkeit“.
36 Einen Nebenschauplatz, den zu analysieren hier nicht genug Platz ist, eröffnet in genau dieser Diskussion die Rolle, die in der anhebenden Moderne das Fragment gespielt hat: Jene prinzipielle Unabgeschlossenheit, die der Dichter zu fassen versucht, führt dann zu Monstre-Fragmenten wie etwa „Der Mann ohne Eigenschaften“.
37 Einem Taxifahrer?! – Aber noch liest man über sowas hinweg.
38 Die z.B. Ecos „Das Foucault’sche Pendel“ permanent prägen; siehe L 69, a.a.O.
39 nämlich vor allem über die strukturelle Gleichbehandlung “realistischer”, mythischer sowie Science-Fiction-artiger Elemente.
40 Was freilich nur insoweit stimmt, solange ein Werk nicht „abgeschlossen“ ist, etwa durch den Tod seines Autors. Danach wird es dann irgendwann gleichgültig werden, womit man zu lesen beginnt. Es sieht allerdings so aus, als würde dieses sich immer noch auf die Biografie eines Autors zurückspiegelnde Moment allmählich durch eine Poetik des Hypertextes abgelöst werden: Er hat mehrere Autoren, durchaus auch denkbar: über Generationen einander folgende, so daß sich „ein“ aus vielen Bewußtseinsträgern komputierter, potentiell unendlich lange schreibender Autor formt, auf den dann die „biografische Sicherung“ sowieso nicht mehr angewandt werden könnte. Zur Zeit fragt es sich allerdings noch, ob eine solche Ko-Existenz noch das Erzählen „normaler“ Geschichten erlauben wird. – Keine Ahnung.
41 Intensität bedeutet mir nahezu immer: heftig emotional.
42 Man könnte es auch „unrein“ nennen, nämlich als das Gegenteil eines erzählerischen Purismus’ verstehen, wie er sowohl von „realistischer“ als auch „experimenteller“ Seite aus gefordert wird; interessanterweise reagiert hier einzig die Trivialliteratur tolerant.
_____________________
[Geschrieben ungefähr Juni 2003
Erschienen in → L. – Der Literaturbote Nr. 72, Dezember 2003)
_____________________
Poetologische Thesen 2 <<<<