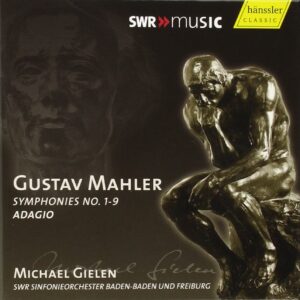[Arbeitswohnung, 6.40 Uhr. 70,3 kg.
France musique contemporaine:
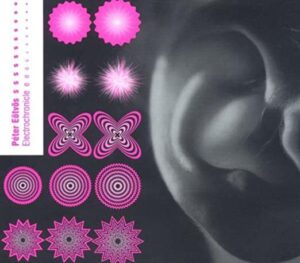 Peter Eötvös, Musik für New York (1971)
Peter Eötvös, Musik für New York (1971)
Erster Latte macchiato]
Seit sechs auf, sogar seit Viertel vor; konnte nicht mehr schlafen, der Kopf brauste vor Gedanken. War gestern und vorgestern schon so, jedesmal ab drei, dann noch zwei Stunden geschlafen, dann Gedankenstürme, aber zäh. Heute habe ich im Vierteltraum ein komplettes Arbeitsjournal geschrieben, inklusive der Links — bis ich begriff, es würde, wenn ich endlich aufstünd, gar nichts mehr erhalten davon sein. Besonders nicht die auch nicht mehr zu rekonstruierenden Links. Schon deren Suchbegriffe ließen sich, als ich’s dann endlich geschafft hatte, mich aufzurichten, nicht mehr rekonstruieren. Zum einen eine mit Mobilitätsnochwas (Mobilitätsprimat?, –dignität gar?), zum anderen so etwas wie Nekromantie (aber nur das „Nekro“ trifft zu), und beides in direktem Zusammenhang mit meiner Rekonvaleszenz, also indirekt-direkt der entschwundenen → Li, die ich „meine“, so sehr ist sie verschwunden, gar nicht mehr nennen kann.
Bin ich darüber betrübt?
Welch ein bizarrer Gedanke! — Manche ließen sich, erzählte mein Onkologe gestern, den Bioport schnell wieder herausnehmen, weil er sie dauernd an die Torturen der Krebsbehandlung erinnere, vor allem, wenn die Haut so spanne; sie wollten nicht mehr an sie denken. „Ach“, antwortete ich, „mir geht es anders. Wenn ich zurückdenke, so durchaus nicht ohne Triumph.“ Da mußte er lächeln, hinter seiner Covidmaske, ich sah die Fältchen seitlich der Augen.
Es war seit langem der wieder erste Termin, der erste zur regulären Kontrolle überhaupt. Wegen → der Quarantäne hatte ich ihn verschieben müssen. Die Blutabnahme war lustig, weil die junge Helferin zwar die Vene jeweils traf, exakt traf, aber dennoch nichts heraufließen wollte. Also rührte die vermummte junge Dame mit der Nadel ein bißchen herum, was ich entsprechend kommentierte; schließlich, nach dem dritten Versuch, nunmehr am anderen Arm, gab sie auf. Ich fand es beruhigend, daß auch ihre Kollegin erstmal rühren mußte. Mit links und rechts der Pflästerchenkollektion hätte ich keiner Polizeikontrolle in die Arme laufen dürfen, andernfalls man mich zum Entzug vielleicht eingesperrt hätte. Das mußte ich bemerken, selbstverständlich grinsend. Die jungen Frauen lachten auch, auf der einen Brust der Löwe mit: mittig, also oberhalb des Busens auf der Schlüsselbeinfront; war auch nur angedeutet zu sehen. Na logo, wie wir früher sagten? Nur: Wer ist „wir“ (war „wir“)? Als hätt ich je einer Generation zugehört, mit der ich die Neigungen teilte! Aber manche Idiome, doch, die teilten wir dann schon.
Die Laborergebnisse bekam ich aber noch nicht; mein Termin fand um Viertel vor siebzehn Uhr statt, „doch wenn ich Sie so sehe“, so der Arzt, „mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Es wird Zeit, daß Sie Ihren Sport wieder aufnehmen.“ „Ins Studio mag ich noch nicht, das wär mir dort noch zu unheimlich, meinen Spott über Corona nun hin oder her.“ „Gut, aber laufen sollten Sie.“ „Ich bin den ganzen Weg vom Prenzlauer Berg zu Ihnen hinab flaniert„, gab ich an, „fast eine Stunde Weges.“ In der Tat hatte ich einen meiner schönen Gehstöcke genommen, den mit dem Fischotterkopf. Dazu Anzug mit Weste, drunter Krawatte, drüber den eleganten langen blauen Mantel und auf dem Schädel meinen nun schon fast vierzig Jahre alten Wegener–Fedora, den ich damals schon auf dem Flohmarkt, in Frankfurtmain, erstanden hatte und habe zwischenzeitlich „aufarbeiten“, sagt man, lassen.
Wer keinen Magen mehr hat, ersetzt ihn durch höchst aufrechten, einen so beinahe tänzelnden Gang. Doch da schon die bereits nächste Bizarrerie: Ich tret aus der Durchfahrt, wende mich zur Stargarder, ein Bub mit seiner Mama kommt mir entgegen und ruft: „Guck mal, der trägt einen Cowboyhut!“ So daß ich wirklich stehenbleibe und dem Knaben hinterhersprech: „Aber das ist doch kein Cowboyhut!“ Sogar bei der Mode hört unterdessen die Bildung schon auf. Was mich darauf bringt, daß ich auf keinen Fall vergessen darf, mich nachher in die Zoomkonferenz der Uni Bamberg einzuloggen, in der die Referenten des letzten Semesters über ihre Erfahrungen mit der coviden Chatlehre sprechen wollen und sicher auch werden. — Moment, Zettel Stift:
krrritzelkratzlllll,
nu‘ vergeß ich es nicht
Weiters, fürs Abschluß-CT Termin mit dem Sana vereinbaren, danach Besprechung mit dem Onkologen. Mehr könnten wir heute nicht mehr tun. Er wolle aber mit den CTs vorsichtig sein: „Die Strahlenbelastung durch eine einzige Session entspricht dem Fünfhundertfache eines Lungenröntgens.“ Für Krebspatienten beruhigend nicht. Dennoch hätte ich einfach gerne gewußt, wie jetzt sich, da Magen und Gallenblase raus sind, meine Organe in mir verteilen; das sozusagen Loch bleibt ja nicht einfach leer.
[Zweiter Latte macchiato
France musique contemporaine:
Pierre Mercure, H20 pour Severino – version pour clarinette à vent (1965)]
Also fang ich heute wieder mit dem Sport – und also auch den Trainingsprotokollen an. Ich solle mich nur nicht wurmen, wenn die Leistungsfähigkeit noch mies sei. „Sie werden sehen, wie schnell Sie wieder aufbauen. „Ja aber meiner Sorge ist, daß ich ja schon jetzt die vorgeschriebenen acht Mahlzeiten nicht schaffe. Zwar halte ich prima mein Gewicht und bin auch ästhetisch momentan sehr zufrieden, aber wenn ich wieder trainiere, werde ich enorm Kalorien verbrauchen. Wie kriege ich die denn dann auch noch in mich rein?“ Ich hätte schlichtweg die Befürchtung, dann tatsächlich geradezu rutschend abzunehmen. „Ihr Appetit wird steigen … und aber selbst wenn: bereiten Sie sich gesondert einen Eiweißshake, greifen Sie auf die Astronautennahrung zurück. Ihr Immunsystem wird es Ihnen danken. Der jahrelange Sport hat Ihnen so grandios durch die Krebsbehandlung geholfen, da sollten Sie das Training jetzt nicht einfach mehr ignorieren. Bauen Sie neu auf!“
Womit ich entlassen war und zurück in die Prenzlauer Berge spazierte.
Dort erwartete mich die Fortsetzung der Gesamtaufnahme aller Mahler-Sinfonien unter Gielen; Franz-Josef Knelangen hat mir die CDs geschickt, und tatsächlich halten einige Interpretationen ziemlich gut mit Currentzis, Bernstein, Barbirolli mit; man hört (ich höre), was es anderswo nicht gibt, eigenwillige Klarinettenrutscher etwa in der Neunten. Bei Komponisten wie diesem lohnt es sich unbedingt, verschiedene Interpretationen zu kennen. Es ist nach wie vor ein Jammer, daß sich so wenige Dirigenten für Pettersson interessiere, geschweige solche von Rang. Vielleicht mach ich es doch wahr und schreibe Currentzis deshalb. Und lege ein Buch von mir bei, um mich auszuweisen. Der Bursche ist zu wahnsinnig, um nicht zu spüren, was das heißt.
Sowie wird mir Eötvös immer interessanter. Übrigens. Finde ich. Zuerst fiel es mir vor sechs Jahren in der Berliner Philharmonie auf, als Kopatchinskaya sein zweites Violinkonzert interpretierte.
[Peter Eötvös, DoReMi – Zweites Violinkonzert (2012)]
Und nun stieß ich dank des französischen Senders auf die „Musik für New York“. Daran werde ich über den Tag weiterhören, auch parallel zur nächsten Durchsicht des Béarttyposkriptes, für das Parallalie nun schon die übrigens nur zwei Korrekturen geschickt hat, so wenige freilich deshalb, weil er sich bereits früher immer mal wieder eines dieser Gedichte ansah und Einwände geltend gemacht hat. Nun fehlen noch die Latein- und Altgriechisch-Korrekturen sowie die eine arabische Stelle, die das berühmte Allah u’akbar ins Anrufen der Großen Mutter, Demeters usw., weiblich also, umformt — heikel deshalb, weil es sich dann, aus patriarchal-religiöser, mithin dogmatischer Sicht um möglicherweise eine Blasphemie handelt, freilich eine, die mir und meinen Überzeugungen entspricht. Ich brauche also einen arabischsprechenden Menschen, gerne eine Menschin, die und der mich für so etwas nicht gleich verdammt, vielmehr meinem, ich sag mal, matriarchalen Machismo sympathisierend gegenübersteht.
Noch ein Wort zu vielleicht gar nicht ganz anderem Geschehen, auf das mich → dieser gute Artikel Bersarins aufmerksam gemacht hat. Ich bin (u.a. religions-)politisch mit Monika Maron ganz gewiß nicht auf einer Linie, und auch ästhetisch unterscheidet uns Immenses. Doch die, euphemistisch gesprochen, „Trennung“ ihres Verlages, S. Fischer, von dieser Autorin verlangt danach, sich mit ihr solidarisch zu erklären, ja sich entschieden auf ihre Seite zu stellen. Was ich hiermit tue. Wobei das Geschehen selbst (bitte lesen Sie’s, liebste Freundin, bei AISTHESIS nach) erschreckend „gut“ in den Moralwahn unserer Gegenwart paßt, den sogenannt feministischen wie auch sonstigen Correctness-Irrsinns, und fast will es mir scheinen, als hinge sogar Corona damit zusammen, insofern die, wie auch immer, „Pandemie“ dazu führt, Menschen ganz ebenfalls nötigend zu lenken. Es gibt auch ein linkes Biedermeier. Restauration herrscht nicht mehr nur rechts — eine Katastrophe, die mir größer vorkommt, als Covid-19 wird jemals sein können. Vielleicht regt sich in besonders jungen Leuten ja doch so etwas wie Widerstand, wo der Neue Biedermeier nur von „Covidioten“ spricht; ein unbegriffener, sozusagen instinktiver Widerstand vielleicht, doch einer eben „der Natur“.
Darüber denke ich subkutan permanent nach, dieses Adjektiv, subkutan, bewußt wählend: als körperlichen Audruck für nicht vom Willen gesteuerte, gesunde biologisch-psychische Vorgänge.
Ihr ANH
[Mahler, Zehnte Sinfonie (Adagio), Gielen]
[15.30 Uhr
Eötvös, The Gliding of the Eagle in the Skies (2012)]
Tatsächlich das Training → wieder aufgenommen, wenn auch erst einmal nur knapp 9 Kilometer und als Intervall aus rund zwei Dritten Laufen und einem Gehen. Mußte mich danach aber doch legen, um dem Kreislauf Ruhe zu geben.