[Arbeitswohnung, 7.06 Uhr
 Разумóвский → III C-Dur mit dem hinreißend fugierten Prestofinale]
Разумóвский → III C-Dur mit dem hinreißend fugierten Prestofinale]
Um zehn nach sechs hoch, nachdem ich gestern im Anschluß an das online-Ganztagsseminar lange noch, doch nicht vom Schreibtisch aus, Musik gehört habe, sondern konzentriert im breiten Musiksessel, der mit den Boxen jeweils die Spitze eines beinahe gleichseitigen Dreiecks bildet, bilden auch muß, damit sich Stereophonie perfekt entfalten kann – nur „nahezu“ perfekt, weil die Klangwege der von den Boxen ausgesandten Tonwellen
nicht unabgelenkt sind:
 Bei der linken steht der große Mitteltisch im Weg, bei der rechten ein vollgetürmtes Ablagetischchen; außerdem befindet sich nach links Richtung Ofen einigermaßen freier Raum, nach rechts hingegen gleich die Flurtür, die für zwar nicht wirklich starke Klangreflektionen sorgt, aber sie sind zweifellos da. Es ist halt, akustisch, kein trockener, sondern ein Lebens- und Arbeitsraum; klug hat auf diese Art Umstand
Bei der linken steht der große Mitteltisch im Weg, bei der rechten ein vollgetürmtes Ablagetischchen; außerdem befindet sich nach links Richtung Ofen einigermaßen freier Raum, nach rechts hingegen gleich die Flurtür, die für zwar nicht wirklich starke Klangreflektionen sorgt, aber sie sind zweifellos da. Es ist halt, akustisch, kein trockener, sondern ein Lebens- und Arbeitsraum; klug hat auf diese Art Umstand ![]() BOSE seine Technologie gegründet und ausgerichtet; für unterwegs sind diese Lautsprecher deshalb meine Wahl. Hier freilich bleiben
BOSE seine Technologie gegründet und ausgerichtet; für unterwegs sind diese Lautsprecher deshalb meine Wahl. Hier freilich bleiben  ihnen, und andren Marken sowieso, meine ProAcs gebirgshoch überlegen. Will ich indes den „reinen“ Klang, nehme ich die STAXes
ihnen, und andren Marken sowieso, meine ProAcs gebirgshoch überlegen. Will ich indes den „reinen“ Klang, nehme ich die STAXes![]() , was ich, aus Rücksichtnahme auf meine Nachbarn, nach 20 Uhr meist ohnedies tue. Gestern allerdings nicht; da hörte ich laut bis zehn – und setze heute morgen fort, wo ich nachts aufgehört habe. Denn eigentlich geht es um op. 132 und speziell, darin, den „Heiligen Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit“, dessen lydische Tonart, wie Sie, Freundin, wissen, eine ganz besondere Rolle auch in den leider weiterhin unabgeschlossenen Triestbriefen spielt. Jedenfalls höre ich mich von Beethovens Rasumowski I ff über op. 132 nach 135 nun durch; es wird mich diesen ganzen Sonntag weiterbegleiten.
, was ich, aus Rücksichtnahme auf meine Nachbarn, nach 20 Uhr meist ohnedies tue. Gestern allerdings nicht; da hörte ich laut bis zehn – und setze heute morgen fort, wo ich nachts aufgehört habe. Denn eigentlich geht es um op. 132 und speziell, darin, den „Heiligen Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit“, dessen lydische Tonart, wie Sie, Freundin, wissen, eine ganz besondere Rolle auch in den leider weiterhin unabgeschlossenen Triestbriefen spielt. Jedenfalls höre ich mich von Beethovens Rasumowski I ff über op. 132 nach 135 nun durch; es wird mich diesen ganzen Sonntag weiterbegleiten.
Doch seinetwegen, des Briefromanes halber, n i c h t kam ich auf ihn, den Dankgesang. Sondern als ich gestern einer „meiner“ Studentinnen zuhörte, die ihren Text von schwerer Genesung und dem schließlichen Glück erzählen ließ, endlich, endlich wieder gehen zu können, fiel mir sofort Beethovens Quartettsatz ein, und ich sagte es auch, ja lud das Stück für alle herunterladbar ins Padlet hoch, in das für alle lesbar die Aufgaben und Übungsarbeiten eingestellt werden – übrigens eine von mir blöderweise nur zögerlich angenommene Empfehlung Phyllis Kiehls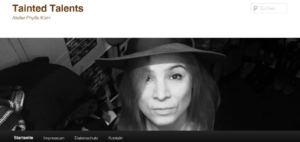 ; hätte ich auf die kluge Frau vorher gehört, wäre einige Arbeit leichter gewesen. Wie nun auch immer. Bin halt ein Sturkopf. Aber die Erzählung dieser Studentin verströmte geradezu dieselbe Aura wie Beethovens ergeifender Tritus authenticus. Es war frappierend, gleichermaßen beklemmend wie erlösend. Ob nun diese jungen Menschen a u c h mit der Musik nun werden etwas anfangen können, weiß ich freilich nicht. Doch wenn ich lehre, tu ich es immer synkretistisch, beziehe also soviel wie möglich andere „Disziplinen“ mit ein und verstreue – was, wenn wir alle Glück haben, ein Säen ist – dauernd Leuchtkapseln innerster Bildungsbeglückung.
; hätte ich auf die kluge Frau vorher gehört, wäre einige Arbeit leichter gewesen. Wie nun auch immer. Bin halt ein Sturkopf. Aber die Erzählung dieser Studentin verströmte geradezu dieselbe Aura wie Beethovens ergeifender Tritus authenticus. Es war frappierend, gleichermaßen beklemmend wie erlösend. Ob nun diese jungen Menschen a u c h mit der Musik nun werden etwas anfangen können, weiß ich freilich nicht. Doch wenn ich lehre, tu ich es immer synkretistisch, beziehe also soviel wie möglich andere „Disziplinen“ mit ein und verstreue – was, wenn wir alle Glück haben, ein Säen ist – dauernd Leuchtkapseln innerster Bildungsbeglückung.
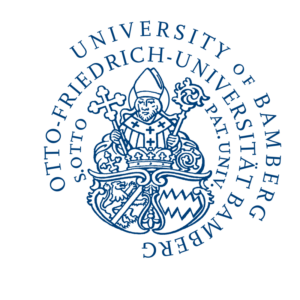 Allerdings habe ich bei diesem → Bamberger Lehrauftrag das Privileg nicht nur hinreißend leidenschaftlich engagierter, sondern ebenso talentierter Zuhörerinnen und Zuhörer … – nein, Seminarmitgestalterinnen und -gestalter. Imgrunde muß ich kaum etwas anderes tun, als ihnen Augaben zu stellen, deren einige übrigens nicht unfies sind, aber tatsächlich extrem trainieren. Über die Lösungen, auf die die jungen Leute kommen, kann ich bislang nur staunen. Ich meine, ich lasse sie ihre je schönste Lebenserinnerung auf sozusagen Papier („in Datei“) bringen, also etwas ihnen wirklich Nahes – das Seminar beschäftigt sich mit autobiografischem Schreiben -, und dann besitze ich die Unverfrorenheit, sie genau dieses Nahe extrem von sich fernzurücken, indem sie es noch einmal erzählen sollen, nun aber als Krimi, als Märchen, dialogisch oder gar im Dialekt sowie mit entweder vulgärem oder sentimentalem Vokabular. Für den poetischen Prozeß ist dergleichen selbstverständlich wichtig, ja unumgehbar, um zu kapieren, daß auch unser Nahstes, wenn wir schreiben und eben auch veröffentlichen wollen, ein pures Material ist, das wir zu behauen, zu feilen, zu schmieden und zu schmirgeln, zu formen also, haben. Was wir hinausgeben, ist nicht mehr unsres, löst sich von uns ab, bis es fremdkristallen dasteht. Sie wissen, Freundin, ich nenne dies den perversen Prozeß, weil in der Kunst eben auch unser Schmerz, selbst der tiefste, nichts als ein Material ist, das, gelingt die Formung, unversehens s c h ö n wird. Und, als aber eben Fremdes, b l e i b t.
Allerdings habe ich bei diesem → Bamberger Lehrauftrag das Privileg nicht nur hinreißend leidenschaftlich engagierter, sondern ebenso talentierter Zuhörerinnen und Zuhörer … – nein, Seminarmitgestalterinnen und -gestalter. Imgrunde muß ich kaum etwas anderes tun, als ihnen Augaben zu stellen, deren einige übrigens nicht unfies sind, aber tatsächlich extrem trainieren. Über die Lösungen, auf die die jungen Leute kommen, kann ich bislang nur staunen. Ich meine, ich lasse sie ihre je schönste Lebenserinnerung auf sozusagen Papier („in Datei“) bringen, also etwas ihnen wirklich Nahes – das Seminar beschäftigt sich mit autobiografischem Schreiben -, und dann besitze ich die Unverfrorenheit, sie genau dieses Nahe extrem von sich fernzurücken, indem sie es noch einmal erzählen sollen, nun aber als Krimi, als Märchen, dialogisch oder gar im Dialekt sowie mit entweder vulgärem oder sentimentalem Vokabular. Für den poetischen Prozeß ist dergleichen selbstverständlich wichtig, ja unumgehbar, um zu kapieren, daß auch unser Nahstes, wenn wir schreiben und eben auch veröffentlichen wollen, ein pures Material ist, das wir zu behauen, zu feilen, zu schmieden und zu schmirgeln, zu formen also, haben. Was wir hinausgeben, ist nicht mehr unsres, löst sich von uns ab, bis es fremdkristallen dasteht. Sie wissen, Freundin, ich nenne dies den perversen Prozeß, weil in der Kunst eben auch unser Schmerz, selbst der tiefste, nichts als ein Material ist, das, gelingt die Formung, unversehens s c h ö n wird. Und, als aber eben Fremdes, b l e i b t.
Man kann dies lehren, ja. Aber worauf es ankommt, ist, es erleben zu lassen und dies als „Lehrer“ schützend zu begleiten, und auch, die Studentinnen und Studenten, wo es Not tut, aufzufangen. 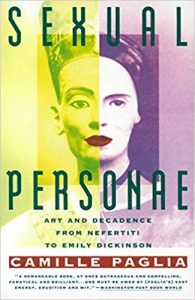 Was Paglia über Sexualität schrieb, sie sei kein Spaziergang im Grünen (Wehe, wehe, „Wokeness[1]Nie vergessen! Die andere Seite der Reinheit ist immer — D r e c k.„!), gilt eben auch für die Kunst. Für sie sogar besonders. Nicht nur deshalb hängt beides derart eng aneinander wie, um mit Adorno zu sprechen, Eros und Erkenntnis. Es sind Paare.
Was Paglia über Sexualität schrieb, sie sei kein Spaziergang im Grünen (Wehe, wehe, „Wokeness[1]Nie vergessen! Die andere Seite der Reinheit ist immer — D r e c k.„!), gilt eben auch für die Kunst. Für sie sogar besonders. Nicht nur deshalb hängt beides derart eng aneinander wie, um mit Adorno zu sprechen, Eros und Erkenntnis. Es sind Paare.
(Zur Wokeness noch: Ein Student, der die „vulgäre“ Variation sich ausgesucht und hinreißend uncorrect hat Erzählung werden lassen – es war, was wir alle fanden, wie eine Befreiung für ihn, einen Modus zu durchschwimmen, der heutzutage weniger erlaubt ist als er’s jemals gewesen, und insofern jetzt schon Lebenserfahrung; entsprechend lebendig geriet der Text … – also dieser Student brachte unfaßbare Schimpfwörter in die Welt, rundweg Neologismen, allerdings solche, die „schon bei ihrer Erfindung Zitat[2](Günter Steffens)“ sind, darunter den, siehe meinen heutigen Titel, Hodengnom. Sowie „Arschkrampen“, „Rollbrettuntermenschen“ (für Skateboarder), „Flachpfeifen“ sowie „unterentwickelte Lärmdämonen“. Uns liefen die Tränen vor Lachen. Nicht zu fassen, wie sprühend lebendig online-Unterricht sein kann. Ich schrieb es Ihnen → dort schon und werde nun laufend bestätigt.)
[Von Rasumowski III zu op. 74 gewechselt.]
Jedenfalls. Es ist glückhaft, dieses Seminar zu geben. Daß es das ist, habe ich den Studentinnen und Studenten zu danken, denen es nicht einmal etwas ausmacht, wenn wir über eine Stunde überziehen. Was sich in den beiden bisherigen Ganztags-„Sitzungen“ geradezu organisch ergab, wollten wir allen entstandenen Texten die Gerechtigkeit und vor allem Sorgfalt widerfahren lassen, die ihnen gebühren. Doch selbstverständlich wären nach den vier Sitzungen Vertiefungen nötig, besonders in Hinsicht auf Stilistik und, folgend, Konstruktion. Mehr als nur ein, und zwar g a n z e s Semester ließe sich damit füllen. — Und ich, ich selber lerne auch. Dafür das beste Indiz, zumal nicht ohne Witz, ist, daß mich der eine Texte dieser Studentin nun auf den Beethovenstreichquartett-Trip gesetzt hat, den ich mir, damit ich bei der weiteren Überarbeitung der Verwirrung nicht zu essen vergesse, soeben mit sechs Dronabinoltropfen angewürzt habe. Deshalb wird irgendwann, erfahrungsgemäß in etwa zwei drei Stunden, meine Zeit ihre abgegrenzten Konturen verlieren und zu einem musikpulsierenden Kontinuum werden, das meine Sätze als Karawanen durchziehen:
Die Zeit geht nicht, sie stehet still,
Wir ziehen durch sie hin;
Sie ist die Karawanserei,
Wir sind die Pilger drin[3]Gottfried Keller.
→ Die Zeit geht nicht
Ihr
ANH
References
| ↑1 | Nie vergessen! Die andere Seite der Reinheit ist immer — D r e c k. |
|---|---|
| ↑2 | (Günter Steffens |
| ↑3 | Gottfried Keller |

Reni Ina von Stieglitz
So rein akustisch, verstehe ich ihr Anliegen. Der „Raum“, der von dieser Musik erfüllt ist, liefert Ihnen einen Hörgenuss ganz eigener Art, individuell und an den Gegebenheiten angepasst. So ist das eben und selbst wenn Sie sämtliche Bücher umstapeln würden, hätten Sie immer wieder nur diesen eigenen Klang, der sich an den GesamtBedingungen messen lässt…
Alban Nikolai Herbst
Ich habe auch noch nie die gesamten Bässe meiner ProAcs hören können, weil sie zu ihrer Entfaltung eine Raumdiagonale von sechzehn Metern brauchten – was (jedenfalls bei offenen Fenstern) leider bedeutet, daß sie, aber fast n u r sie, i,m zweiten Hinterhaus ankommen. Wenn es, eigentlich nur im Sommer, mal ein bißchen Unwillen wegen meiner Musik bei den Nachbarn gibt, dann tatsächlich nur dort. Kam bis vor zwei Jahren etwa einmal jährlich vor, seither geschah es nicht mehr. Vielleicht ist er weggezogen (es war stets nur eine bestimmte Person).
Reni Ina von Stieglitz
…ah ja, gibt es bei uns auch. Eine Dame aus der Nachbarschaft beglückt den „gesamten Innenhof“ mit klassischer Musik. Geht so von 12- 13 Uhr. Bei weit geöffnetem Fenster und Sonnenschein…oft sind schöne MusikSchnippsel zu hören, weil: die leisen Parts kommen bei mir “ oben“ , nicht mehr an…schade eigentlich…
Alban Nikolai Herbst
Kämen bei Ihnen lediglich, wie hier, die Bässe an, die selbst in der Nähe enormen Druck haben, wären Sie möglicherweise ebenfalls verstimmt. Ich konnte den Mann also verstehen. Nach 20 Uhr weiche ich eh in aller Regel auf die Kopfhörer aus.