
Ich habe – nach über sechs Stunden unentwegt Musik, erst mit den Bildern des → 3sat-Mitschnitts, danach ohne sie – … habe s e l b s t gezögert, ob ich dieses Bild nicht nur einstellen, nein überhaupt aufnehmen dürfe. Sofort fiel mir das Wort „obszön“ ein, und ich schrieb es, weiter- und weiterweinend, meiner Lektorin, nannte, was über mich gekommen, „flennen“, denn das war es. Und weiß nun ebensowenig, nachdem ich mich dafür entschied, ob ich es erklären darf. Ich habe in ihr ja ein außengelagertes literarisches ÜberIch, das es mir strikt verbieten würde, wahscheinlich. Deshalb wollte ich alles, und ob überhaupt, erst heute früh entscheiden und nicht, wie seit dem 24. Februar sonst, als erstes die neuen Nachrichten über den Krieg und die Artikel zu ihm lesen, war in dem Kampf quasi ja selbst, einem publizistischen freilich, nicht im Gewehrfeuer, um von den Raketen zu schweigen, daß solche hier schon einschlagen würden, aber allenthalben dennoch Krieg, selbst in den getippten Wortwechseln, derer es gestern erneut viele waren, die sich geradezu anboten, aus ihnen je einen neuen → Ukraine-Dialog zu formen.
Es war eine Entscheidung gewesen, gestern mittag, F r i e d e n zu haben. „Du mußt von dem Krieg wegkommen“, schrieb die Lektorin. „Du darfst dich nicht aufsaugen lassen“, schrieb die Wölfin. „Sie müssen auf Distanz gehen“, schrieb eine Brief- und Seelenfreundin.
An Sonnabend hatte um 21.57 Uhr लक्ष्मी in Whatsapp getippt: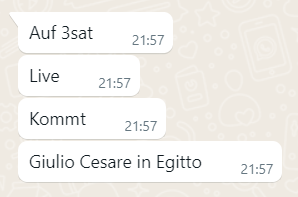
Ich war in anderem drin, wußte, ich würde mich nicht konzentrieren können, aber ließ den Mitschnitt mittels des JDownloaders im Hintergrund herunterladen, ging irgendwann schlafen, ohne überhaupt zu kontrollieren, ob es geklappt hatte.
Der Sonntag brach an, die längst schon „Kriegsroutine“ ging wieder los, lesen, lesen, lesen und bereits, auf FB, die ersten Wortwechsel. Vor mir lag aber immer noch die wieder und wieder aufgeschobene Nachwort-Aufgabe für Eigners nachgelassenen Roman; ich stehe dem Verleger im dringendsten Wort. Ging nicht, ging abermals nicht, der Krieg hielt mich fest. Die Brieffreundin schrieb: „Ich habe heute Mittag wie immer den Presseclub gesehen, da kommt Einiges auf uns zu, was wir noch gar nicht übersehen können, mit der jetzigen Embargo-Diskussion werden Zusammenhänge klar, die mich beunruhigen.“ Ich antwortete, die dräuenden Zeichen ebenfalls zu sehen und, vor allem, zu spüren. Dann öffnete ich die Eignerdatei. Und sagte Stop. – Hatte gestern der Download geklappt?
Hatte er.
Ich ging in die Küche, um mir vom gestern zubereiteten Dal zu nehmen, wärmte auf, streute gehackten Koriander darüber, tat an den Tellerrand drei Klatscher Joghurts hinzu, nahm einen Fladen Chapatti, Inder essen mit den Fingern, es paßte zu meiner लक्ष्मी Link.
Und sah mir die Aufführung an, von Anfang an und dann zunehmend fasziniert:
Mein Fasziniertsein nahm ständig zu, auch weil keine der Sängerinnen meinen erotischen Vorlieben entsprach, sie alle waren zu drall. Aber. Wenn. sie. s a n g e n ! Die Musik mächtig, zugleich filigran, in den ProAcs, mein Zimmer bebte, nebenan die Wohnungen taten’s wohl auch. Doch niemand kam, um um Ruhe zu klopfen. Alle, alle ließen mich.
Welch grandiose Inszenierung Keith Warners, wie feinsinnig und kraftvoll! Doch vor allem, wann hatte ich zuletzt einen Counter gehört, der wie Michael Chance singen konnte? Und dieser Ausdruck, die Schauspielkunst des gesamten Ensembles, besonders aber Bejun Mehtas, allein die filigranen Bewegungen der Lippen, des Kehlkopfs … Ich konnte es nicht fassen. Wie hin- und hergerissen Louise Alders Cleopatra, welch Überhebung, dann Sturz, dann Klage und Erlösung, Klage aber besonders der Cornelia Patricia Bardons – und wie Mehta vor allem Jake Ardittis Counter mitzog, der besser, ständig besser wurde. Dazu der  Concentus Musicus Wien, von dem ungeschlacht wirkenden, so enorm präzisen und derart warmherzigen Ivor Bolton geleitet, daß mir kein anderes Wort als „in strömender Hitze“ dazu einfällt.
Concentus Musicus Wien, von dem ungeschlacht wirkenden, so enorm präzisen und derart warmherzigen Ivor Bolton geleitet, daß mir kein anderes Wort als „in strömender Hitze“ dazu einfällt.
Ich wiederhole, ich war fasziniert, ja berauscht. Und aber doch noch  nicht ergriffen, sah mir noch den Applaus an, freute mich, erinnerte mich.
nicht ergriffen, sah mir noch den Applaus an, freute mich, erinnerte mich.
In diesem kleinen Opernhaus war ich einmal gewesen, vergangenes Jahr mit Elvira M. Gross, meiner, Sie wissen, Lektorin, die dieses Theater an der Wien so sehr liebt.  Weshalb, verstand ich da noch nicht ganz. W a s ich aber jetzt verstand, war, ich müsse sofort noch einmal hören, doch n u r noch hören. Keine Bilder mehr. Ich hatte eine gute Inszenierung gesehen, gesehen aber doch zu v i e l.
Weshalb, verstand ich da noch nicht ganz. W a s ich aber jetzt verstand, war, ich müsse sofort noch einmal hören, doch n u r noch hören. Keine Bilder mehr. Ich hatte eine gute Inszenierung gesehen, gesehen aber doch zu v i e l.
In die Küche wieder, den Eiweißshake bereiten, den ich täglich des Krebses wegen trinke, also um nicht weiter abzunehmen ohne einen Magen; → Liligeia selbst ist ja still, die schlafende Vulkanin. Auch das indes kommt zu meiner Not der vergangenen Wochen hinzu, daß ich zu fürchten begann, der Kriegslärm werde sie wieder aufwecken: zu groß meine ständige Angst, manchmal Panik, zu verhärtet mein kämpfendes Argumentieren und immer wieder kurz vor Abstürzen in Depression, wenn ich abermals merke, nicht mehr arbeiten zu können, was „dichten“ meint, arbeiten selbst kann ich schon – aber immer nur im Blick diesen Krieg, wieder und wieder den Krieg und daß ich gegen ihn anschreiben müsse, weil andres mir nicht bleibt.  Deshalb nun auch das Bromazepam (Lexotanil gibt es nicht mehr), aber vorsichtig, ich weiß um die Gefahr, die erste halbe Tablette, vor fünf Tagen, war schon überdosiert, ich schlief ab mittags fünf Stunden. Also eine Viertel Tablette alle zwei Tage. Ich werde dann ruhig, kann auch mal wegdenken. Höre auf, mich zu verkrampfen, und die Angst weicht. Ich habe den Krebs bislang so gut überstanden, weil ich keine hatte und mich nicht hilflos fühlte. Seit dem 24. Februar ist es anders. Mit dem Krieg stieg die Gefahr, daß Liligeia meine Schwäche nutzt. Wenn sie nur schläft und nicht fort ist. Was niemand wissen kann. Als geheilt gilt man erst nach fünf Jahren, die OP liegt erst eindreiviertel Jahre zurück. Und, wie ich gestern Elvira schrieb, es ist ein extremes Merkmal meiner Arbeit, daß ich immer hingucke, nie weggucke, schon gar nicht verdränge.
Deshalb nun auch das Bromazepam (Lexotanil gibt es nicht mehr), aber vorsichtig, ich weiß um die Gefahr, die erste halbe Tablette, vor fünf Tagen, war schon überdosiert, ich schlief ab mittags fünf Stunden. Also eine Viertel Tablette alle zwei Tage. Ich werde dann ruhig, kann auch mal wegdenken. Höre auf, mich zu verkrampfen, und die Angst weicht. Ich habe den Krebs bislang so gut überstanden, weil ich keine hatte und mich nicht hilflos fühlte. Seit dem 24. Februar ist es anders. Mit dem Krieg stieg die Gefahr, daß Liligeia meine Schwäche nutzt. Wenn sie nur schläft und nicht fort ist. Was niemand wissen kann. Als geheilt gilt man erst nach fünf Jahren, die OP liegt erst eindreiviertel Jahre zurück. Und, wie ich gestern Elvira schrieb, es ist ein extremes Merkmal meiner Arbeit, daß ich immer hingucke, nie weggucke, schon gar nicht verdränge.
Doch gestern hatte ich nichts eingenommen, ganz bewußt pausiert.
Zwei Bananen in den Eiweißshake schneiden, zwei Zitronen auspressen, den Saft hinzugeben und alles schnell vermixen, damit die Milch nicht gerinnt. Etwa ein Liter Flüssigkeitsmus. Damit an den Schreibtisch zurück und jetzt die Staxhörer nehmen.
Nur die Musik.
Es brauchte keine zehn Minuten, und die Tränen flossen. Was hatte ich vorhin alles nicht gehört! Jetzt, die Bilder nur im Sinn, faltete sich eine Klangwelt in mir auf, die mich geradezu verflüssigte, jede, spürte ich, innre Verstarrung wurde erst gelockert, Erstarrung a u c h, nach zwei Stunden Musik war ich komplett naß, denn auch die Haut, schien es, weinte. Elvira meldete sich wieder, ich tippte es und sang wahrscheinlich dabei mit, also graunzte, und dann begann ich zu heulen, immer wieder in Anfällen, zwischen denen ich erneut der Freundin tippte, auch der Brieffreundin, die sich ebenfalls meldete, weil ich beiden meinen Mitschnitt zukommen ließ, während ich hörte, lauschte, abermals mitsang, abermals krampfartig heulte. So daß ich begriff, um wie vieles ich heulte, nicht wegen der Operngeschehen, nicht, weil Cornelia so leidet, Sesto derart wütend ist und Cäsar unvergleichbar zart, wie oft er sich auch in die Brust wirft als Herr. Sondern es war die Not-an-sich, die aus dieser Musik trat, hervortrat, alle Not in sich umfangend und ihr Klang gebend, ja überhaupt Stimme. Ich heulte, begriff ich, wegen dieses Krieges, heulte wegen meiner Hilflosigkeit, die zu Angst gefroren war, was nun schmolz, heulte meines Alleinseins wegen, eines am Grunde, ich bin ja geliebt, das ist es nicht, aber dennoch ohne jemals wieder, empfand ich, gestreichelte Haut. Ich heulte, weil ich mich auf → den Gedichtband, endlich die Béarts, die nächste Woche heraussein werden, nicht mehr freuen kann und weil mir die Dichtung grad insgesamt egal ist. Ich heulte, weil ich derart in Sorge, daß dieser Krieg auch meinen Sohn erreicht, und die Zwillinge. लक्ष्मी, Elvira, Do und die Löwin sowie alle Freunde. Und zum ersten Mal heulte ich wahrscheinlich auch wegen des Krebses, dessentwegen ich in den seit der Diagnose nun schon zwei Jahren nicht wenigstens mal geweint habe. Nicht eine einzige Träne ist mir gekommen. Nicht mal mehr darum, daß mir die Chemo die Fruchtbarkeit zerstört hat. Seit der Diagnose stehe ich in permanentem Kampf, ohne es gewußt zu haben und hätt es wissen auch nicht dürfen, wenn ich da durchkommen wollte. Was mir gelang. Weil ich etwas tun konnte, mich verhalten konnte. Nun heulte ich und heulte, weil ich gegen diesen Krieg nichts tun, ja nicht einmal sicher sein kann, welche von all den Informationen stimmen, welche nicht. Welche nur halbwahr sind. Welche auch gar nicht laut werden dürfen, weil auch der Aggressor sie läse. Das ganze Chaos floß aus mir raus. — Und da, fast am Ende der Musik, kam der kalte Gedanke zurück – den künstlerischen meine ich. Daß alles, was mir und andren geschieht, für die Kunst Material ist und also ich selbst Material bin. Daß ich es fassen muß, es einfassend niederschreiben, um es überhaupt gestalten zu können. Daß diese Gestaltung, Formgebung also, das Substrat meiner Kunst ist. Und ich schoß, um es sichtbar zu machen, diese drei Fotos. Ja, ich schoß. „Wie obszön,“ dachte ich, „wie furchtbar obszön! Und aber doch: wie nötig.“ Und tippte es für Elvira in Signal ein. Weil ich gegenwärtig bleiben wollte:
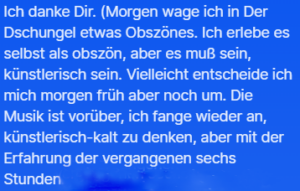
Als ich vorhin um kurz nach sechs aufstand, war mein Gesicht noch verklebt. Aber da ich, nachts noch, diesen Beitrag vorbereitet hatte, noch keinen Text geschrieben, nein, außer einem Teil der Überschrift, doch eines der Bilder ausgewählt – das dort ganz oben – und eingesetzt, tat ich jetzt nicht wie sonst, las nichts, sah keine Mails an, erst recht nicht in den → Ukraine-liveBlog der ZEIT, sondern, nachdem der Latte macchiato bereitet, setzte mich gleich an den Schreibtisch und, nachdem auch die erste Pfeife gestopft, b e g a n n. Sowie er fertig ist, werde ich unter die Dusche springen, um mich danach zu kleiden. Denn es wird Zeit für neue Form. Mag sein, daß ich dann auch den Eignertext schreibe – ihn zu schreiben nun endlich vermag.
Ihr ANH
9.01 Uhr
_______________________________
![]() P.S.: Die oben schon → verlinkte Aufführung
P.S.: Die oben schon → verlinkte Aufführung
kann noch bis zum 9 April abgerufen werden.
(17.19 Uhr
Ich vermochte es n i c h t.)

Così termina alfine il fasto umano,
Ieri chi vivo occupò un mondo in guerra,
oggi risolto in polve un’urna serra.
Piangi, piangi, piangi ….
Georg Friedrich Händel

Giulio Cesare in Egitto
Louise Alder, Cleopatra
Concentus Musicus Wien
Ivon Bolton
___________
Dezember 2021
„lascia ch’io pianga“, „es ist ein weinen in der welt“… und niemand weint, das bild des weinens verstört, ist, ja, obszön, weil es sich nicht schämt, sofern es zeigen will, daß es, das bild, ein weinen zeigt. das ist wohl der unterschied zwischen „lascia ch’io pianga“ und „es ist ein weinen in der welt“. es zeigen und es im innersten wahrnehmend. was ich wahrnehme ist, daß man das weinen nicht wahrnehmen will. insofern ist die obszönität, das zeigen des weinens kein verkehrter weg. der einem zwar luzidität verstellt und den umgang damit, der schwer zu beherrschen ist (mit gefühlen umzugehen, ist eine heikle sache), aber doch rüttelt (nicht unbedingt wachrüttelt (es ist eben kein wecker)). in solch einem weinen kann auch ein schlaf wohnen, ein mohn, dem, was uns nie ziemen wollte, eine ohnmacht als gift entgegenzustellen:
„es ist ein weinen in der welt“
Danke!
Andererseits ist zu befürchten, dass die mit den Tränen in den Augen nicht klar genug sehen, um helfen zu können.
Wenn n u r geweint würde, wäre an Ihrem Einwand etwas dran. Das aber, daß es nur werde und würde, war nie und ist nicht der Fall. So steht es auch in dem Text. Und dazu wurde zu dem entsetzlichen Krieg gerade in Der Dschungel auch schon zuviel geschrieben, als daß dieser Einwand auch nur ungefähr Gültigkeit hätte.
Lieber Alban,
ich muss Dir jetzt unbedingt schreiben, Dein „obszönes“ Foto beziehungsweise Selbstporträt hat mich gestern tief berührt und den ganzen Tag begleitet. So wie auch Deine Texte zum Krieg gegen die Ukraine mich begleiten, manche lese ich mehrmals. Wichtig sind sie, Deine Texte, und vor allem auch Dein Insistieren auf Notfall- und Fluchtpläne, Dein Hinweisen auf den Ernst der Lage. … Ich sage allen, man muss sich nur die Entwicklung hin zum II. Weltkrieg vor Augen halten und sich zumindest rudimentär vorbereiten, sich ein Radio mit Kurbel oder Batterien besorgen, die wichtigen Papiere bereitlegen, Wasserreinigungstabletten besorgen, das Auto betankt haben usw. Allerdings hat kaum jemand von den Jungen die Historie vor Augen, scheint mir, das ist für viele Jüngere so weit weg wie der Dreißigjährige Krieg. Andererseits muss man natürlich jetzt auch weiterleben und vor allem weiterarbeiten, weil sonst ja alles sinnlos ist und man kapituliert hätte und der Feind des Menschlichen und des zivilisierten Lebens gewänne, selbst da, wo er physisch nicht präsent ist. Ich denke immer, wer weiß was bleibt von dem, was man tut und sagt und schreibt, aber täte man nichts und gäbe nichts weiter, hätte das Andere jetzt schon gewonnen.
Herzlich,
Norbert