 [Medikamentenversuch Pregabalin → Sechster Tag]
[Medikamentenversuch Pregabalin → Sechster Tag]
 [Arbeitswohnung, 11.05 Uhr
[Arbeitswohnung, 11.05 Uhr
Tschaikowski, Fünfte, Rodzinsky, LSO]
Nicht zu fassen! Fünfzehn Minuten Sonne soll es heute geben. Und gestern legte ich mich um 15.30 Uhr im noch Hellen auf die Liege  „meiner“ schönen Elena,
„meiner“ schönen Elena,  und als sie das Tattoo gestochen hatte — die zweite Erweiterung ist damit endgültig abgeschlossen —, und ich mich wieder setzte, dann aufstand, um mich wieder anzukleiden, wobei ich aus dem Fenster sah, war es draußen knalledunkel. Am Tresen dann, bei der Abrechnung: „Am Ende wirst Du Dein gesamtes Nervensystem tätowiert haben“ – womit er, was die Bewegung dieses Projektes anbelangt, nicht unrecht hat; zwar „das Nervensystem“ als solches nicht, wohl aber die sozusagen Strukturen des Körpers. Gestern waren es nur Adern –
und als sie das Tattoo gestochen hatte — die zweite Erweiterung ist damit endgültig abgeschlossen —, und ich mich wieder setzte, dann aufstand, um mich wieder anzukleiden, wobei ich aus dem Fenster sah, war es draußen knalledunkel. Am Tresen dann, bei der Abrechnung: „Am Ende wirst Du Dein gesamtes Nervensystem tätowiert haben“ – womit er, was die Bewegung dieses Projektes anbelangt, nicht unrecht hat; zwar „das Nervensystem“ als solches nicht, wohl aber die sozusagen Strukturen des Körpers. Gestern waren es nur Adern –  die, die von der Triskele Rankenausläufern über den gesamten Arm, vor allem Innenarm, zur großer Arterie der Handwurzel führen und sich aus ihr, auf der Handoberfäche sich verteilend, zu den Fingern weisen. Die ich ausgelassen habe.
die, die von der Triskele Rankenausläufern über den gesamten Arm, vor allem Innenarm, zur großer Arterie der Handwurzel führen und sich aus ihr, auf der Handoberfäche sich verteilend, zu den Fingern weisen. Die ich ausgelassen habe.
Mitunter, bei Sommerhitze, treten die jetzt tätowierten Adern „von sich aus“ sehr hervor,  auch die an den Unterarmen – etwas, das ich seit je nicht nur bei mir als ausgesprochen schön empfunden habe; ich habe, seit ich denken kann, eine starke Neigung zur Anatomie, Warum also, dachte ich, diese Adern nicht auch hervorheben, wenn sie befindlichkeitsseits weniger sichtbar sind? Und genau auf dieser, ich sag mal, Vorstellunsbasis wird Yōsei, die vierte von einer Sídhe besetzte Figur der Triestbriefe, ihre Tätowierkunst entfalten. Ein bißchen davon haben Sie in Der Dschungel, liebste Freundin, ja schon → dort lesen können, bevor ich Ihnen vorgestern → in meinem letzten Arbeitjournal den zunächst anstehenden Fortgang der zweiten Erweiterung meines Tattoos erklärt habe. Wie Sie lesen, bleibe ich konsequent.
auch die an den Unterarmen – etwas, das ich seit je nicht nur bei mir als ausgesprochen schön empfunden habe; ich habe, seit ich denken kann, eine starke Neigung zur Anatomie, Warum also, dachte ich, diese Adern nicht auch hervorheben, wenn sie befindlichkeitsseits weniger sichtbar sind? Und genau auf dieser, ich sag mal, Vorstellunsbasis wird Yōsei, die vierte von einer Sídhe besetzte Figur der Triestbriefe, ihre Tätowierkunst entfalten. Ein bißchen davon haben Sie in Der Dschungel, liebste Freundin, ja schon → dort lesen können, bevor ich Ihnen vorgestern → in meinem letzten Arbeitjournal den zunächst anstehenden Fortgang der zweiten Erweiterung meines Tattoos erklärt habe. Wie Sie lesen, bleibe ich konsequent.
Bei der gestrigen Session konnte ich übrigens, weil von meinen Augen weit entfernt gestochen wurde, Elenas Arbeit gut beobachten und war doch ziemlich verwundert darüber, wie wenig Blut, eigentlich gar keines, im Spiel war. Es mag an ihrem Können liegen, denn gehört habe ich anderes. Dabei tätowierte sie direkt auf den Adern, was am Unterarm, wo die Haut relativ dünn ist, vor allem aber in der Ellbogenbeuge denn doch etwas gezwiebelt hat. Interessanterweise auf der Handoberfläche aber auch. Es läßt sich dieser, nun jà, „Schmerz“ gut aushalten indes, man(n) kann ihn sogar genießen, wird eine andere, ich schreibe einmal, Empfindungsperspektive eingenommen: den Berührungen vorausspüren, indem du die Augen schließt und zu – quasi – erraten versuchst, wo nun der nächste Einstich erfolgen werde. Dabei lag ich erstaunlich oft richtig. Schon war die feine Befriedigung da. – Bei einigem bin ich mir allerdings noch unsicher, etwa weshalb von Zeit zu Zeit die Nadel besonders hineindrückend, ich glaube, gedreht wird, eingedreht also. Möglicherweise sind es Momente, in denen Farbe sozusagen eingespritzt wird. Da werde ich nachfragen müssen, bevor ich die Horu-Shi-Novelle anfange. Ich hatte sogar kurz den Impuls, zu tätowieren selbst zu erlernen.
Mit der Novelle hat es ohnedies noch Zeit. Erst sind → die Triestbriefe abzuschließen.  Und wie jedesmal, wenn ich einen neuen Brief begann, habe ich etwas Anlaufschwierigkeiten. Gestern grad mal knapp eine Seite geschafft, ohne mir sicher zu sein, ob der Text so stehenbleiben kann. Die Übergänge von Brief zu Brief habe ich jedenfalls auf Anhieb noch immer kaum im Griff und bin später dann stets überrascht, wie gut sie, allerdings nach mehrmaligem Überarbeiten, dann doch funktionieren. Es ist dies aber zähe Arbeit; der Schreibrausch, wie ich ihn liebe, stellt sich da nie ein, sondern erst, wenn eine Prosa wirklich fließt und dann sich, läßt sich sagen, „selber schreibt“, ohne daß mein konstruierendes Kalkül noch irgendeine Rolle spielte. Solche Passagen sind später allerdings umso penibler durchzugehen und ggbf. zu modifizieren.
Und wie jedesmal, wenn ich einen neuen Brief begann, habe ich etwas Anlaufschwierigkeiten. Gestern grad mal knapp eine Seite geschafft, ohne mir sicher zu sein, ob der Text so stehenbleiben kann. Die Übergänge von Brief zu Brief habe ich jedenfalls auf Anhieb noch immer kaum im Griff und bin später dann stets überrascht, wie gut sie, allerdings nach mehrmaligem Überarbeiten, dann doch funktionieren. Es ist dies aber zähe Arbeit; der Schreibrausch, wie ich ihn liebe, stellt sich da nie ein, sondern erst, wenn eine Prosa wirklich fließt und dann sich, läßt sich sagen, „selber schreibt“, ohne daß mein konstruierendes Kalkül noch irgendeine Rolle spielte. Solche Passagen sind später allerdings umso penibler durchzugehen und ggbf. zu modifizieren.
Aber ich wollte, siehe Überschrift, etwas zu Tschaikowski schreibe, ihm sozusagen und mir.  Seine Fünfte trägt die in der von von mir bereits als Jugendlichem angefangenen Archivierung die Nummer 5, also die LP (altes Vinyl):
Seine Fünfte trägt die in der von von mir bereits als Jugendlichem angefangenen Archivierung die Nummer 5, also die LP (altes Vinyl):
Entsprechend die Sinfonien 1 bis 4 die Nummern 1 bis 4, die Sechste Nummer 6. Es sind dies meine allerersten Platten also, eigene. Meiner Erinnerung nach bekam ich die Fünfte zur 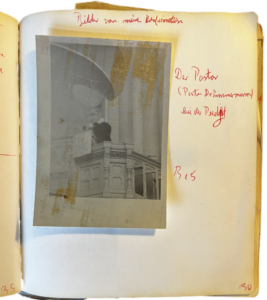 Konfirmation geschenkt, zu der ich nämlich auch meinen ersten Plattenspieler geschenkt bekam. Da war ich fünfzehn. Ich weiß dies so genau, weil ich ein Tagebuch führte, das ich immer noch habe, in das ich auch Fotos einklebte, die ich selbst während der Zermonie aufgenommen habe (ja, meiner eigenen Konfirmation). Nur daß Tschaikowski vorher schon lange eine Rolle gespielt hatte, eine wesentliche. Etwa konnte ich schon zwei Jahre früher nicht einschlafen, wenn nicht das b-moll Konzert lief, und zwar die mich bis heute prägende Aufnahme Svjatoslaw Richters mit den Wiener Symphonikern unter, einem Schwarm meiner Mutter, Herbert von Karajan. Seit ich also etwa dreizehn war, ging das so, doch war eben noch auf die Plattenspieler meiner Mutter und meiner Großeltern angewiesen; die eigentliche musikalische Initiation ergab sich bei diesen n o c h einzwei Jahre früher, weil sie Mitglied eines bertelsmannähnlichen Leserings waren, der auch – eigentlich nach Art vorheriger Bestellungen – Auswahlplatten verschickt, wenn etwas zu bestellen vergessen worden war. So funktionierte das Abonnementskonzept solcher Unternehmen. Nur daß besonders meine Großmutter fast nur Schlager (Ronny, Freddy Quinn) und allenfalls Operetten hörte. Dennoch kamen bisweilen „klassische“ Platten ins Haus, auch Opern in sogenannten Schallplattenfassungen, die durchaus nicht unintelligent
Konfirmation geschenkt, zu der ich nämlich auch meinen ersten Plattenspieler geschenkt bekam. Da war ich fünfzehn. Ich weiß dies so genau, weil ich ein Tagebuch führte, das ich immer noch habe, in das ich auch Fotos einklebte, die ich selbst während der Zermonie aufgenommen habe (ja, meiner eigenen Konfirmation). Nur daß Tschaikowski vorher schon lange eine Rolle gespielt hatte, eine wesentliche. Etwa konnte ich schon zwei Jahre früher nicht einschlafen, wenn nicht das b-moll Konzert lief, und zwar die mich bis heute prägende Aufnahme Svjatoslaw Richters mit den Wiener Symphonikern unter, einem Schwarm meiner Mutter, Herbert von Karajan. Seit ich also etwa dreizehn war, ging das so, doch war eben noch auf die Plattenspieler meiner Mutter und meiner Großeltern angewiesen; die eigentliche musikalische Initiation ergab sich bei diesen n o c h einzwei Jahre früher, weil sie Mitglied eines bertelsmannähnlichen Leserings waren, der auch – eigentlich nach Art vorheriger Bestellungen – Auswahlplatten verschickt, wenn etwas zu bestellen vergessen worden war. So funktionierte das Abonnementskonzept solcher Unternehmen. Nur daß besonders meine Großmutter fast nur Schlager (Ronny, Freddy Quinn) und allenfalls Operetten hörte. Dennoch kamen bisweilen „klassische“ Platten ins Haus, auch Opern in sogenannten Schallplattenfassungen, die durchaus nicht unintelligent  gekürzt waren, auch in musikalischem Verstand nicht unintelligent. Unterdessen kann ich das auch begründet gut beurteilen. Den „Nozze“ habe ich heute noch. Und abgesehen davon, daß diese Aufnahmen fast alle meist noch Mono waren, ist die Klangqualität frappierend, übertrifft in jedem Fall jedes mp3. Dabei waren da schon oft historische Aufnahmen nur aufpoliert worden.
gekürzt waren, auch in musikalischem Verstand nicht unintelligent. Unterdessen kann ich das auch begründet gut beurteilen. Den „Nozze“ habe ich heute noch. Und abgesehen davon, daß diese Aufnahmen fast alle meist noch Mono waren, ist die Klangqualität frappierend, übertrifft in jedem Fall jedes mp3. Dabei waren da schon oft historische Aufnahmen nur aufpoliert worden.
Aber so ging es los für mich mit der Musik, im Alter von ungefähr zehn oder elf. Als ich mit fünfzehn dann den Plattenspieler hatte, war es nicht mehr zu stoppen. In einem musischen Elternhaus wäre ich sofort in eine Musikschule gesteckt worden. Nur hatte ich ein kleinbügerliches (Großeltern) und ein entschieden kapitalistisches (Mutter); beidem galt Musik, wenn denn überhaupt als Kunst, so als Unterhaltung, darin so zu reüssieren, daß sich einmal ein Lebensunterhalt verdienen ließe, für utopische Spinnerei. „Viele sind berufen, wenige sind auserwählt“, pflegte meine Mutter zu sagen. Und als – viel zu spät, mit sechzehn – meinem aufsässigen Willen nicht mehr auszuweichen war, daß ich Geige zu spielen lernen wollte, ließ sie mich sozusagen musikmedizinisch untersuchen und gab mir, weil es, hatte der Experte gesagt, meiner Physiologie am besten entspreche, ein Cello. Die Geige bekam mein Bruder, der E-Musik zum Kotzen fand, indessen ich mich weigerte, zum Cellounterricht auch nur versuchsweise zu gehen und auch niemals dort gewesen bin. G e i g e wollte ich spielen, der Held meines ersten Romans, über fünfhundert Seiten, da war ich vierzehn! … dieser Held war doch Geiger. — Der fast zynische Clou dieser Geschichte ist, daß ich heute selbstverständlich rasend gerne Cello spielen könnte, es neben dem Saxophon sogar mein Lieblingsinstrument ist. Der Experte hatte also völlig recht, faktisch, nicht psychologisch. Wiederum ich meinerseits war zu dumm, hätte doch mit dem Cello erstmal anfangen können, um bei erstbester Gelegenheit auf die Geige zu wechseln. Doch warn die Weichen nun gestellt, da schrieb ich nur noch, schrieb und schrieb und — soff. Soff wie ein Loch. Wenn ich nicht überzimmerlaut Musik hörte, Violinkonzerte vor allem. Und eben Tschaikowskis Sinfonien, stundenlang. Sollte ich die Musik leiser stellen, tobte ich oder haute in den Schloßpark ab, um weiterzusaufen. Eine harte Zeit für alle. Denn ich soff da umso mehr, als die mitsaufenden, nun jà, Freunde aus ihren Kofferradios Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich dazu plärren ließen, was mich dann noch mehr saufen hieß. Und wurde, nachdem ich überdies wegen des Kaufhausdiebstahls eines halben Brathähnchens zu drei Tagen Jugendhaft in Königslutter verdonnert worden war, die ich in Einzelhaft absaß, vor die Alternative entweder eines Erziehungsheimes gestellt oder zu meinem Vater zu ziehen, von dem ich seit meinem vierten Lebensjahr nichts mehr gehört hatte, ja, der für mich eigentlich gar nicht mehr auf Welt, sondern etwas war, worüber zwar wie aus düstre Legenden aus der Vorzeit nicht wirklich abfällig, aber doch nur ungern gesprochen wurde. – Egal. Erziehungsheime lagen mir damals schon nicht. Also zog ich zu ihm und in die nächste Katastrophe, die auch davon nicht abgewendet werden konnte, daß sein Lieblingskonzert ausgerechnet Tschaikowskis op. 35 war, für Violine und Orchester. Die prägendsten Jahre eines Menschen liegen vor dem fünften Lebensjahr, bis ins vierte erinnern wir uns zurück, noch weiter nach hinten nur selten – etwa im analytischen Prozeß. Er hatte mich, ob er wollte oder nicht, geprägt. Nur sah das Ergebnis anders aus, als er, wenn überhaupt was, gewollt hätte. Um von meiner Mutter ganz zu schweigen.
 So, Mittagsschlaf. Dann an die Triestbriefe.
So, Mittagsschlaf. Dann an die Triestbriefe.
ANH
[Tschaikowski, Sechste, MusicAeterna, Currentzis]
