[Sonntag, 18.12.22
Arbeitswohnung, 7.49 Uhr
Gubaidulina, → Astraea für Bläser, Streicher und Schlagzeug (2020)]
So fiel mir gestern ein Klageruf ein, als ich Gubaidulina wiederhörte: Welche Musik sei uns allen entgangen, weil das Patriarchat über Jahrhunderte den Frauen einen Zugang zur (wahrgenommenen, diskutierten) Kunst verbat! Wie vieles ist nicht entstanden, das nun entstehen nicht mehr kann, etwa, weil kein Mensch von Verstand noch ungebrochen komponieren würde, wie, sagen wir, der gebrochene Gesualdo komponiert hat, ein Mörder übrigens, wie Caravaggio Raufbold, ja ein Schläger war, Totschläger sogar. Keine Spur pc. Die unterdessen „erreichte“ Harmlosigkeit der Künste ist zum Schaudern; Wüstlinge wie → Eigner wurden schon vor vierzig Jahren von nicht wirklich mächtigen, aber auf Machtpositionen des Betriebs festgebackten Geisteskrämern an den Rand gedrängt und vergessen gemacht. Schrecklich zivilisiert ist es geworden, „clean“, da gärt dann kaum noch was bei so viel vollmoralinem Sagrotan. Imgrunde, als Künstler, müßte man böse werden wollen, auch wenn man’s gar nicht ist — w e i l man es nämlich gar nicht ist.
[Anselm Kiefer, Les No-nés (2001). Siehe → dort:]
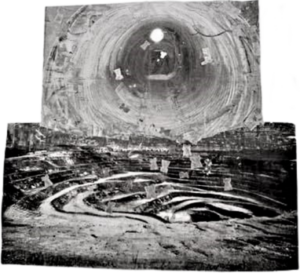 Ich dachte daran, ein Gedicht zu schreiben. Mir fiel der Titel „Schmerzensmusik“ ein — für eine, in → Jeremiae Sinne, Lamentatio über die Nichtgeborenen der Musik, vornehmlich also von Mädchen, die große Komponistinnen hätte werden gekonnt. Es ist schon ganz richtig, geht um den Tempel, nicht zwar um Jerusalems dritten, vielmehr einen Dom des Klangs. Wobei auch darin, in dem Wort „Dom“, mit „domus“ erneut der omnipotente Patriarch steckt. Und aber was für einer! Sehr anders als der furchtbare → Kyril I ist er n i c h t, nur, wahrscheinlich, weniger kitschig. Bei GOtt tun die Menschen den Kitsch hinzu, durch den sie Maria den Sex entzogen. (Sind alles schon, eigentlich, Gedichtzeilen im Rohbau). Wobei andererseits die Schönheit der Männer (sicher, im Wortsinn „beileibe“ nicht aller, Natur ist gerecht) durchaus etwas ist, das zu feiern wäre. Ich, heute, → als quasi Versehrter, nehme sie deutlicher als früher wahr, wo ich sie freilich auch schon bemerkte, doch dann immer weg- und zu den Frauen wieder sah, weil deren Eros, anders als der Männer, auch sexuell für mich ist. Die erotische Wahrnehmung ist ein Daseinsmodus und als der meine bekanntlich sehr stark; aber er braucht nicht ein Handeln. Hingegen Sexualität ist aktiv, und sie drängt, zu berühren und zu durchdringen, um im Aufschrei naß zu verschmelzen: eine Kernfusion von Körpern, die aber befähigt sein müssen — indessen dem Eros Geist und Vorstellungskraft genügend Konditionen sind, um uns meditativ bis ins Versunkenseinsein zu machen. Dennoch, lustvoll aufschrein kann manchmal auch er, unser Geist; nach diesem Orgasmus sind wir lange, lange still. Wenn wir so gesehen haben. Mir, → vor Stuttgart, geschah es zuletzt mit d e m:
Ich dachte daran, ein Gedicht zu schreiben. Mir fiel der Titel „Schmerzensmusik“ ein — für eine, in → Jeremiae Sinne, Lamentatio über die Nichtgeborenen der Musik, vornehmlich also von Mädchen, die große Komponistinnen hätte werden gekonnt. Es ist schon ganz richtig, geht um den Tempel, nicht zwar um Jerusalems dritten, vielmehr einen Dom des Klangs. Wobei auch darin, in dem Wort „Dom“, mit „domus“ erneut der omnipotente Patriarch steckt. Und aber was für einer! Sehr anders als der furchtbare → Kyril I ist er n i c h t, nur, wahrscheinlich, weniger kitschig. Bei GOtt tun die Menschen den Kitsch hinzu, durch den sie Maria den Sex entzogen. (Sind alles schon, eigentlich, Gedichtzeilen im Rohbau). Wobei andererseits die Schönheit der Männer (sicher, im Wortsinn „beileibe“ nicht aller, Natur ist gerecht) durchaus etwas ist, das zu feiern wäre. Ich, heute, → als quasi Versehrter, nehme sie deutlicher als früher wahr, wo ich sie freilich auch schon bemerkte, doch dann immer weg- und zu den Frauen wieder sah, weil deren Eros, anders als der Männer, auch sexuell für mich ist. Die erotische Wahrnehmung ist ein Daseinsmodus und als der meine bekanntlich sehr stark; aber er braucht nicht ein Handeln. Hingegen Sexualität ist aktiv, und sie drängt, zu berühren und zu durchdringen, um im Aufschrei naß zu verschmelzen: eine Kernfusion von Körpern, die aber befähigt sein müssen — indessen dem Eros Geist und Vorstellungskraft genügend Konditionen sind, um uns meditativ bis ins Versunkenseinsein zu machen. Dennoch, lustvoll aufschrein kann manchmal auch er, unser Geist; nach diesem Orgasmus sind wir lange, lange still. Wenn wir so gesehen haben. Mir, → vor Stuttgart, geschah es zuletzt mit d e m:

Albrecht Dürer, Selbstbild
(Entstanden zwischen 1500 und 1515, ja, ein Gemälde;
ich habe die Figur nur freigestellt.)
Welch eine Kraft! Und wie, vor allem, er auf den Kopf und seine Hoden fokussiert; die Schönheit dieser Dastellung rührt genau daher: daß er seinen Malerpinsel dem engen Zusammenhang von Geist und Geschlecht nachfahren läßt; er muß nur folgen, schon entsteht das Bild. Es läßt mich, über sechshundert Jahre später, nicht mehr los. Alle Dichtung fängt hier an. Weshalb ich, um in ihr zu bleiben, meinen eigenen Körper nicht malen kann, doch → auf ihm malen (lassen) muß … — ja, es ist mir poetisch G e b o t, weit mehr als nur die Pflicht.
[13.40 Uhr
Gubaidulina, → Stimmen … Verstummen .., Sinfonie in zwölf Stufen]
Müde nach dem zweiten Frühstück geworden, eineinviertel Stunde geschlafen, tief. Nachgedacht, ein bißchen gefröstelt. Seltsam, daß jetzt, da die Temperaturen wieder ansteigen, das Gefühl, es sei kalt, stärker ist als vorher. Betrifft aber vor allem die Hände, vielleicht auch deshalb indes, weil sie es ja sein müssen, meine Vorhaben als Texte zu realisieren, und ich aber gerade einfach nicht hineinfinden kann. Dabei wäre es so einfach, hab ja alles im Kopf. Doch gibt es da ein Widerstreben. So rauscht der miniature Heizlüfter nun d a u e r n d neben mir, fast dauernd, na gut; wenn ich das Oberlicht öffne, schalte ich ihn 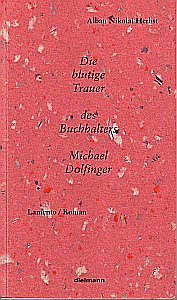
 aus. Zur Erwärmung der, als mein Zimmer betrachtet, übrigen Welt hätte er tatsächlich wenig beizutragen. Immerhin gibt es bei Amazon → eine neue feine Rezension, diesmal zu meinem eigentlich nur noch schlecht lieferbaren Dolfinger-Roman, der eigentlich „Die Erschießung des Ministers“ hatte heißen sollen, was – ich schrieb es, glaube ich, schon mehrfach – nie durchzusetzen war.
aus. Zur Erwärmung der, als mein Zimmer betrachtet, übrigen Welt hätte er tatsächlich wenig beizutragen. Immerhin gibt es bei Amazon → eine neue feine Rezension, diesmal zu meinem eigentlich nur noch schlecht lieferbaren Dolfinger-Roman, der eigentlich „Die Erschießung des Ministers“ hatte heißen sollen, was – ich schrieb es, glaube ich, schon mehrfach – nie durchzusetzen war.
[Montag, 19. 12. 22]
Starre, dumpf.
[Dienstag, 20. 12 22]
Dabei war es am Sonntagabend so gut losgegangen, ja, sehr schön. Doch dann der harte Schock in der vorgeschrittenen Nacht; ich sei Faschist oder dächte faschistisch/faschistoid, mehr ist mir nicht in Erinnerung, also bis zu meinem raptusartigen Platzen — schon gar nicht weiß ich mehr, wie ich heimkam. Das Fahrrad aber habe ich offenbar genommen: jedenfalls stand es gestern Morgen an seinem Platz. Nach dem alkoholfreien Monat war zuviel Kirschgeist auf einmal im „Spiel“; trifft dann etwas auf ein Trauma, das ich sonst im Griff habe, fallen die Griffe urplötzlich ab, und ich stehe im Leeren Raum, aus dem mich nur noch die Energie einer ungebändigten Aggressivität herausschießen läßt, die immerhin nicht tätlich wird, dennoch imgrunde alles verschlimmert. Ich tendiere dann dazu, sämtliche, auch die mir wichtigsten, Verbindungen aus meinem Leben wegzustreichen. Früher geschah so etwas öfter, heute passiert es nur noch selten, ja mit dem, wie es nach wie vor aussieht, überwundenen Krebs glaubte ich sogar, es komplett überwunden zu haben. Ich habe mich geirrt, der Vulkan ist keineswegs erloschen. Er hat nur längere Schlafphasen.
Über den Tag dann wie paralysiert, an Arbeit war nicht mal zu denken. Einen wichtigen Termin verschoben, weil ich nicht fähig war, die Wohnung zu verlassen. Tagsüber auch kaum was gegessen, das Frühstücksmüsli von gestern steht zur Hälfte noch jetzt in der Schale. Statt dessen mehrmals mich wieder hingelegt, stets wieder eingeschafen, tief, bis zum frühen Nachmittag im Morgenmantel gewesen und immer wieder leer in den Bildschirm gestarrt. Dann angefangen zu ordnen, die Musikdateien; dies brächte, dachte ich, vielleicht mich selbst in Ordnung. Funktionierte auch einigermaßen. So daß ich abends — immer noch nichts gegessen, aber Eiweiß in viel heißen Kakao eingerührt und in schluckweiser Permanenz zu mir genommen — immerhin mit der Familie den Weihnachtsbaum kaufen konnte, der nun, in seinem zähen Netz, darauf wartet, daß er am Freitag abgeholt werden wird, um sich über Nacht zu akklimatisieren. Dafür mußte ich den verschobenen Termin abermals verschieben und einen wiederum nächsten vorziehen, der heute anstehen wird.
Wieder in der Arbeitswohnung den kleinen Lobster, den ich im Kühlschrank hatte über zwei Tage auftauen lassen, fünf Minuten in kochendes Wasser gegeben und tatsächlich verspeist. Dazu Babyspinat in Olivenöl mit feingehacktem Knoblauch, auf den dazu eigentlich gehörenden Wein aber verzichtet. Wieso ich mit heute frühmorgens 70,4 kg mein Gewicht gehalten habe, ist mir schleierhaft.
Es geht immer noch alles nur sehr langsam. Triest vibriert mir leise, aber nur wie flirrend, im Kopf, ebenso ein Gedicht, das ich vorhabe, aus → De Aeqypto sozusagen abzuziehen: als, wenn Sie so wollen, „Variation“. Und, siehe oben, „Schmerzensmusik“ sowie eine Idee, die am Sonntagabend, als ich noch klar gewesen, fast schon real geworden war; sie hatte mich sofort gefesselt. Ob aus ihr, wie vorgesehen, noch etwas wird, steht nicht mal in den Sternen; umsetzen werde ich sie trotzdem. Es gibt ja im Zweifelsfall immer Die Dschungel. Medusa und Perseus, eine andere Geschichte: in der Reflektion, die der Spiegel wirft, die „wahre Medusa“ erkennen, ihre Schönheit erkennen. Dazu aber erst einmal wieder Ovid[1]Metam. IV,793 ff lesen:
„Weil“, antwortet der Gast, „du erfragst, was wert der Erzählung,
Höre den Grund des, was du erfragst. Obsiegend in Schönheit
War der beneidete Wunsch zahlreicher Bewerber Medusa;
Aber es fiel kein Teil an der ganzen Gestalt in das Auge
Mehr, als das Haar. So hört‘ ich von manchen, die selbst es gesehen.
Diese entehrt der Fürst des Meers, wie es heißt, in Minervas Tempel.
Von hinnen gewandt hielt Iupiters Tochter die Aigis
Vor ihr keusches Gesicht, und damit nicht fehlte die Strafe,
Ließ sie der Gorgo Haar sich wandeln in scheußliche Hydern.“
Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen! Zur Strafe dafür, daß Poseidon sie vergewaltigt hat, wird Medusa, also das Opfer, mit der Verwandlung in ein Ungeheuer bestraft, nämlich von Minerva (Athene), in deren Tempel dieser Mißbrauch sttatfand. Genau deshalb wäre hier eine poetische Mythenkorrektur dringend  nötig, etwa die mögliche meine: Was Perseus im Spiegel (reflektierend!) erblickt, ist die eigentliche Medusa in der ihr fortgenommenen Schönheit. Unter dem Bösen liegt Leid;
nötig, etwa die mögliche meine: Was Perseus im Spiegel (reflektierend!) erblickt, ist die eigentliche Medusa in der ihr fortgenommenen Schönheit. Unter dem Bösen liegt Leid; 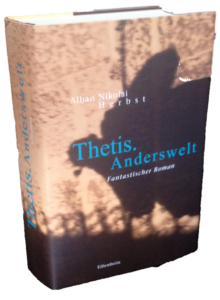 ich hatte diesen Gedanken schon öfter und habe ihn oft schon gestaltet (am deutlichsten wohl mit der „Lamia“ Niam Goldenhaar aus → Thetis). Hesiod n e n n t sie sogar, Medusa also, „leidgeprüft“.[2]Hesiod, → Theogonie, 276
ich hatte diesen Gedanken schon öfter und habe ihn oft schon gestaltet (am deutlichsten wohl mit der „Lamia“ Niam Goldenhaar aus → Thetis). Hesiod n e n n t sie sogar, Medusa also, „leidgeprüft“.[2]Hesiod, → Theogonie, 276
Etwas davon soll auch das Tattoo vermitteln, um dessen nächste  Erweiterung ich um zwölf wieder unter Elenas Nadel(n) liegen werde, eine diesmal wahrscheinlich längere „Sitzung“. Ich habe viel schon vorgezeichnet.
Erweiterung ich um zwölf wieder unter Elenas Nadel(n) liegen werde, eine diesmal wahrscheinlich längere „Sitzung“. Ich habe viel schon vorgezeichnet.
ANH, 10.28 Uhr
Ach, so schön es auch ist, dieses Bild, es täuscht —  so gern ich’s auch betrachte:
so gern ich’s auch betrachte:
[France musique contemporaine
William Schuman, To thee old causes]
References
| ↑1 | Metam. IV,793 ff |
|---|---|
| ↑2 | Hesiod, → Theogonie, 276 |


Das unbekleidete Selbstportrait Dürers hat mich im Sommer auch sehr beeindruckt. Nicht nur, weil es für seine Zeit revolutionär war, dass sich der Maler selbst zum Gegenstand eines Bildes macht, noch dazu nackt, sondern auch wegen dieser direkten Verknüpfung zur Gegenwart, die so stark empfindbar wird. Dieses arglos neugierige Selbststudium, sich tief erforschen wollen… das ganze Dürer-Universum hat mir Nürnberg auf eine ganz neuartige Weise nah gebracht, obgleich er ja immer da war. Er war visionär.
P.S. eine arte-Dokumentation über Dürers Selbstportraits.