(…)
und was wir selber als Verlust erfuhren,
das ist vielleicht im Grunde der Gewinn.
Armin Rüeger → nach Balzac
[Arbeitswohnung, 12.05 Uhr
Othmar Schoeck, → Massimila Doni (Vinyl)]
Auffällig, wie schwer es mir fällt, wieder meine Arbeitsjournale zu schreiben, seit ich sie nun schon seit knapp zwei Jahren quasi eingestellt habe – aus Gründen, die nicht öffentlich sein durften, was eben genau zur Einstellung geführt hat. Jetzt indes, da die Probleme weitgehend gelöst, jedenfalls nicht mehr bedrohlich sind, für niemanden … – jetzt indes, da ich von der, wie es heißt, „Leber frei weg“ schreiben könnte, spüre ich zwar dann und wann einen starken Impuls. Aber setze ich mich dann wirklich an den Laptop, erlischt er geradezu unmittelbar; sogar leichten Ekel verspüre ich zuweilen (oder glaube, ihn zu verspüren). Dabei sind diese Journale über fast zwei Jahrzehnte das Herzstück Der Dschungel gewesen oder wurden als so etwas wahrgenommen; die Zugriffszahlen belegten es.
Weshalb also mein ständiges stets wieder Zurückweichen vor den eigenen Impulsen? Haben sich Zweifel an meinem eigenen poetischen Ansatz in mich eingeschnitten? Nein, an ihm eher nicht. Aber ich fühle einen Riß, eine Verletzung, die mich zwar nach wie vor für richtig halten läßt, was ich ästhetisch denke, aber ich habe den Wind nicht mehr in den Segeln, er bläht die Seegel, von „Seele“, nicht mehr), so treib ich in der Flaute. Nicht nur mit Der Dschungel ist es so, auch sonst habe ich den ganzen letzten Monat über kaum was zu Datei gebracht, um von „Papier“ zu schweigen. Bei Der Dschungel merkt man’s nur gleich. „Was willst du?“ rufen die Freunde aus. „Du hast doch wirklich genug geschafft, da ist so eine Pause doch normal.“ – Ist es vielleicht auch, nur war ich nie „normal“ und kann nicht glauben, daß ich’s plötzlich wurde. Da ist etwas anderes, das mich hindert. Was übrigens kein Problem wäre, stünde ich mit „Briefe nach Triest“ jetzt wirklich in der Diskussion. Tu ich aber nicht. Darüber können auch die beiden großen Rezensionen nicht hinwegtäuschen, die dem Buch unterdessen zuteil geworden sind. Der Markt funktioniert anders, Besprechungen müssen geballt erscheinen, zeitlich möglichst eng aneinander, sonst zerstreut sich ihre Wirkung; imgrunde gilt Marxens Kapital, Bd. 1.
Dennoch, natürlich bin ich froh.
Aber da ist dieser Riß. Gestern, nach einer zudem reichlich volltrunknen Nacht, zog er mich so runter, daß ich eine Silvestereinladung absagte; schon die Vorstellung, gleich mit einigen Leuten zusammenzusitzen, fand ich – vorausfühlend – quälend. Auch sowas ist für mich neu, daß ich nicht sprechen, einfach nur für mich sein will. Was dann auch ganz gut war
[Hier stockte schon wieder mein Text; ihn erneut aufzunehmen, fand ich erst heute zwar weniger die Energie als immerhin den  Willen (nebenbei wird einmal wieder ein Brotteig angesetzt] :
Willen (nebenbei wird einmal wieder ein Brotteig angesetzt] :
[3. Januar, 14.20 Uhr
Per Nørgård, Sinfonie Nr. 2 (1070)]
Wiederum „Sei nicht so streng mit Dir“ sprach mir im WatsappCall Benjamin Stein gestern zu. „Bin ich nicht“, gab ich zur Antwort, „ich weiß ohne Projekte nur nicht, wohin mit mir.“ Dabei habe ich eines, es drängt sogar ein wenig. Das PrenzlauerBerg-Buch nämlich. Doch komm ich mir grad wie ein Pianist mit klebrigen Fingerspitzen vor. Es ist auch eine Art Erschöpfung, doch der Hoffnung. Nicht dramatisch, nein. Aber auch das ist ein Problem. Aus Dramatik, „Drama-Queenismus“, habe ich bislang noch immer poetische Funken schlagen können; pragmatisch zu gucken wie jetzt, erstickt das leider im Keim. Alles nur mein Eindruck. Vielleicht auch bloß vorübergehend. (Merken Sie, Freundin, wie parataktisch plötzlich mein Stil wird? Alarm! (Was „all’arma!“, „Zu den Waffen“!“ bedeutet (!!)) Bloß war es in den letzten Jahren immer gleich: Ein neues Buch erschien, ich machte mir Hoffnung, nichts geschah. Sie nun geschieht nun auch nicht mehr. „Du hast einfach keine Leser,“ sagte mir vor Jahren der Chef von dtv. „Was soll ich tun? Ich muß den ‚Wolpertinger‘ auslaufen lassen, auch wenn ich es höchst ungern tue. Und deine andren Taschenbücher auch.“
Er hatte schon recht, zu einer Leserschaft, die sich so nennen läßt, bin ich niemals vorgedrungen. Ich glaube nicht, daß es an der Komplexität meiner Bücher liegt; Proust wird ja dennoch gekauft, Musil wird’s, Jirgl wird’s, Pynchon, allerdings bei Döblin bin ich mir nicht sicher, auf den ich mich aber immer wieder beziehe, den, neben Musil, für mich wichtigsten deutschsprachigen Romandichter. Von ihm, Döblin, habe ich die Rhythmen, natürlich abgesehen von der Musik – die aber eben auch eine ist, die ich mit dem Gros weder meiner Generation noch irgendeiner der gefolgten teile. Hier dürfte der eigentliche Grund liegen, darinnen kaum verborgen, daß schon, als ich noch Jugendlicher war, die Sprache unserer Seelen, also Musik, jene meiner Altersgenossinnen und -genossen und meine, fast nichts miteinander zu tun hatten; sogar sich zu verständigen, war schwer. (Im Schwulenmilieu wär es etwas anderes gewesen, nur war ich halt entschieden hetero und bin es heute geblieben). Daß ich die Stones heute hören kann, mit Gewinn, Deep Purple usw. (die Beatles aber immer noch nicht, bleibt mir for heaven’s sake vom Leib!), ist eine späte Entwicklung; sie setzte ungefähr mit meinen Vierzig ein,
Nein, es war nicht an dem, daß ich den anderen ‚als Mensch‘ fremd gewesen wäre oder sie wären es mir gewesen. Freunde hatte ich immer, oft über Jahre, nicht wenige seit damals bis heute; fremd war mir nur, was sie hörten, und ihnen, was ich. Überschneidungen gab’s selten, etwa — da sogar bleibend — daß ich von Andreas Werda, einem vertrauten Fotografen, dessen Liebe zu Joni Mitchell ebenso übernahm wie er von mir den Mahler. (Mit Bach tat er sich schon weniger leicht). Unterm Strich aber, wenn mich aus dem Musikbereich, der heute Pop genannt wird, etwas vereinnahmte, dann fast immer nur über die Botschaft (‚message‘), also den Inhalt des vertonten Textes; die Musik selber blieb für mich flach, meist ganz unerträglich. Aus selbem Grund habe ich auch noch nie einer Lightshow etwas abgewinnen können, die populäre Musikdarbietungen heute beinahe ständig begleitet — sie „aufmotzt“, wie ich empfinde: nämlich die Banalität der kompositorishcen Faktur überspielt. Meine Omi: „Das soll sowas sein …“ (Sie aber liebte Schlager, Ronny, Freddy, Bruce Low; nicht zu vergessen Conny Froboess: Pack die Badehose ein, Deutsches Wirtschaftswunder, vier Jahre vor meiner Geburt, grad mal sechs nach Auschwitz).
Ich glaube also nicht, daß es eine wie auch immer geartete „Über“-Komplexität meiner Bücher ist, was die Menschen von ihnen Abstand nehmen bzw. erst gar nicht nach ihnen greifen läßt; ich kann dies Argument eh nicht nachempfinden: Für mich ist „Schwierigkeit“ ein Ansporn (war es jedenfalls). Sondern es ist etwas poetisch-phylogenetisch Fremdes, das die Menschen an meinen Büchern empfinden. Noch in dem bisweilen über mich zu lesenden „großen Außenseiter der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ schwingt davon etwas mit. (Immerhin bin ich so weit gekommen; ich hätt statt dessen längst schon untergehen können. Nur daß unterdessen, ein Außenseiter zu sein, bei der jetzigen jugendlichen Generation kein Wert mehr, sondern Makel ist; das ging freilich schon vor Jahren los. Ich halte es für einen – ihr rundum adäquaten – Ausdruck der Warengesellschaft, der auch an der Möglichkeit des heutige politischen Populismus kräftig mitgestrickt hat und in der Kultur an dem Primat der „Quote“.)
Ich stehe da tatsächlich fremd, die Menschen ermpfinden nichts Falsches. Unsere Unterschiede werden sich erst nach vielen Jahrzehnten nivellieren — so, wie wir es heute hinbekommen, widerspruchsfrei sowohl Puccini als auch Alban Berg zu lieben, Franz Schreker und Luigi Dallapiccola, Aribert Reimann und Brahms; die, selbst untereinander, hätten sich die Augen ausgestochen. Auch die Kombi Richard Wagner/Claude Debussy ist uns unterdessen völlig bequem, Adornos Ablehnung von Sibelius oder gar Benjamin Brittens („Geschmack am Ungeschmack, Simplizität aus Unbildung, Unreife, die sich abgeklärt dünkt, und Mangel an technischer Verfügung“ [1]Th.W.Adorno, Philosophie der Neuen Musik, 1949) ) kommt uns geradezu bizarr vor. Worauf ich hoffe, sofern ich noch hoffe, so darauf, daß solches mit Urteilen wie „utopistisches Tamtam“ [2]siehe → dort oder „Herbst hat noch nie einen einzigen richtigen deutschen Satz geschrieben“ (letzteres soll der für „einfaches Schreiben“ allerdings nicht mehr als ich bekannte Reinhard Jirgl mal gegiftet haben, keine Ahnung, ob es stimmt) … — daß solche „Urteile“ sich quasi von selbst und zwar dann aufheben werden, wenn der Zurückblick die Differenzen aufgrund der historischen Gleichzeitigkeiten minimiert. Kann aber ebenso sein, daß mich die Postmoderne hierin täuscht, die mich ja lange bei Hand nahm. (Und vorhin eine Mail, derzufolge für eine bereits terminierte Lesung nicht mehr wie früher, sondern nur noch 200 € bezahlt werden könne – und das Hotel; ob aber die Fahrtkosten auch, sei noch nicht raus).
 Damit leben. (Aber ich muß wieder zum Teig in die Küche.)
Damit leben. (Aber ich muß wieder zum Teig in die Küche.)
[18.37 Uhr]
Das geht alles in mir um, ich kann ja nichts tun — nichts, außer ein nächstes Buch zu beginnen, das ich ins Leere schreiben werde … ins Fastleere, na gut, es gibt ja paar Leute, die meine Dichtungen dennoch lesen. Nur b i n ich nicht, kann mich nicht bescheiden. Es gibt Namen, die sind in aller Munde, vom meinen kosten sie nicht mal, kriegen ihn auch kaum serviert. Durchstreifen Sie, Freundin, die Buchhandlungen, um zu 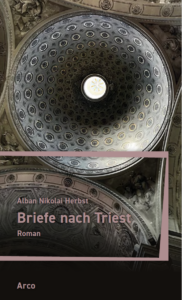 schauen, wo die Triestbriefe liegen. Egal, wo. Und Sie werden verstehen, welch ein Segen Amazon für mich ist … ein solcher fast, wie es für Jelinek die Frauengruppen an den Universitäten waren (vor ihrem Nobelpreis, versteht sich) und für Egger die so engst, daß sich von „familiär“ sprechen läßt, aneinandergerückten Wände des zeitgenössischen Lyrikbetriebs. Kein Wunder, daß alliterativ mir Ecker einfällt, Christopher Ecker, dem es nicht anders geht als mir.
schauen, wo die Triestbriefe liegen. Egal, wo. Und Sie werden verstehen, welch ein Segen Amazon für mich ist … ein solcher fast, wie es für Jelinek die Frauengruppen an den Universitäten waren (vor ihrem Nobelpreis, versteht sich) und für Egger die so engst, daß sich von „familiär“ sprechen läßt, aneinandergerückten Wände des zeitgenössischen Lyrikbetriebs. Kein Wunder, daß alliterativ mir Ecker einfällt, Christopher Ecker, dem es nicht anders geht als mir.
Wieso ich, Freundin, derart verzweifelt sei? — Das bin ich nicht, bin nur etwas müde. (Die Neuropathie in den Füßen nervt; um nicht höher dosieren zu müssen, habe ich das Pregabalin besser erstmal abgesetzt. Nicht wegen der objektiven Suchtgefahr, sondern weil die Medikation eine Höchstgrenze kennt und ich rechnen kann. Also halte ich das im Wortsinn Generve erstmal wieder aus und greife zu dem Teufelszeug nicht, bevor es sich neuerlich nicht mehr umgehen läßt, weil ich zum Beispiel anders keinen Schlaf mehr finde. Der Körper, das ist vor allem mein Gehirn, soll sich erstmal wieder entwöhnen. (Freilich könnte dies auch ein Stellvertreterkampf sein, psychodynamisch. Weil ich gegen den Literaturbetrieb nicht ankomme, jedes sichErheben sinnlos wäre, verschiebe ich’s auf etwas, das ich tatsächlich in die Schranken weisen kann: allein qua Wille.)
Großartiger → Aufsatz von Konrad Paul Liessmann; indirekt zeigt er auf, was das Problem ist. (Wenn Sie den Artikel in einem privaten Fenster bzw. per VPN öffnen, können Sie die Bezahlschranke umgehen.)
Ihr ANH

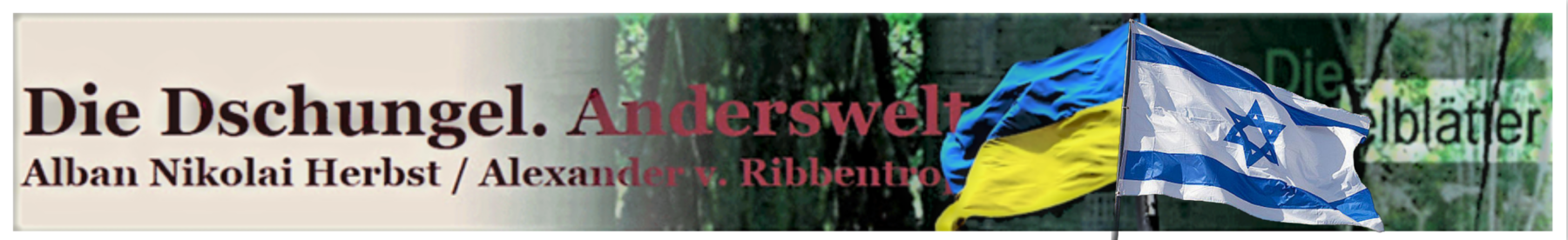


..vielleicht nicht ganz eine Aufmunterung, aber mir fiel im Lesen eben die Bemerkung eines Konzeptkunstkollegen anno frühe 90er ein, als aus Produzentïnnensicht gilt: „Außer den Beteiligten gibt es kein Publikum.“ 🙂 Inzwischen gibt es rasend viel Publikum in der Kunst, und irrwitzige Durchlaufgeschwindigkeiten (eigentlich fast eine Kluge-Situation – „Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“).
– Präsenz für den Moment heisst eigentlich nicht mehr viel, nur eben für den Moment.. :/ Insofern würde ich mich ja immer freuen, wenn meine Arbeit eben für von mir geschätzte jüngere Produzierende hie und da Inspiration ist, oder Herausforderung, Nahrungsmittel (Protopkin: „Die Eroberung des Brotes“:), uva. 🙂
Adressatïnnen des Schreibens sind ja zuallererst, sofern nicht Auftragsarbeit, immer imaginierte, darin sozusagen innere Objekte spiegelnd – und ja, wenn sich da Brüche eintragen, Verschiebungen, wie sie die überladene und zugleich auch überdrehende Litbetriebswelt mit sich bringen, dann wäre es seltsam, einfach so weitertun zu können, wie immer schon gekonnt.. 🙂 Die Unbehaglichkeit des Arbeitsprozesses wäre so gesehen auf jeden Fall ein guter (Jahres;)Anfang. 🙂 – Alles Beste für 2025!
Ich habe Ihren Jahresauftakt mit Bewegung und mit belegter Stimme und mit einer gewissen Melancholie und Rührung gelesen. Eben wegen solcher Texte lohnt sich immer wieder der Besuch im Dschungel – auch wenn wir in einigen Dingen nicht immer einer Meinung sind und uns hart auch mit Worten angehen können. Es ist dies ein sehr treffendes Arbeitsjournal mit einer klugen Analyse – auch und gerade, was den Literaturbetrieb betrifft.
Ja, einerseits ist es ein Glück, daß Sie nur sehr bedingt zu diesem Betrieb mit seinen Vernetzungen, seinen Intrigen et al. gehören. Andererseits hat das leider aber auch ökonomische Auswirkungen. Und das sieht man bereits, wie Sie ganz richtig schreiben, wo ihre Triestbriefe in den Buchhandlungen liegen – was ich beschämend finde. (Werde die Tage mal einen Spaziergang von meiner Wohnung aus nach Dahlem machen, zur wunderbaren Buchhandlung Schleichers, um zu schauen.)
Was Sie zu ihrer Literatur schreiben, trifft sicherlich zu: Auch ich denke, daß Sie ein Außenseiter sind (was ich als Kompliment meine, auch wenn es ökonomisch keines ist) – und was man für die Literatur wohl auch, gerade in der heutigen Zeit, im Sinne ästhetischer Theorie als ein Lob auffassen muß, so wie eben Hans Henny Jahns „Fluß ohne Ufer“ immer noch als der avancierte Außenseiterroman der alten BRD gehandelt wird.
Die „Lesbarkeit“ eines Buches ist in der Tat ganz gewiß kein ästhetisches Kriterium, das etwas über die Qualität eines Buches sagt. Und so wie ihnen ergeht es vermutlich auch Clemens Meyers „Die Projektoren“, nur daß die Verkaufszahlen höher liegen als bei ihrem neuen Triestbuch – was bei mir bereits auf der Leseliste steht. Aber ich denke nicht, daß es allein die Schwierigkeit eines Textes allein ist. Ihr wunderbares „Traumschiff“ ist ja nun ganz und gar nicht „schwierig“ und doch ist es auf beste Weise poetisch, im Sinne einer wunderbaren Phantasie als eine letzte Reise, darin sich Anspielungen auf die literarische Romantik finden, mithin eine Literatur, die eine hohe Form von Reflexivität aufs eigene Medium aufweist, ohne diese ostentativ auszustellen. Es wird erzählt. Übrigens nicht anders als in „Meere“. Aber wie das so ist: Hat man erst einmal den Ruf als schwieriger Autor im mehrfachen Sinne: Ein Autor, der sich in Debatten einmischt und ungerechtfertigte Literaturkritik nicht einfach so im Raume stehen läßt und zugleich eben seine Dichtung nicht am Common Sense orientiert, sondern seine Dichtung nach der Sache richtet, und wohin es also die Sprache dann drängt und wohin sie gebracht werden muß, das eben, was wir Formbewußtsein nennen, das vor einem kruden Inhaltismus steht, der zumeist dann auch noch das bedient, was gerade politisch gefällig ist: hat man also erst einmal diese Ruf, dann werden auch solche Romane wie „Traumschiff“ nicht angemessen wahrgenommen. Daß es damals nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, habe ich als Skandal empfunden. Aber es ist eben ein Skandal, aus dem der übliche Betrieb dann halt keinen Skandal macht. (Alles doch sehr selektiv: Was wäre weltweit los, wenn in Rotherham ein ganzes Wohnviertel mit rechtsradikalen Einwohnern 16 Jahre lang über 1400 migrantische Mädchen und Frauen sexuell mißbraucht hätte?)
****
Was die Musik betrifft, würde mich interessieren, was Sie von der Musik der Band TOOL halten. Es ist irgendwie Pop, eine Mischung aus Progressiv Rock und Heavy Metal und irgendwie kommt man bei der Komplexität dieser Musik mit solchen Kategorien doch durcheinander.
Danke auch für den Liessmann-Text – einer jener Autoren und Philosophen, die ich immer wieder gerne lese, weil sie sagen, wie es ist.
Lieber Bersarin,
bitte verzeihen Sie, daß ich Ihren Kommentar erst fast einen Monat später lese – über die Gründe habe ich heute → dort geschrieben. Umso mehr bedanke ich mich für Ihren Zuspruch. Und ja, bisweilen liegen wir in den Meinungen auseinander, politischen Meinungen, weil wir die Belange verschieden einschätzen. Doch ist das nicht, nun jà, »normal«? Wäre dem anders, es wäre verdächtig. In romanische Ländern schätze ich die Fähigkeit sehr, und die Freude daran, nachdem man auf mitunter heftigste Weise miteinander gestritten, danach dennoch oft Arm in Arm eben noch schnell ein Glas Wein zu trinken. Verschiedene Meinungen machen nicht gleich Feinde, sondern können ganz im Gegenteil Freundschaft begründen, und es geschah nicht selten, daß selbst in Kriegen die gegnerischen Feldherrn voreinander mehr Achtung hatten als vor einigen ihrer eigenen Leute. Es sieht so aus, als wäre diese Begabung derzeit eingemagert.
Was hat Ihr Besuch bei Schleichers ergeben? (Eine Freundin wollte die Triestbriefe in der → Autorenbuchhandlung bestellen, was auch gegangen wäre, »aber es dauert zwei Wochen«. »Wieso denn das?« »Wir arbeiten nicht mit diesem Vertrieb, nehmen dessen Bücher nicht in den Laden.« Tja.) Und ist Ihr geliebter Fluß ohne Ufer dort etwas schneller lieferbar? Alles das sind so Fragen. (Ich würde sie für Döblins Wallenstein stellen. Meyers „Die Projektoren“ kenne ich noch nicht, bin aber nun doppelt aufmerksam geworden. Und was mein »wunderbares ›Traumschiff‹« angeht, nun jà, ist nicht einmal die erste Auflage des Buches auch nur näherungsweise verkauft. Immerhin, es ist noch lieferbar, dafür bin ich dankbar (ist nämlich auch nicht mehr selbstverständlich). Und Meere wird nach wie vor dazu benutzt, mich zu diffamieren oder mir zumindest Förderungen vorzuenthalten; »Herbst schlägt Frauen« usw. Dabei ist es der Roman über die Emanzipation einer Frau.
Mit dem Ruf des »schwierigen Autors« haben Sie mit genau den von Ihnen gelisteten Gründen rundweg recht. Es kommt aber noch etwas weiteres hinzu, nämlich daß, selbst wenn unterdessen das Internet auch für die Literatur völlig selbstverständlich wurde, falls Sie zu Zeiten, wo es noch nicht soweit war, für es eingetreten und dafür gerügt worden sind (»Herbst zerstört die deutsche Literatur«, war in der NZZ zu lesen) – … daß dieserart Rügen an einem kleben bleiben. Daß jemand mit dergleichen Pionier gewesen ist: diese Relativierung nimmt später niemand mehr vor, jedenfalls kein Feuilleton; in den Literaturwissenschaften ist es anders, doch welchen Journalisten, welche Journalistin interessieren die? Viel zu viel Arbeit allein, es zu Kenntnis zu nehmen. Und stimmt ja, die Zeilenhonorare rechtfertigen solch ein Interesse nicht. Zumal das Buch von gestern von gestern eben ist, von einem von vorgestern, vorvorgestern ganz zu schweigen – vorgestrig, was gestern war.
Es geht ja schon damit los, daß unter »Gegenwartsliteratur« auch von den Literaten selbst, und den Literatinnen, etwas verstanden wird, das die Gegenwart direkt zum Thema hat, und zwar sofort erkennbar. Sie dürfen also nicht mehr, um als gegenwärtig zu gelten, eine Gegenwarts-, sagen wir, -analyse in anderer Gestalt als immer direkt ihrer selbst publizieren, erst recht nicht, nach wie vor, als zum Beispiel (egal, ob vermeintlich) »Science Fiction«. Nach diesem Verständnis sind die großen Widerstandsromane des Ostblocks alle Ramsch. Und Skandale? Wenn sie einer wirklich sind, werden sie verschwiegen. Skandalöse Texte sind nicht erwünscht, sondern Konsens; es soll doch niemand traumatisiert werden, oder? Und heutzutage werden wir alle geradezu unmittelbar in Traumata gestürzt, die nie, nie wieder heilen. Es reicht ja schon, einem Mädel hinterherzupfeifen. Davon erholt es sich einfach nicht mehr, sondern bleibt fürs ganze weitere Leben geschädigt. Sie müssen jetzt nur noch mal hüsteln, die Putins dieser Welt, schon haben sie gesiegt. Die Mullahs sehn das ähnlich. Deshalb versteht man einander so gut.
Vorgestern abend → im Tatort: »Warum sollen wir keine Wildschweine schießen? Die fressen uns ja auch.« Das steht da ziemlich mutig in Gardes und von Rönnes Drehbuch; daß es sogar gesprochen wird, läßt sich an Wagemut heutzutage & -zulande kaum mehr überbieten.
Ihr ANH
P.S.:
TOOL kenne ich nicht, doch werde mir Kenntnis verschaffen.