[Arbeitswohnung, 11.05 Uhr]
Erst, vorgestern, ein grandioser Abend bei Krøhan Bress, acht Herren, die sich gelegentlich zum Austausch treffen, oft ist eine Künstlerin, ist ein Künstler dabei, ich selbst war’s nun schon mehrfach auf Dr. Nos Initiative. – Ob ich etwas vortragen möge? Mir sei freigestellt, was.
Doch nahm der tropisch warme Abend, noch bevor wir zu den Zigarren griffen, eine hinreißende Wendung, weil nämlich Ulrich Paulig erzählte, und zwar derart farbig und solch in märchenhaftem Sinn Wunderbares, daß ich an seinen Lippen geradezu klebte. Nahezu jedes seiner Motive ergäbe eine Phantastische Erzählung – ja, „phantastisch“ großgeschrieben als nämlich literarische Kategorie. Da paßte dann später, sehr spät erst las ich, „Der Gräfenberg-Club“ präzis. Was Herr Paulig erzählte, möchte ich hier nicht wiedergeben, weil es eben seine Erzählungen sind, wenngleich ich sie gerne notierte und in meine Formen umwandeln würde. Vielleicht wird dies noch geschehen, wir werden uns ganz sicher wiedertreffen. Nur aber so viel d o c h, daß er, der unikate Spielplätze erfindet und auch baut, die Beschaffenheit eines Bodens durch seine Fußsohlen erspürt. Was, wie Sie, liebste Freundin, auf der Website seines Unternehmens sehen können, zu konkreten Ergebnissen führt. Und er sprach von Heilwäldern, für die es zwar ein Amt gibt, nicht aber Kenntnis, was sie denn seien, jedenfalls keine, die sich konzis definieren ließe.
Es lag nahe, daß meinerseits ich erzählte, keine Geschichte schreiben zu können, ohne den Ort wirklich zu kennen, an dem sie spielt – und zwar gleichgültig, ob es sich meinerseits um eine schließlich Phantastische Literatur handelt. (Manchmal bin ich zu denken geneigt, überhaupt nur diese für eine wahrhaft Realistische zu halten). Jedenfalls tat sich unserer Herrenrunde aus, abgesehen von mir, durchweg Unternehmern eine Welt auf, die keiner von uns so erwartet hätte. Da ward es denn auch später „als erlaubt“; normalerweise schließt das Whisky & Cigar – Contor um 22 Uhr. Es war fast elf, als wir uns trennten.
Übrigens wurde auch d o r t dann über mein Friedrich-II-Projekt gesprochen (na jà, noch ist es wohl eher poetisches Träumen), das mich neuerdings wieder beschäftigt. Nämlich hat mir Cristoforo Arco einen Band „auf Dauer  geliehen“, der, von Klaus J. Heinisch ins Deutsche übersetzt, den Briefverkehr des Staufers und u m ihn versammelt – eine hinreißende Lektüre! — „Auch“ wiederum, weil meine Romanidee erneut gestern abend zum Thema wurde, als sich Uwe Schütte, Jost Aikmaier und ich vorm AloisS zum Essen trafen, sowie zu Augustiner und Wein. Auch da ging es lange, und ich hatte, als wir aufbrachen, eine derartige Schlagseite, daß ich heute früh nicht joggen konnte, und mittags, ja selbst noch am Abend werde ich es der Hitze wegen nicht können, bzw. sollte ich’s klugerweise auch nicht.
geliehen“, der, von Klaus J. Heinisch ins Deutsche übersetzt, den Briefverkehr des Staufers und u m ihn versammelt – eine hinreißende Lektüre! — „Auch“ wiederum, weil meine Romanidee erneut gestern abend zum Thema wurde, als sich Uwe Schütte, Jost Aikmaier und ich vorm AloisS zum Essen trafen, sowie zu Augustiner und Wein. Auch da ging es lange, und ich hatte, als wir aufbrachen, eine derartige Schlagseite, daß ich heute früh nicht joggen konnte, und mittags, ja selbst noch am Abend werde ich es der Hitze wegen nicht können, bzw. sollte ich’s klugerweise auch nicht.
Die Idee, der Romanansatz aber steht mir vor Augen wie seit langem nicht mehr. Nur daß ich überhaupt nicht weiß, wie sich das Unternehmen wird finanzieren lassen. Dennoch fängt es an zu drängen. Nichts wäre – von erfüllter Geschlechtsliebe abgesehen – schöner, als brächte ich vor meinem Tod noch diese europäische Utopie zu Buch. Wobei ich, um nicht in eine neuerliche, sagen wir, Idealisierung einer Führerfigur zu geraten, Friedrichs Gotteskaisergnadentum, also das mittelalterliche Sendungsbewußtsein dieses „Schreckens und Staunens der Welt“, mit demokratischen Überzeugungen und Rechtsnormen irgendwie verbinden können muß, und will. Hingegen der Toleranzgedanke in Friedrich längst angelegt, wenn auch nicht gedacht, bzw. so geformt ist, daß sich daraus ein politisch modernes Gesellschaftsverständnis ergibt. Ich erinnere an die in Horst Sterns auch poetisch grandiosem Roman erzählte Episode, in der Friedrich einen Falken tötet, weil 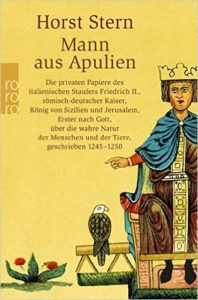 dieser einen Adler gerissen hat – für mittelalterliches Rechtsempfinden ein nicht tragbarer Übergriff. Andererseits, wie nah dieser Friedrich mir ist, zeigt das folgende Zitat aus Sterns Roman:
dieser einen Adler gerissen hat – für mittelalterliches Rechtsempfinden ein nicht tragbarer Übergriff. Andererseits, wie nah dieser Friedrich mir ist, zeigt das folgende Zitat aus Sterns Roman:
Erst die männliche Wollust des sprachlichen Nachschaffens körperlicher Ekstasen hebt die Leiber vom schweißnassen Laken und macht aus einer bloßen Bettgenossin eine Bewegerin des Geistes. (…) Zwar ist es leicht, Maul und Penis damit zum Speicheln zu bringen, aber schwer, damit die Seele zu rühren.
S.76
Dies steht bei Stern unmittelbar, bevor er Friedrich eine nahezu expressionistische Prosa an seine geliebte Bianca Lancia schreiben läßt:
Der schreilösende Stoß in die Mitte flehend aufgehobener Schenkel und der Rückzug gegen den Willen sich saugend anschmiegender Lippen. Das Kalkül der Lustbereitung im Ungewissen von Frequenz und Tiefe des Eindringens. Das rasende Verlangen nach Füllung. Der schmerzhafte Drang nach Entleerung. Der stumm schreiende Mund. Das peitschende Haar. Die flatternden Lider. Die fleckige Rötung von Schultern und Hals, Hände um Brüste. Die Gier nach Bedeckung der eigenen mit des anderen Haut. Der Sturz in Arme. Das Erschrecken der Kerzen. Das Klirren von Glas.
S.76
Achten Sie, Freundin, hier auf den Übergang von lebender zu unbelebter Materie, die das Leben indes reflektiert. — Es waren solche Sentenzen, die mich, nachdem ich schon lange mit der Idee meines eigenen Friedrichromans umgegangen war, von ihm dann schließlich Abstand nehmen ließ. Ich wäre mir anders blasphemisch vorgekommen.
Dies hat sich aber nun verändert, seit ich einen tatsächlich-eigenen Ansatz fand,
FRIEDRICH.ANDERSWELT,
um es kurz zu fassen.
Nur, ich schrieb es eben schon: Selbst wenn ich mich durchringen könnte, die Arbeit anzugehen, wüßte … nein, weiß ich nicht, wie ich die lange Zeit finanzieren kann, die sie bedeuten würde. Unter zehn, wenn nicht fünfzehn Jahren würde ich kaum fertig werden – dann wäre ich knapp achtzig. Dieser Roman wäre nicht nur ein komplett ungedeckter Scheck auf die Zukunft, sondern geradezu etwas, das sie bewußt ignoriert. Bezöge ich aus meinen bisherigen Büchern nennenswerte Einkünfte, wäre es etwas anderes; aber auch, würde mein Werk nicht öffentlich so ignoriert, wie es der Fall ist. Also werde ich eben auch nicht mit Fördergeldern rechnen können, seien es Literaturpreise, seien es Projektmittel. Die einzige Sicherheit wäre eine Mäzenin oder ein Mäzen, meinethalben auch mehrere Personen dieses kunsterfüllten Schlages. Doch wer stellt sich einem Unhold zur Seite oder gar, baut ihm das Floß, auf dem er übersetzen kann? — Auch das kam an den vorm AloisS auf der Straße aufgebauten Tischen zur Sprache; die andern interessierten es wenig. „Sei doch ehrlich, du mußt das Ding schreiben, weißt es selbst am besten.“ Was sollte ich tun, außer zu lächeln, drittels geschmeichelt, doch zweidrittel skeptisch.
Allerdings lag es weiter plaudernd nahe, sozusagen plaudernah, abermals aufs „Gendern“ zu kommen und uns bewußt zu machen, daß es dabei weder um Wahrheit noch gar Gerechtigkeit der Geschlechter geht, sondern schlichtweg um Macht. Es ist ein diktatorisches Meinungsinstrument, das auch, siehe #metoo, nicht vor der Zerstörung des Rechtsstaats zurückschreckt. Zu denunzieren reicht völlig, um jemanden Unliebsamen eines Amtes entheben zu lassen; ein juristisches Verfahren ist nicht mehr nötig. Es reicht auch, um z.B. Literaturpreise nicht mehr an Unliebsame vergeben zu lassen, einerlei, ob deren Dichtung Dichtung wirklich ist. Es zählt fast nur noch Gesinnung. Sie braucht nur die nötige „Quote“, unter die sich dann jeder beugt, „jeder“ bewußt mit „r“ geschrieben von mir. „Die“ Männer s o l l e n Angst haben und haben sie denn auch, etwa um ihr Fortkommen, ihre Karriere usw. Also schweigen sie oder machen gar mit, knien vor jedem neuen Tabu, das nicht einmal „die“ Frauen aufgestellt, sondern bestimmte, numerisch sogar kaum signifikante Gruppen von Frauen mit so definiertem wie rücksichtslosem Machtinteresse. Wie im >>>> Fall Flaßpähler scheut sich frau da auch nicht, die eigenen Geschlechtsgenossinnen an den Pranger zu stellen, wenn sie sich gegen dieses Machtkalkül wenden.
Dabei löst die „Genderei“ jegliches historische Bewußtsein aus den Angeln und schleift es hernach bis auf die Grundmauern nieder, Hand in Abrißbirne mit der „Correctness“. Etwa der Fall Kleist. Ein Dozent nimmt mit seinen Studentinnen und Studenten „Die Verlobung in St. Domingo“ durch, jedenfalls hat er es vor – nur daß die Novelle gleich im ersten Satz von einem N e g e r spricht. Das bewirkte in den Zuhörendinnen (Zuhörenden und Zuhörendinnen) nahezu sofortigen Aufruhr: Der Begriff müsse gestrichen und durch einen anderen, politisch correcten ersetzt werden. Wann die Novelle geschrieben wurde, spielt gar keine Rolle, alles, alles | ist immer Jetzt.
Daß unter solchen Auspizien gerade meine Literatur für unerträglich und abzuschaffen gilt, muß, so betrachtet, niemanden mehr wundern – allenfalls die wenigen „Elitären“, denen es auf Formung und poetische Bewegung weiterhin ankommt. Haben sie das Pech, Männer zu sein, werden ihre Argumente eh als pro domo abgetan; sind es Frauen, wird ihnen libidinöse Bindung an mich unterstellt oder gar Schulterschluß mit „den Unterdrückern“ (das Wort „Unterdrückerinnen“ kommt interessanterweise ebenso wenig vor, wie daß verlangt wird, correct von „Mörderinnen und Mördern“ zu sprechen oder gar von „MörderInnen“). — Du mußt nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie.
Nur wenige noch trauen sich, Einspruch zu erheben. Die unter ihnen, die selbst keine Macht haben, etwa populäre oder institutionelle, gehen dabei unter, egal, wie gut oder schlecht ihre Argumente sind. In der Meinungsdiktatur spielen sachliche Argumente überhaupt keine Rolle, ja sind sogar hinderlich. Es handelt sich um Konsensdiktatur, ohne daß sie aber tatsächlich auf Übereinstimmung fußte. Dieses, schulterschlüssig mit der „Quote“, ist das Instrument der Lenkung in der heutigen Massengesellschaft und zugleich ein Garant für Konsum.
Es haben uns, wohlgemerkt, nicht die Rechten dieses eingebrockt, die dennoch mit ganz denselben Mitteln operieren. Imgrunde sind Phänomene wie die AfD, Le Pen in Frankreich, insgesamt Europas „neues“ nationalistisches bis sogar rassistisches „Denken“ ein S p i e g e l der sich selbst suggestiv-verdinglichten Linken.
Tatsächlich brandet ein Glaubenskrieg, hinter dem konkrete Machtinteressen stehen, wie sie hinter jedem vorherigen standen. Die Abwehr des Islams ist nur ein Symptom, das den eigentlichen verdeckt und verdecken auch soll, nämlich den um die Meinungsherrschaft innerhalb der westlichen Welt. Die grauenvolle Bilderstürmerei des sogenannten IS findet als „Correctness“ in Wahrheit innerhalb der eigenen Kultur und Kunstgeschichte statt – dort, wo sie am empfindlichsten zu treffen ist: in der Sprache. Dafür ist Herrn Manfred Roths „Kritik“ an meinen „Wanderern“ ein zwar nettes, aber nicht einmal Detailchen, sondern – allenfalls – ein „schmückendes“ Indiz.
Aber, liebste Freundin, w i r lassen uns n i c h t beugen:
ANH
______________________
>>>> FA.E1
