Vor einigen Wochen war ich zu einer Veranstaltung in M* und traf dort zufällig eine Bibliothekarin der Stadtbibliothek N*. Meinen Hinweis, dass sich kein Buch von Ihnen in der Bibliothek befinde, konterte sie mit dem Kommentar : „Herbst – der ist doch viel zu literarisch! den liest doch keiner..!“
Auf meinen Einwand, dass nichts gelesen werden könne, was nicht vorhanden ist, blieb sie mir die Antwort schuldig.
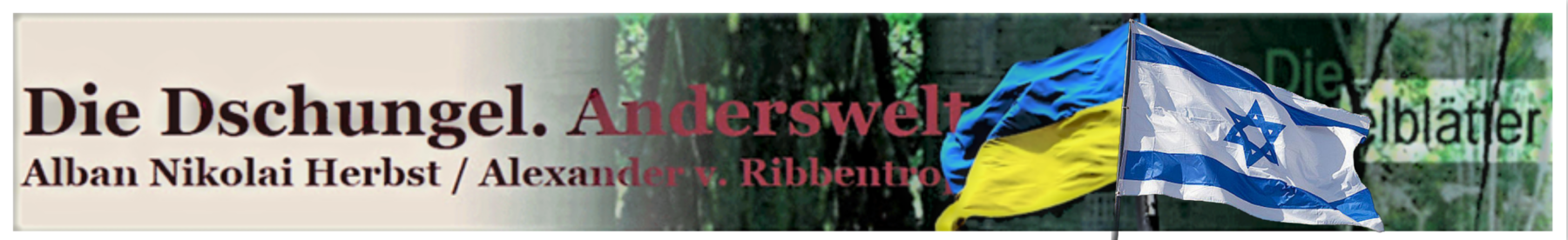
Die Dschungel. Anderswelt.
Das Literarische Weblog, gegründet 2003/04 von den Fiktionären.<BR>Für Adrian Ranjit Singh v. Ribbentrop.
Früher hat man Bücher verbrannt, heute werden sie ganz einfach ignoriert, weil’s die Umwelt weniger belastet.
Stadtbibliotheken stehen in Zeiten knappen Budgets unter einem Rechtfertigungszwang und unter dem zunehmenden Diktat der Massenkompatibilität, vielleicht vergleichbar mit der Quotenhatz im öffentlich – rechtlichen TV. Ignoriert wird, was nicht voraussichtlich mindestens xx mal im Quartal entliehen wird. Und dummerweise greifen da die Mechanismen der Mischkalkulation wie in Buchhandlungen oder Verlagen (obwohl das dort auch abnimmt) überhaupt nicht. Nur persönliches Engagement könnte ein paar Nischen schaffen. Gibt es keines, fällt vieles, auch Lohnenswertes, durch den Rost. Mir wird jedenfalls die zunehmend aggressiver werdende Ökonomisierung vieler gesellschaftlicher Bereiche, von der Kultur über die Gesundheitsversorgung, den ÖPNV bis hin zur Energieversorgung zur Bedrohung. Bücher, z.B., waren früher immer a u c h Ware, mit denen Verlage, Autoren und Buchhändler ihr Geld, ihren Lebensunterhalt verdienten, verdienen mußten. In der Hauptsache waren sie aber Kulturgut, was zu solch lobenswerten Einrichtungen wie öffentlichen Bibliotheken führte. Das „auch“ verliert zunehmend an Bedeutung und Wirksamkeit, in Verlagen Buchhandlungen und im öffentlichen Rahmen.