[Arbeitswohnung, 9.23 Uhr
Vsevolod Zaderatsky, 24 Präludien & Fugen]
Ich habe hier für – Sie werden es, Freundin, gemerkt haben – längere Zeit nicht geschrieben, schreiben nicht können, in Wien des Schlußlektorates der „Wölfinnen“ halber, einem erfüllenden, aber mir zugleich, persönlich, hochambivalentem Akt; d a n n nicht wegen der ersten >>>> Versuche mit Ramirer, der so bald als möglich ein Wochenende folgen soll, an dem wir die Derelvelieder aus dem Ungeheuer Muse „einspielen“ wollen; ebenso hielten mich Arbeitsgespräche mit meinem Arco-Verleger von Der Dschungel fern, der mir einige Lektüren „aufgab“, nun aber auch sehr auf baldiger Abgabe eines Nachworts beharrt, das ich zu schreiben versprachen; schließlich kochte ich für einen  Abend der Buchhandlung 777 Pasta al nero di seppia (von der Insel hatte ich Tintenfischtinte mitgebracht);
Abend der Buchhandlung 777 Pasta al nero di seppia (von der Insel hatte ich Tintenfischtinte mitgebracht); 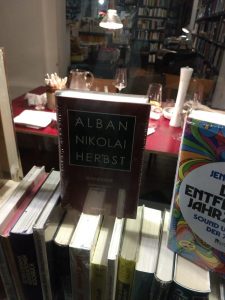 im Schaufenster standen, was mich sehr freute, die Wölfinnen – und das Stückchen Domgasse davor nenne ich unterdessen „mein Wiener Neapel“ – wofür das Wetter geradezu ideal war; wir saßen nachher mehr draußen als drinnen. Doch auch das Lektorat fand zu weiten Teilen unter der Sonne statt, nämlich in Bad Fischaus – einem Örtchen rund fünfzig Kilometer südlich Wiens – wundervollem, gleichsam der Vergangenheit entfallenem Thermalbad. Wo aber auch ein kleines Unglück geschah, das sich hernach in einen Glücksfall wandelte. Zum Schwimmen – wir arbeiteten stets anderthalb Stunden an den Laptops, dann folgte eine halbe Stunde Schwimmen, dann wurde wieder gearbeitet, dann wieder geschwommen usw. jeweils bis zum Abend – hatte ich meine unterdessen so geliebte Girard-Perregaux, daß ich mich ohne sie nackt fühle, in ein innen auf die stoffene Rückwand des neben unseren Liegestühlen errichteten Sonnenzeltes appliziertes Netzchen getan und nachher vergessen, sie wieder anzulegen – und zwar auch noch, als vor der Rückfahrt das Zelt wieder zusammengelegt werden und in seinen Beutel gestopft werden mußte, ein Vorgang, der nicht unbedingt ohne etwas härtere Kraftausübung vor sich geht. Möglicherweise haben wie das verpackte Zelt dann auch etwas unsanft in der dauergemieteten Kabine meiner Lektorin verstaut. Jedenfalls, noch waren wir, um zum Bahnhöfchen zu eilen, nicht durch den Ausgang, als mir, daß ich die Armbanduhr nicht trug, fast schockhaft spürbar wurde. Also nochmal zur Kabine zurück. Im Zug dann merkte ich erst, daß sie nicht mehr lief, bzw. dauernd verhakte: Der Sekunden- blieb am Minutenzeiger hängen und das sehr leise, für automatic typisch flüssige Ticken war verstummt.
im Schaufenster standen, was mich sehr freute, die Wölfinnen – und das Stückchen Domgasse davor nenne ich unterdessen „mein Wiener Neapel“ – wofür das Wetter geradezu ideal war; wir saßen nachher mehr draußen als drinnen. Doch auch das Lektorat fand zu weiten Teilen unter der Sonne statt, nämlich in Bad Fischaus – einem Örtchen rund fünfzig Kilometer südlich Wiens – wundervollem, gleichsam der Vergangenheit entfallenem Thermalbad. Wo aber auch ein kleines Unglück geschah, das sich hernach in einen Glücksfall wandelte. Zum Schwimmen – wir arbeiteten stets anderthalb Stunden an den Laptops, dann folgte eine halbe Stunde Schwimmen, dann wurde wieder gearbeitet, dann wieder geschwommen usw. jeweils bis zum Abend – hatte ich meine unterdessen so geliebte Girard-Perregaux, daß ich mich ohne sie nackt fühle, in ein innen auf die stoffene Rückwand des neben unseren Liegestühlen errichteten Sonnenzeltes appliziertes Netzchen getan und nachher vergessen, sie wieder anzulegen – und zwar auch noch, als vor der Rückfahrt das Zelt wieder zusammengelegt werden und in seinen Beutel gestopft werden mußte, ein Vorgang, der nicht unbedingt ohne etwas härtere Kraftausübung vor sich geht. Möglicherweise haben wie das verpackte Zelt dann auch etwas unsanft in der dauergemieteten Kabine meiner Lektorin verstaut. Jedenfalls, noch waren wir, um zum Bahnhöfchen zu eilen, nicht durch den Ausgang, als mir, daß ich die Armbanduhr nicht trug, fast schockhaft spürbar wurde. Also nochmal zur Kabine zurück. Im Zug dann merkte ich erst, daß sie nicht mehr lief, bzw. dauernd verhakte: Der Sekunden- blieb am Minutenzeiger hängen und das sehr leise, für automatic typisch flüssige Ticken war verstummt.
Meine Güte! dachte ich, das wird teuer werden. Irgendwas ist gebrochen. Wenn es sich bei einem so alten Stück denn überhaupt wird richten lassen.
Es ließ mir keine Ruhe. Zwar habe ich in Berlin einen kleinen Uhrmachermeister entdeckt, nachdem mein vorheriger seine Tätigkeit aufgab (oder aufgeben mußte) und war bei ihm auch schon gewesen, aber mit solch besonderen Stücken kennt er sich kaum aus. Auch wollte ich nicht so lange warten, bis ich zurück wäre, zumal, wo sonst als in Wien finden sich noch die alten Handwerksberufe? Zwar hatte mir meine Lektorin einen Uhrmacher genannt, der aber auf der teuren Wollzeile saß und mir weniger Feinhandwerker, „Meister“ also, zu sein schien als Verkäufer luxuriöser Asseçoirs. Besser, ich suchte etwas im Netz herum.
Was ich tat. Und stieß auf >>>> Uwe Neidhardts Site. Sofort war ich von seiner Erzählung berührt, tief berührt – wie er von seiner Leidenschaft spricht, ja von Liebe.  Zwar anders, als die Site mich imaginieren ließ, ist sein Geschäft eher Lädchen als Laden, von einem „Geschäft“ möchte man fast gar nicht sprechen, aber wie er dann meine Uhr entgegennahm und sie erst einmal einfach nur anschaute – „Na sehn wir mal“ -, und wie er sich an seinen engen Arbeitsplatz setzte, den Chronometer öffnete, tief über ihn gebeugt, die Lupe, die er auf seiner Brille so ständig trägt, als wäre sie längst selbst organischer Teil seines Körpers, keinen Zentimeter von dem Laufwerk weg – da wußte ich sofort, fühlte es, richtig bei diesem Meister zu sein.
Zwar anders, als die Site mich imaginieren ließ, ist sein Geschäft eher Lädchen als Laden, von einem „Geschäft“ möchte man fast gar nicht sprechen, aber wie er dann meine Uhr entgegennahm und sie erst einmal einfach nur anschaute – „Na sehn wir mal“ -, und wie er sich an seinen engen Arbeitsplatz setzte, den Chronometer öffnete, tief über ihn gebeugt, die Lupe, die er auf seiner Brille so ständig trägt, als wäre sie längst selbst organischer Teil seines Körpers, keinen Zentimeter von dem Laufwerk weg – da wußte ich sofort, fühlte es, richtig bei diesem Meister zu sein.
Er half, half quasi sofort – und stellte aber fest, daß dem ohnedies schon leicht zerkratzten Glas der Dichtungsring fehlte. „Es könnte Ihnen jederzeit herausfallen.“ Sah nach, ob er ein Ersatzglas vorrätig hatte, hätte aber nur ein zwar passendes, doch, sagen wir, Surrogat gehabt. Weshalb er das richtige Glas bestellte und dann auch noch, weil es nicht gleich geliefert wurde, selbst abholte, so daß ich zwei Tage später eine quasi komplett überholte Uhr zurückbekam. Dies war der oben so genannte kleine Glücksfall, zu dem das erst einmal Unglück mir wurde. Und nach wie vor geht die Uhr alle zweidrei Tage allenfalls eine halbe Minute nach, doch dieses tatsächlich nur dann, wenn ich sie, etwa zum Schlafen, ab- und in den Uhrenbeweger lege. Trage ich sie auch nachts, geht sie absolut genau – mechanisch und nahezu siebzig Jahre alt! – Was Herr Neidhardt nun für seine tatsächlich liebevolle Arbeit in Rechnung stellte, darf ich gar nicht sagen; es war, als hätte er bereits um die finanziell meist maue Lage von Künstlern gewußt, wie ein Akt von eben-Künstler-zu-Künstler selbst, was solche Meister ja a u c h sind; ob Komponisten, Dichter, Maler oder eben Handwerker: Wir alle sind maniera. Dabei, was ich auch beruflich bin, erzählte ich ihm erst nachher – und brachte ihm als Dank mein Ungeheuer Muse später noch vorbei, signiert, klar, denn auch seine Signatur findet sich jetzt bei mir, im hintren Uhrendeckel in Gestalt seiner Punze. Worauf ich beharrte (ich mußte es nicht lange tun) und was ich, mit federleichtem Stolz, nun gleichfalls an mir trage.
Cristoforo Arco, bei dem ich in Wien immer wohne, trug fast sofort, nachdem ich ihm von Neidhardt erzählt, vier eigene Uhren zu ihm. Das ist vielleicht die schönste „Revanche“, zu der ich fähig, diesem Mann weitere neue Kunden zu bringen. Auch Ihnen, Freundin, möcht ich ihn empfehlen, wie all meinen anderen Leserinnen und Lesern. Denn der Beruf des Uhrmachermeisters stirbt quasi aus – nicht, weil es kein Bedürfnis mehr gäbe, sich ihnen anzuvertrauen, sondern weil die großen Unternehmen diese kleinen Betriebe schlichtweg boykottieren, indem sie zum Beispiel nicht mehr oder nur zäh mit Ersatzteilen beliefert werden. Man gräbt ihnen, industriehalber mit Vorsatz, das Wasser ab. Wer immer eine, sagen wir, Swatch trägt, tut dabei mit. Es ist dies die ökonomische Seite der political correctness, sprich: Normation der Seelen. Ist die den Markt bestimmende Fetischisierung der Äquivalenzform.
*
Die Zeit meiner Rückreise näherte sich, das Schlußlektorat war abgeschlossen. Jetzt wäre auf die ersten Fahnen zu warten. Wir gingen zur Feier noch einmal essen, meine herrliche Lektorin und ich; ihr Junge war dabei, den ich sofort ins Herz geschlossen – was aber ebenfalls leicht wehtat, weil es mir meine Sehnsucht, die, wie vergeblich auch immer, nach wie vor nicht erloschen, so vor Augen führte: noch einmal Vater zu werden. Denn wie, ohne eine mögliche Mutter?
Ich sann darüber sehr oft nach, wenn ich unten, vorm Arco Verlag, auf der Bank saß und rauchte:

***
Ich sinne immer noch, hier in Berlin. Auch dies ein Grund, daß ich so lange in Der Dschungel nicht schrieb. Schon in Schwechat erwischte mich eine Breitseite der Melancholie, das angeflutete, sich in mir zerfließende Wasser kroch vom Herzen hoch in den Kopf und hinab in die Beine; selbst mein Geschlecht voll Traurigkeit. Darüber hinaus überkam mich Wut, der ich in Der Dschungel nicht abermals Raum geben wollte. Zwar hat es nun diese schöne Kritik im SWR gegeben, was zu etwas Erleichterung führte, aber unterm Strich bleibt die Rezensionsbilanz des ersten Bandes der Erzählungen erbärmlich. Gegen dumme, deutlich gehässige und absichtsvoll-unrechtmäßig schlechte Kritiken kann ich mich wehren, bei Ignoranz bin ich hilflos. Was sie so schlimm macht, aber, das ist, daß sie unterdessen auch auf mein Leben, als personales, einwirkt. Es spielte anders mein Alter nämlich keine Rolle, nicht in meinem physischen Zustand eines durchtrainierten, geisteshellen Mannes, der, wenn er nicht nachlässig wird, gut noch drei Jahrzehnte vor sich hat – die er auch braucht, um fertigzubekommen, was er sich vorgenommen. – Also. Hätte ich gute Einkünfte aus meinen Büchern und wäre geehrt, es wäre den Frauen mein Alter egal. Aber ständig halb im ökonomischen Abrutschen, zumal künstlerisch nicht mal im Kanon? Da ist, mit Recht, für Mutterschaft das Risiko zu hoch. Was, wenn mich dann doch eine Krankheit erwischt – ab sechzig wahrscheinlicher denn zuvor? Und für das Kind ist keine Sicherheit? Das Problem hat Herr Schröder so wenig (nie hätte ich geglaubt, daß ich ihn mal beneiden würde), wie Picasso es hatte. Aber es ist meines, mein Problem – ausschließlich dieser Ignoranz halber, die mein Werk verschweigt. Jetzt – nach so vielen Jahren durchgehaltenen Kampfes und obwohl meine Vitalität die mancher Dreißigjähriger nach wie vor weit, sehr übertrifft – haben sie mich, meine Gegner, erwischt, verbündet mit einem genetischen Code. Aus dieser Enge komm ich nicht mehr raus – egal, was ich n o c h alles schreiben werde.
Übrigens ist es auch mit der L i e b e nicht anders. Zum einen, weil es zwischen meinem Körper und meinem Lebensalter eine fast radikale Antinomie gibt, auf die ich zwar einerseits stolz bin (weil ich sie mir, trainierend, aus nichts als eigenem Willen „erarbeitet“ habe), die sich nun aber, andererseits, fast wie ein kleines Verhängnis auswirkt: Frauen, die ich begehre, sind fast notwendigerweise viel jünger als ich, zum einen, weil mit über Fünfzig Kinder zu bekommen, auch medizinisch heikel wird, zum anderen, weil nicht sehr viele Frauen älteren Jahrgangs ebenfalls mit solch einer, wie meiner, Antinomie zu schaffen haben, bzw. „gesegnet“ sind; und bei denen es so ist (klar, es gibt sie), läßt sich davon ausgehen, daß sie fest gebunden sind. Dies jedenfalls, wie’s mir bislang begegnet. Zumal haben ältere Frauen in aller Regel ökonomische Ansprüche, sagen wir: solche der Lebensqualität, die ich, ecco, nicht erfüllen kann und erfüllen bislang auch nicht wollte. Wohlstand, geschweige Vermögen war niemals für mich Kategorie; daß sie es nun wird, werden muß, hängt schlichtweg mit meinem so sehnsüchtigen Kinderwunsch zusammen.
Jetzt wissen Sie, Freundin, die Gründe meines langen Schweigens. Es gibt Momente, in denen ich mit dem Gedanken an eine junge Frau aus der sogenannten Dritten Welt spiele. Ein moralisches Problem hätte ich damit nicht. Meine Lebensumstände sind immer noch unvergleichlich besser als diejenigen, in denen die meisten dieser Frauen sich befinden und weiterbefinden werden, wobei es ja immer noch, in aller Regel, schlimmer für sie werden wird, zumal in den harten Patriarchaten. Da können sie, mit einem wie mir, nur „gewinnen“. Aber worüber spreche ich mit ihnen dann, und sie mit mir (vorausgesetzt, daß wir uns verständigen überhaupt können)? Was ist mit der Kultur, die wir teilen müssen, anders ich gar nicht wüßte, wie leben? Was mit der abendländischen Musik, mit der Dichtung, ohne die ich nicht wäre noch sein könnte? – Nein, es ist kein Weg – aber auch deshalb schon nicht, weil für mich die Voraussetzung, ein Kind zu zeugen, eben Liebe ist, tiefe Liebe zu der, die ich zur Mutter machen möchte – oder „wahrer“: die mich als den Vater ihres Kindes erwählte. – Du mußt nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie.
Um nun wenigstens erotisch nicht asketisch zu leben – und weil ich mich weigere, für Sex zu bezahlen; es würde mich dies, als Kapitulation, was es wäre, in scharfe Depressionen stürzen -, nahm ich mir nach meiner Rückkehr vor – als die Melancholie nämlich so sehr in mir hochgestiegen war, daß ich nicht einmal mehr arbeiten konnte -, etwas zu tun, wovon ich mich spätestens abgewandt hatte, als mir die nächste Frau begegnete, fünf Jahre ist es beinah her, die mir ein neues Leben zu geben schien und der ich noch immer so tief, wie kaum jemandem sonst, verbunden bin; dennoch, es durfte nichts werden, nicht, was ich wünschte -, also: wovon ich mich abgewandt hatte: Gut, sagt ich mir, dann eben zurück in die BDSM-Szene, in der es auf Alter tatsächlich kaum ankommt, statt dessen auf Präsenz, Agilität, Schönheit, ja, auch, und fantasievolle Intelligenz. In meinen fünfzehn ersten Berliner Jahren habe ich viel und gut drin mitgespielt – „Spiel“ ist ein dort sehr gerne verwendeter Terminus. Und machte tatsächlich einen „Termin“ aus.
Er nahte.
War fast schon da, jedenfalls der Vormittag vor dem vereinbarten Abend.
Da ging Post ein: der erste Fahnensatz des zweiten Erzählbands. Dazu zwei neue, so dringende Aufträge, daß ich sie am selben Tag noch erledigen mußte. Auch wollte, klar. Ich bin verläßlich. Und sagte das Treffen also ab. Es hätte am vergangenen Donnerstag stattfinden sollen, von dem an ich bis gestern nacht außer den zwei neuen Aufträgen nichts erledigte als die Fahnen zu korrigieren, bislang 619 Seiten, von morgens um etwa sieben bis jeweils gegen zweiundzwanzig Uhr. Einiges, tatsächlich, war – und bleibt noch, bevor das Buch in Druck gehen kann – an ihnen zu tun:

Immerhin, so war keine Leere und also auch nicht die Melancholie. Die sich indessen heute früh, nachdem meine Arbeit an die Lektorin hinausgeschickt war, „pünktlich“ wieder meldete und aber jetzt, nämlich hier, zumindest beschrieben werden wollte. Damit ich irgendwas gegen sie stemme – und sei’s nur, indem ich ihr Form geb.
*
Momentan weiß ich denn auch nicht, wie ich die Béartgedichte zum Abschluß bringen soll. Einige Stücke fehlen noch, ich setze auch immer wieder an, komme aber über einzwei Verse nicht hinaus, weil mir der hymnische Ton nicht mehr gelingen will; immer wieder wird er vom Abschiednehmen überschattet, was der erstrebten Einheitlichkeit nicht gut tut, vor allem nicht: der Leichtigkeit, die ich erreichen möchte. Der Rhythmus soll fließen wie ein Tanz, da darf niemand schleppen oder gar stolpern. Ich möchte Beseelung vermitteln, von der ich völlig durchdrungen war, als ich den Zyklus begann – und lange Zeit noch danach; was aber nicht mehr geht im Zustand dauervermissenden Liebens. So fing denn das Traurigsein an, von freilich immer wieder freien Momenten innerer Aufbrüche, Neuaufbrüche, durchsetzt, ein ständiges Auf und Ab, dem ich weiterhin ausgesetzt bin. Dazu noch, eben, diese Wut. Doch immerhin, kein Abgeklärtsein, kein sich-endgültig-Abfinden, zwar zuweilen Resignationsschübe, aber doch immer wieder der alte glühende Protest, sogar Trotz. Und manchmal neu die Hoffnung.
ANH, 14.07 Uhr
P.S.:
Eines noch zur Musik, die unter diesem Arbeitsjournal liegt. Zaderatsky ist eine Entdeckung, die mir David Ramirer nahegelegt, mit der er mich sogar versorgt hat. Es lohnt sich tatsächlich sehr, seine Stücke anzuhören – aber sich auch klarzumachen, unter welchen Umständen er sie schrieb. Dagegen ist meine Melancholie deutlich marginal. Es wär von mir bizarr, das nicht zu sehen. Alleine, wir hungern verschieden.
P.P.S.:
In der Zeit, die ich in Wien verbrachte, ist mein großer Sohn von zuhause ausgezogen. Auch dies ist ein Umbruch. Er lebt nun, mit einem Freund, in einer eigenen Wohnung – für mich ein viel größerer Schritt als ihn der Tag markierte, da er volljährig wurde.
Es macht mich einerseits stolz, sehr stolz, verstärkt wahrscheinlich aber auch meine Vaterschaftssehnsucht. – Nur will ich von ihm, meinem Sohn, und seiner neuen Wohnstatt heute nicht weiter schreiben, gerade auch, weil es in mir Erinnerungen reaktiviert, die ich verloren glaubte. Und zwar als Differenz.
