und dort in der Ausgabe 4/2017 erschienen.
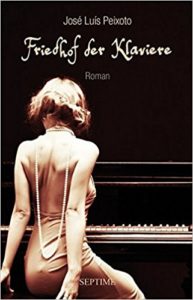
„Sprichst du noch immer zu den Menschen im Buch?”
Ja, noch immer.”
Schweigen.
„Bist du müde?”
Nein, noch nicht.”
Diese Sätze finden sich kurz vor dem Ende des Romans. Es unterhalten sich eine Dreijährige und ihr schon gestorbener Großvater, der auch moniert, daß ein so kleines Kind derart noch nicht sprechen könne. Denn sie sagt noch allerlei andere für Erwachsene eigentlich „altkluge” Sachen. Dabei müßte der Großvater längst wissen, daß es auf die Sichten des Alltags längst nicht mehr ankommt – auch wenn er, dieser Alltag, einer „einfachen” Tischlerfamilie Lissabons vollkommen im Zentrum seiner Erzählung steht.
José Luíz Peixotos ungeheures, in seiner Sprache allenfalls noch mit Lobo Antunes vergleichbares Buch beginnt mit dem Tod des Erzählers – eines Erzählers nur, wie sich knapp hundert Seiten später herausstellt. Da übernimmt nämlich der Sohn, dessen Tochter das kleine Mädchen ist, die Erzählung und läuft damit auch auf seinen Tod zu. Francisco ist Langstreckenläufer. Bei Kilometer 30 wird er zusammenbrechen. Bis dahin erinnert er sich Kilometer um Kilometer, und seine Sprache, ja seine Motive werden denen seines Vaters zunehmend ähnlich, bis er schließlich diesen Satz sagt oder inneren Ausruf tätigt, der meiner Rezension den Titel gibt.
Am Tag, da er, der Sohn, im fernen Stockholm stirbt, wird wiederum sein Sohn geboren, in Lissabon. Und auch dessen Sprache wird zu der der Väter – obwohl im Zentrum des Romans die Frauen ganz genauso stehen. Das ist eine der berückendsten Volten dieses enormen, wenn auch mit 317 Erzählseiten nicht sehr langen Romans. Wie sie zum Sprechen kommen.

Ich hatte schon einmal ein Buch Peixotos gelesen; es scheint nicht an mich gegangen zu sein. Jetzt las ich einen neuen Autor, erinnerungslos, und wurde vom ersten Satz an in einen Mahlstrom aus Bildern, Klängen und Erinnerungen gerissen: „Als ich krank wurde, wußte ich gleich, daß ich sterben würde.”
Nun aber ging es überhaupt erst los – in einer Sprache, wie sie kein deutscher Autor, den ich kenne, zustandebekommt. Es ist, mindest zur Hälfte, die der Übersetzerin. Sie heißt Ilse Dick und könnte für das offenbar magische Portuiesisch eines Tages eine Position einnehmen, wie Svetlana Geier sie für die russische Prosa Dostojewskis innehat.
Erzählt wird – auf, nüchtern betrachtet, abgefeimt hochkonstruierte Weise – die Geschichte dreier Generationen mit sämtlichen Verfallenheiten, Leidenschaften, auch sämtlichem Unrecht, das Menschen während ihrer Lebensspannen geschieht, und sämtlichen Sehnsüchten, die wir alle haben. Dabei schaut Peixoto nicht hinauf zu Helden und Filous der Mächte, sondern beugt sich ins scheinbar Kleine, Einfache. Dort entfaltet er die Größe: nahe an den „Dingen”, niemals distanziert. Was ihm die billigste aller Haltungen gleichsam von selbst verbietet: Ironie.
Unironisch beginnt er auch – mit einem RESURRECTURIS, quasi dem Prolog. Ich meine, welcher knapp vierzigjährige Dichter wagt sich heute sowas noch? Na gut, Orths, Schachinger und Stavarič; dort aber ist der kanonische Zusammenhang das ausgewiesene Thema. – Und wie gleichsam „natürlich” hier dann alles Folgende daherkommt!
Der Kniff dafür ist einer, den ebenso Kjaerstad, wenn auch anders, in seinen Walker-Brüdern angewandt hat. Es geht nicht darum, möglichst so zu schreiben, wie wir sprechen, sondern um eine Artifizialität, die derart hochgetrieben ist, daß wir sie für natürlich halten, sie also, ohne zu fragen, hinnehmen: Genau das, was der gestorbene Großvater auch gegenüber seiner kleinen Enkelin tun muß. Damit so etwas gelingt, muß die Schönheit der Sprache leuchten, und die Metaphern müssen uns ergreifen: „Sie gingen in Marias Wohnung, und jeder verharrte verlassen in einem Winkel seines eigenen Leides.” Oder etwas später: „Meine Frau drehte sich zu mir um und sah mich allein da stehen, die Arme und Augen verwaist. Und ich wartete. Sah auf die Uhr. Morgen. Ein Morgen von der Länge eines Sommers. Der ganze Morgen.”
Ein Morgen von der Länge eines Sommers, dahinter der profanierende, durchs Profanieren aber besonders aufgeladene Nachsatz. Das ist nicht Plot-Erzählung, auf die die nächste Serie wartet. Sondern das ist, kompositorisch von Leitmotiven geklammert, Dichtung. Nur sie, ist uns an Literatur gelegen, kann noch von Bedeutung sein.
„Du hast nicht nur dein Leben gelebt”, sagt die Dreijährige. „Hast du schon Oma gesehen? Du hast sie kaputt gemacht. Du hast sie früher altern lassen als all die anderen Frauen ihres Alters. Du kannst sagen, was du willst: Das Licht hat dir den Blick getrübt, du hast nichts gesehen, es gab eine Kraft, die deine Bewegungen gelenkt hat, du hast nichts gespürt (…).” Womit sie das Bewegungszentrum dieses Romanes beschreibt: – eine Tragik, die vom Großvater auf den Sohn und von dem auf den Enkel übertragen wurde, modern gesprochen: ein Familienmuster.
„Ein Teil meines Vaters erwachte zu neuem Leben, wenn ich in den Spiegel sah, wenn ich existierte, und wenn meine Hände damit fortfuhren, all das zu schaffen, was er, heimlich, so nah und doch so fern, begonnen hatte. Ich dachte, ein Teil meines Vaters bliebe in mir, und ich würde ihn an meine Söhne weitergeben, damit er in ihnen bliebe, bis diese ihn eines Tages an meine Enkelkinder weitergeben würden.”
Peixoto bringt dieses Familienmuster so herzbeklemmend nahe, gerade indem er die Tiefe der jugendlichen Lieben in aller strahlenden Macht, auch ihrer Ängste, entfaltet, und ihre Erfüllungen. In einem nächsten oder kurz darauf folgenden Abschnitt aber das, was schließlich aus ihr wurde, bis hin zum Faustschlag ins Gesicht der einst Geliebten, bis hin in deren Verhärmung, die alles, alles hinnimmt, Mütter, Töchter, Enkelinnen, weil sie aber ja auch selber lieben, immer noch, verzweifelt, zunehmend verstummend: „Ich versuchte, in die Welt unter ihren Augenlidern einzutreten.” Was die kleinen Kinder bereits sehen, ein Unglück, das auch ihres werden wird, aber eben nicht nur Unglück ist, Unglück war, sondern einst auch die höchste uns gegönnte Erfüllung: „Sie waren junge Männer und haben geglaubt. An anderen Orten stand auch für sie die Zeit still, wenn ihre Lippen Lippen berührten. Auf der ganzen Welt, auf Plätzen, auf Treppen, auf Brücken, in Tunnels, die einfache Geste von sich nähernden Lippen, Haut, die sich an der Schwelle ihrer Umrisse zu berühren beginnt, die sich vereint, langsam und vollkommen und so bleibt, Haut auf Haut, Lippen auf Lippen; auf der ganzen Welt, unter vielen so unterschiedlichen Bäumen, unter dem Geläut vieler Glocken, an den Ufern kleiner und großer Flüsse, Haarsträhnen, die eine Wange berühren”: und und und und und: José Luíz Peixoto hat uns allen einen Weltgesang geschenkt, dessen Zentrum immer, immer, immer das Jetzt ist, ein unendlich währendes, immer anderes und doch immer dasselbe, und hindurch tönt wieder und wieder, weiblich oder männlich, Jacques Brels schließlich unentwegt enttäuschtes Ne me quitte pas („Verlaß mich nicht”, S. 251), das dennoch nie einhält, an die Beschwörungen zu glauben. Denn sind die Mütter und Väter gescheitert, nehmen die Töchter und Söhne sie auf. Doch ihre Hände, auch, „glichen Schmetterlingen, die über den Tasten starben”.
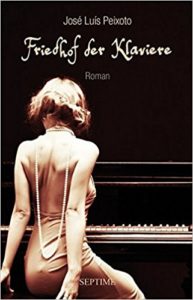
ANH, 29.10.17
Berlin
José Luís Peixoto
Friedhof der Klaviere, Roman
328 S., geb. mit Schutzumschlag
Septime Verlag Wien 2017, 23 Euro

Siehe auch >>>> dort.